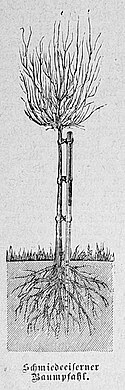Die Gartenlaube (1887)/Heft 15
[237]
| No. 15. | 1887. | |
Illustrirtes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Wöchentlich 2 bis 2½ Bogen. – In Wochennummern vierteljährlich 1 Mark 60 Pfennig oder jährlich in 14 Heften à 50 Pf. oder 28 Halbheften à 25 Pf.
Götzendienst.
Eine öde Nummer! Oberfaul!“ rief Lieutenant Mühüller, das surrende Geräusch des Gaskandelabers, das die hohe feierliche Treppenhalle erfüllte, übertönend. „Vier Assistenzärzte und ein halber Zahlmeister – es ist zum Radschlagen!“
Es war vom neuesten „Militärwochenblatt“ die Rede. Auch der Oberstlieutenant liebte es, selbst noch nach zwanzigjähriger Inaktivität in Avancementsgesprächen zu schwelgen; er bekam das wichtige Blatt regelmäßig von Eff zugestellt.
„Es scheint Alles zu stocken dort oben,“ antwortete er, „es rückt und weicht nicht. Ze … ze … ze … zu meiner Zeit (das famose ‚zu meiner Zeit‘ der Pensionäre, das so bitter, so scharf, so wehmüthig, so stolz, so liebevoll hätschelnd zu klingen vermag), zu meiner Zeit warteten wir oft halbe Ewigkeiten auf einen Eisgang. Ich wußte es, nach dem Krieg mußte ein Umschlag eintreten. Sehen Sie, meine Herren, mit dem Avancement ist es so eine Sache –“
Und er blieb auf der Treppenstufe stehen, setzte sich förmlich in Positur, um seine besondere Avancementstheorie zum hundertsten Male aus einander zu setzen.
Um Gotteswillen – hier auf der Treppe! Er würde kein Ende finden! Der angehende Generalstäbler kam dem Unheil in seiner ruhig höflichen Art zuvor:
„Wissen Herr Oberstlieutenant schon, Stachvogel soll die …te Division erhalten!“
„I was Sie …? Ich bitte Sie, Stachvogel?! Der ist ja noch gar nicht an der Tour!“
Die Neuigkeit hatte eine erregende Wirkung, und die stramme Positur ließ sich nicht länger behaupten.
„Ze … ze … wissen Sie auch, daß ich Stachvogel noch bei meiner Schwadron als Lieutenant hatte? Später mein Adjutant.“
Er hatte ihnen oft genug von dieser Adjutantur erzählt.
Wenn er daran dachte! Wie oft hatte er Stachvogel vor der Front abgekanzelt! Freilich gewann später der Adjutant über ihn die Oberhand. Sein Untergebener damals, aber ein recht schwieriger – und nun eine Excellenz! Was wäre er selbst denn jetzt schon, wenn er geblieben wäre! Ach, all der fröhliche Glanz, der aus jener Zeit in das Dunkel seiner alten Tage herabstrahlte!
Sie hatten den Podest des Erdgeschosses erreicht. Die Thüren zu den Komptoirräumen der Firma Belzig standen offen; drinnen summte es von geschäftigem Geräusch; Arbeiter kamen mit schweren Stößen von Drucksachen und Büchern – und dort vor dem aufdringlichen Glanz des großen messingenen Schildes, das die Bezeichnung: „Otto Friedrich Belzig, Verlagsbuchhandlung“ trug, verblaßte plötzlich die ganze Herrlichkeit der Erinnerungen.
Vor sechs Jahren war es, als dieses Schild ihm zum ersten Male mit brutaler Deutlichkeit das ganze farblose Nichts seines a. D. aufgedeckt. Er stand mit
[238] seinem Töchterchen Olga davor – als Bittende waren sie gekommen, Arbeit suchend, Arbeit für Olga’s fünfzehnjährige Kinderhändchen Es war in der Zeitung der Köder: „Leichter Verdienst für Damen“ ausgeworfen worden: ein renommirter Verlag, der geschickte Hände zum Koloriren brauchte.
„Papa! ach ja, Papa! Ich gehe hin, ich melde mich! Wozu nützt mir sonst mein Zeichentalent?“
Das herzige Kind war ganz Begeisterung.
Papa war erstaunt – er verstand nicht sofort. Was? Sie wollte gleich einer Tagelöhnerin sich hinsetzen und Bilder koloriren? Die Tochter des Oberstlieutenants Freiherrn von Gamlingen?
„Aber, Papa, was ist dabei? Es ist ja nur des Scherzes wegen. Ich werde mich kostbar amüsiren. Versuchen kann man es doch!“
O, es gab so noch so viel Zeit unterzubringen! Es war ja nicht dies niedliche Persönchen mit seinem klugen Blondkopf, nein, es waren gewiß die unsichtbaren Heinzelmännchen, welche die Wirthschaft des Vaters so musterhaft blank in Ordnung hielten – wer könnte sich auf eine plumpe und übelnehmende Aufwärterin verlassen? O gewiß, die fünfzehnjährigen Händchen waren ja nur so rauh vom Klavierspielen und die allerlei kleinen Narben rührten vom Romanlesen her.
Es war wie ein Schreck, der den guten Papa überfiel. Man hätte es ihm allmählich beibringen können; aber dergleichen Annoncen spornen zur Eile. Sie hatte nicht bedacht, wie unvorsichtig sie damit die ganze Situation bloßlegte. Nun ja, die Verhältnisse waren nicht glänzend, das Vermögen des Freiherrn war durch allerlei Zufälle in den letzten Jahren immer mehr zusammengeschmolzen, die beiden Brüder, die in kostspieligen Regimentern standen, hatten tüchtig von der väterlichen Schatulle gezehrt, und man wollte den braven Jungen nicht den Tort anthun und sie in obskure Regimenter versetzen lassen. Es war noch ein Dritter da; an der Wand des Wohnzimmers hing das verblaßte Daguerreotyp eines jungen Menschen im Maskenanzuge. Sie wußte: es war der Aelteste. Sie erinnerte sich nur ganz dunkel aus ihrer frühesten Kindheit seines Gesichtes und eines gewissen, immer wiederkehrenden Alarms, den seine Streiche im Hause verursachten. Dann erlosch seine Spur. Papa sprach nicht von ihm, nicht mit ihr, die doch sonst in alle seine Verhältnisse eingeweiht war. Zuweilen, wenn die beiden Brüder zu Besuch waren, ließen diese scharfe verdammende Worte über ihn fallen. Aber der Vater vertheidigte ihn immer wieder, sein Herz vermochte sich nicht von dem Herzen des unglücklichen Verlorenen loszureißen. Manchmal kamen Briefe an, die der Alte verheimlichte; sie wußte auch, daß die nur zu bereitwillige Schatulle sich eben so heimlich gewisser Geldsendungen entledigte.
Der Freiherr hatte nach dem Tode der ersten Gattin abermals geheirathet. Die Erkorene war die Wittwe eines entfernten Vetters von Gamlingen und Mutter des niedlichen Blondkopfes Olga. Doch auch dieses Band zerriß der unerbittliche Tod nach kurzer Frist, Olga war vier Jahre alt, als ihre Mutter starb. Sie bewahrte von der Verklärten nur die dunkle Erinnerung einer zarten, blassen Gestalt, die ihr kleines Dasein mit lautlosen Engelsfittichen umschwebt hatte. Doch ihr Andenken schien im Laufe der Jahre zu einem immer deutlicheren Bilde in der rührenden Verehrung heranzuwachsen, welche Stiefvater und Stiefbrüder der Verstorbenen widmeten.
Stiefvater – Stiefbruder – die häßliche Silbe „Stief“ – sie wollte nichts davon wissen! Warum hatte sie überhaupt davon erfahren, daß Papa nicht ihr leiblicher Vater? Konnte sie sich denken, daß es eine Kindesliebe gab, die sich das Recht anmaßte, stärker und echter zu sein, weil sie im Blute wurzelte? Trug sie denn nicht denselben Namen wie ihr Vater?
Der Krach eines Bankhauses ließ das Vermögen bis auf einen winzigen Rest auffliegen, und man war fortan auf die bescheidene Pension angewiesen. Welches Elend, unter der Last solches Namens Noth zu leiden! Aber man muß tapfer sein! Nun gerade wollte Olga zeigen, daß sie eine Trutz-Gamlingen ist! Ist denn Arbeit eine Schande?
Wie sie zugriff! Wie sie ihre zehn Heinzelmännchen in der Wirthschaft leistete! Welch eine Heldin, dies Kind, das mit seiner Fröhlichkeit selbst die grauesten Tage sonnig verklärte!
Der Freiherr selbst hatte es mit einer Stellung versucht. Er war alt, er war Kavallerie-Officier gewesen; das Vorurtheil, einer anderen Sache zu dienen, die nicht die Etiquette „Königlich“ trug, beengte ihn, und der Name schmerzte ihn bei jeder Bewegung wie ein Dorn; in der subalternen Luft eines Bureaus wäre er erstickt. Er war von Versuch zu Versuch getastet, man hatte ihn zuletzt in das Kuratorium einer größeren patriotischen Stiftung gewählt, wo er über das Bedürfniß hinaus sich abmühte für das geringe Honorar, das an dem Amte hing und das ihn wie ein Almosen zu bedrücken schien.
Da warf die Firma Belzig den Köder aus. Es wäre eine verschämte Arbeit, die nicht anstrengen würde und die mit dem Namen nicht in Konflikt käme. Am Nachmittag standen Vater und Tochter vor dem glänzenden Schild in dem vornehm dämmerigen Treppenhause am Lützowufer, dessen reichlicher Pflanzenschmuck eine würzige Treibhausluft verbreitete. Endlich wurde geöffnet; ein Kontorist nickte barsch und wies die Bittsteller nach einer zweiten Thür, man bäte Platz zu nehmen da drinnen.
Die Aufforderung war wohl nur ein Hohn? Sie wären auf der Schwelle fast umgekehrt: ein großer Saal, der mit Wartenden und Bittenden gleich ihnen angefüllt war. Die ganze verschämte Armuth des Potsdamer Viertels schien sich hier ein Rendez-vous gegeben zu haben. Damen jeglichen Alters, von dem Backfischchen mit bebändertem Zopf, das mit naiver Neugier sich der Neuheit dieser Situation fast zu freuen schien, bis zu dem verhärmten Mütterchen, das mit bebender Angst die Konkurrenz immer noch anwachsen sah. Die wenigen Stühle waren besetzt; man stand umher, in den Fensternischen, an den Wänden, in der Mitte des Saals, die meisten nach der Thür hingedrängt, die sich von Zeit zu Zeit öffnete, um eine der Konkurrirenden in das Allerheiligste vorzulassen. Es gab allerlei Toiletten, einzelne scheinbar elegante, die sich aber dieser Eleganz an solchem Orte schämten und sich in den Winkeln zu verbergen suchten, andere, die in ihrer zusammengerafften Originalität sonst gewiß ein Lächeln hervorgerufen hätten, und auch das fadenscheinige zusammengeflickte Elend, das sich mit der Eleganz zusammen in den Winkeln drückte. Die verhärmten, die blassen, ja die offenbar krankhaften Mienen herrschten vor – man hätte glauben können, sich in dem Wartezimmer eines berühmten Arztes zu befinden. Von wieviel grausam zerstörten Illusionen, von wieviel zerbrochenen Lebenshoffnungen erzählten diese Gesichter! Aus einigen grinsten die Noth und der Hunger in erschreckender Hohlheit. Nur hier und da wurde ein Gespräch angeknüpft, das gleich wieder einsickerte; man schämte sich vor einander, man wand sich hin und her, um nicht gesehen zu werden; man musterte sich mit mißtrauischen Blicken; eine peinliche Stille der Verlegenheit lag über dem dumpfen Raum.
„Komm, Kind, hier ist nichts für uns,“ flüsterte der Freiherr.
„Aber, Papa, das weißt Du ja nicht, wir müssen doch abwarten.“
Und in den lachenden, auch hier noch lachenden Augen seines Kindes fand der alte Herr den Muth, in der Scham dieser Stunde auszuharren, die Bilder an den Wänden immer von Neuem zu betrachten, immer von Neuem sich mit den Anderen nach der sich öffnenden Thür umzuwenden, die eigene Ungeduld niederzuhalten, während die Pein des langen Harrens die nervöse Unruhe ringsum steigerte. Ja, es war eine bittere Stunde der Demüthigung.
„Papachen liebes Papachen …“ Wie das gute Kind mit seinem süßen Geplauder ihn zu zerstreuen suchte! Wie ihr köstlicher Humor der Scenerie die komische Seite abzugewinnen wußte! Und von Zeit zu Zeit ein Trosteswort: „Jetzt sind wir noch dreißig – jetzt nur noch vierzehn –“
Endlich kam die Reihe an den Freiherrn und seine Tochter. „Papa, laß mich gehen!“ wehrte sie, da er mit in das Heiligste eintreten wollte. Sie bestand darauf, dem Vater die neue Demüthigung eines Examens da drinnen zu ersparen.
Und siehe da, nach einigen Minuten kam Olga mit strahlendem Gesichtchen zurück. „Angenommen, Papa! Meine Aquarelle müssen wohl Gnade gefunden haben vor diesen Brummbären.“
Sollte es nicht die naiv vertrauende Fröhlichkeit des Gesichtchens gewesen sein, welche die Brummbären besiegt, oder hatten die paar unbeholfenen Blumenstücke, über die man mitleidig lächelte, den Ausschlag gegeben?
Von nun an saß die kleine Heldin viele Stunden des Tages an dem zum Fenster gerückten Tisch und kolorirte. Anfangs eine lustige Arbeit! Es gab immer noch zu lachen über den possierlichen Ernst der Figuren, die auf ihre Farben warteten, und über die [239] drolligen Bonbonverse, die darunter standen. Nach und nach verödete diese Beschäftigung zu einer mechanischen Tagelöhnerarbeit. Nun, es ließ sich aber so hübsch plaudern, während der Pinsel fast mit der kunstlosen Eintönigkeit eines Besens sein Werk verrichtete, und die Schmetterlinge der Gedanken konnten so ungehindert ins Weite flattern. Papa saß ihr dabei gegenüber an demselben Tische und brütete im Angesicht der dicken Stiftungsakten über einem Referat – oder war es nur das Gefühl, daß er nicht hinter seiner Heldin zurückbleiben wollte, was ihn seine Peinlichkeit verdoppeln hieß?
Welche Freude, wenn am ersten des Monats der Kassendiener der Firma Belzig das Honorar brachte! Nicht viel, aber es reichte doch aus, die Miethe zu bezahlen, und im Lauf der Jahre gab es eine Steigerung, als der Verlag zur Herausgabe seiner neuen Puppentheater („unverbrennbar“ natürlich) nebst Textbüchern schritt, die eine Zeit lang in der Spielwaarenbranche Sensation machten.
Einmal kam eine Zeit, wo die Sonne des Humors, die den Kolorirtisch so freundlich beschien, nicht mehr recht leuchten wollte – Monate lang. Es war während des deutsch-französischen Krieges; mit wenigen Wochen Abstand meldete die lakonische Kürze der Verlustliste den Heldentod der beiden Söhne. Der alte Gamlingen war wie gebrochen; aber auch nachdem die Zeit das erste bittere Weh gestillt, blieb eine schmerzhafte Narbe zurück: wenn ihm die Gnade Gottes doch nur einen der prächtigen Jungen bewahrt hätte – nur einen, der den alten Namen der Gamlingen vor dem Erlöschen schützen konnte! So aber würde dieser Name, der die Jahrhunderte kräftig und glanzvoll überdauert, dereinst mit Olgas Verheirathung, mit seinem eigenen Tode, wie ein welkes Blatt verweht werden.
Ist denn nicht der – Dritte da? Da erst erfuhr Olga Näheres über die Irrsale des Verlorenen. Ah, nicht er wäre berufen und befugt, den Namen stolz wie eine Standarte durch die Zeiten dahinzutragen! Und dann, wo war er? Seine Spur war plötzlich, vor Jahren schon, abgerissen. Dann brachte ein Zufall, der Auszug aus dem Schiffsrapport eines Atlantic, die Nachricht seines Todes; er war auf der Rückfahrt nach Europa verstorben. Wenn es die Ehre des Namens galt, so mußte dieser Tod fast willkommen geheißen werden. –
Ja, es war nicht viel Freudiges, was der Spiegelglanz des messingenen Schildes dem Alten beim Vorüberschreiten ins Gedächtniß rief. Aber es wäre Unrecht, ja Undankbarkeit gewesen, wenn er dem Schilde gegrollt hätte. Das geschäftliche Verhältniß zu den Belzig’s hatte sich im Laufe der Jahre zu einem freundschaftlichen gestaltet. Besonders Olga hatte viel dort im Hause verkehrt; Frau Belzig gefiel sich darin, dem Freifräulein eine hätschelnde Mutter abzugeben; Olga war klein und zierlich geblieben und wollte aus dem Backfisch nicht herauswachsen, den großen blitzenden Augen zum Trotz, die so resolut in die Welt hineinschauten. Die Tochter eines Pensionirten – hatte sie denn ein Anrecht, mehr von dem festlichen Lichterglanz des Lebens kennen zu lernen, als den Schein, der von den hellen Fenstern in das Dämmer der Straße fällt? Nun aber durften die kleinen Hände zuweilen selbst in die Zweige greifen und sich ihr bescheiden Theil Naschwerk vom Baume herabholen.
„Zu unserem Bedauern hatten wir in der letzten Zeit nicht die Freude, Ihr Fräulein Tochter zu sehen, Herr Oberstlieutenant,“ sagte der höfliche Eff, als die Herren gemeinsam das Haus verließen.
„Ich danke ergebenst. Ein einseitiger Kopfschmerz – hat Nichts zu bedeuten! A propos, verlautet denn Nichts über die Neubesetzung des Metzer Gouvernements?“ Immer noch das Steckenpferd!
Ein nervöser Kopfschmerz – nun ja, die Kleine hatte ihren Vater gebeten, sie bei den Belzig’s zu entschuldigen, sie wäre nicht im Stande, ein vernünftiges Wort zu reden. Der gute Papa merkte nicht, wie sie in der letzten Zeit mehrmals einen Vorwand suchte, um an einer Einladung bei den Belzig’s vorbeizuschlüpfen. Und der gute Eff hätte sich gewiß nicht träumen lassen, was ihn und die Anderen der Freude beraubte; es war jedenfalls ein aufrichtiges Bedauern, wie auch die Freude aufrichtig gewesen wäre.
Unter einem großen vergoldeten Stiefel, der neben einem Portal in der Derfflingerstraße wie eine Laterne leuchtete, empfahl sich der Pensionär.
„Gute Besserung wünschend, Herr Oberstlieutenant!“ rief Mühüller.
„Wünsche gleichfalls von Herzen!“ fügte Eff hinzu.
„Ze … ze … ze …“
War es die Verlegenheit der anstoßenden, oft über die gleichgültigsten Dinge stolpernden Zunge, die den alten Herrn die Hand des Generalstäblers länger als zu einem gewöhnlichen Abschiedsgruß in der seinen halten ließ? Und mit welch seltsam lauerndem Blinzeln die wasserhellen Aeuglein in Eff’s Antlitz forschten! Aber nichts weiter als das hilflose: „Ze … ze… ze …“ und der militärische Gruß der Hand an der Pelzmütze, die ihre Abstammung von dem ehemaligen Husaren nicht verleugnen konnte.
Die scharfe Januarkälte hieß die beiden Officiere ausschreiten. Nach einem kurzen Schweigen warf Mühüller aus der Vermummung des hochgezogenen Mantelkragens die Bemerkung hin: „Ich weiß nicht, Eff, ich würde zugreifen! Brrr! diese Kälte!“
„Wieso?“ fragte Eff zerstreut.
Mühüller zuckte mit den Schultern: er ist verliebt; er hat ein Recht, zerstreut zu sein; man muß ihn in Ruhe lassen!
Nach ein paar trippelnden Schritten begann er dennoch von Neuem:
„Na, ich weiß nicht – ich würde mir einfach diesen neuen Paletot anschaffen und ihn anziehen. Er wird Sie pompös kleiden; er wird Sie warm halten; das müssen selbst Sie einsehen, trotz Ihrem Generalstab! Ein verteufelt guter Name! Alle Wetter!“
Eff machte kurz Halt. Mühüller, der noch ein paar Schritte weiter gelaufen war, vollführte eine rasche Kehrtwendung: „Nun?“
„Ich weiß wirklich nicht, wie Sie das meinen, Mühüller! Ich dächte, es wäre genug darüber gescherzt worden!“
Es war nicht die geringste Heuchelei bei dieser fast strengen Abweisung.
„Mein heiligster Ernst!“ krähte Mühüller. „Kommen Sie, man friert an. – Sie sehen nicht, Sie hören nicht, Sie sind kein Praktikus! Sie sind zwar vom Generalstab (ein ganz winziger verzeihlicher Neid, der sich immer wieder Luft machte – ‚das Ponceauroth des Generalstabs reizt auch die frömmsten Thierchen,‘ meinte er gelegentlich). Nun, Sie brauchen sich weder zu empören noch erstaunt zu thun. Ich habe es von Perkisch. Es ist vor ein paar Tagen in aller Unverfrorenheit davon die Rede gewesen – ein einfaches Geschäft: der Alte ist durchaus nicht abgeneigt, seinen Namen neu aufzupfropfen – na, ich bitte Sie, es lohnt sich doch! Und Melitta’s Mama muß wohl ihre Gründe haben, daß sie sich so uneigennützig um anderer Leute Namen kümmert. Das heute Abend war nur der erste Vortrupp; Perkisch wird das Gros kommandiren. Sie werden ihn in ein paar Tagen mit einer Offerte antreten sehen. Er wird das Ding von einem Namen eben so in Entreprise nehmen, wie er die Heirath seines Grafen in Entreprise genommen hat …“
„Ah, aber Mühüller, ich bitte, sich zu menagiren! Sie wollten doch nicht behaupten …?“ fiel Eff entrüstet ein.
„Ich sehe, was ich sehe. Ich weiß, was ich weiß. Bin ich ein Schlauberger oder bin ich keiner? Wer ist der Graf? Und wer ist Perkisch? Und wie kamen sie zusammen?“
Ueber Eff’s erstaunte Miene hätte Mühüller fast laut aufgelacht, aber er bezwang sich.
„Na, à part das! Es geht uns ja nichts an! Wohl dem, der kopfhoch in Illusionen steckt – man soll ihn nicht gewaltsam herausreißen! Mancher liebt kalte Douchen, Mancher nicht. Ich weiß, was ich weiß!“ schmunzelte er in sich hinein. Und er ließ noch einmal in Gedanken alle Faktoren des hübschen Rechenexempels Revue passiren: den verschuldeten Grafen und seinen Goldhunger, Perkisch’s außerordentliche Bemühungen, ihn bei Belzig’s zu produciren, den Adelshunger dieser Damen, wenigstens der Mama – die Töchter mochten ja immerhin ein paar gute harmlose Kinder sein – es war wirklich reizend, wie nett das Alles zusammentraf!
Mühüller spitzte die Lippen und fing an, vor sich hin zu pfeifen.
„Ich verstehe Sie nicht!“ unterbrach ihn Eff ungeduldig.
„Na, denken Sie, was Sie wollen, lieber Eff! Am besten vielleicht, Sie denken gar nicht darüber nach. Wollte Ihnen nur
[240][241] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [242] Eins sagen – meine verdammte kameradschaftliche Pflicht: welch eine Primaprachtkarrière stände Ihnen bevor! Welch eine Kombination, ich bitte Sie: erstens Ihr Fleiß, Ihre unheimlichen Kenntnisse – der ganze famose Kerl; zweitens dieser verteufelt gute Name, falls Sie ihn acceptiren; ad drei eine reiche Frau; ad vier eine schöne dito –“
„Mühüller!“ Dieser halb bittende, halb verbittende Ruf ward von einer Unmuthsfalte begleitet, die zwischen Eff’s kräftigen Brauen zuckte.
„Schon gut, schon gut!“ besänftigte der Andere. „Ich weiß, Sie wünschen nicht, daß man an so Etwas tastet. Sie sind bereit zu schwören, daß Sie sich auch nicht des kleinsten Seitenblickes auf den Geldbeutel Ihres Schwiegervaters in spe bewußt sind. Sie sind ein seltener Mensch, und wenn man Sie ausstellen dürfte, könnte man eine brillante Einnahme haben: ein lebendiger Kavalier aus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, der es als ein Unglück betrachtet, einen reichen Schwiegervater zu bekommen – aber pscht! Vorsicht! Man darf nicht daran rühren! Man darf Ihnen die Sache nicht verleiden. Sie sind im Stande, kurz abzuschnappen; das wäre doch verdammt schade!“
Eff lachte. Man konnte dem kleinen Schwadronneur nicht böse sein. Das „klein“ natürlich nur in Bezug auf Eff’s eigene herkulische Gestalt.
„Ich finde, Sie turnen zu viel mit der Zunge, darunter leidet Ihre Gesammtausbildung. Ich dächte, wir redeten von was Anderem, wie?“
„Mir auch recht! Reden wir von Rußland! Apropos, da Sie vom Turnen anfangen: ich möchte noch eine kleine Uebung der Schluckmuskeln vorschlägen. Wie ist’s mit Sichem?“
„Thut mir leid; ich stecke bis über die Ohren in Arbeit! Zwei Berichte, die übermorgen fällig sind.“
Da nahte das dumpfe Rasseln eines Pferdebahnwagens. Mühüller empfahl sich mit seinem bekannten und gefürchteten Krafthändedruck, der manchen Weichlingen einen kurzen Ruf des Schmerzes zu entpressen pflegte, und mit jenem Grinsen der breiten Zähne, das immer wieder zu fragen schien: „Bin ich ein Schlauberger, oder bin ich keiner?“
„Ein Kavalier von ältestem Adel, der Letzte seines Stammes, wünscht einen Sohn aus guter Familie, möglichst selbständig und im Besitz eines angemessenen Vermögens, zu adoptiren. Gef. nicht anonym. Off. sub. v. Z. 1250 erb. in d. Exped. dies. Z.“
Das Zeitungsblatt raschelte in den Händen des Oberstlieutenants; er rückte den alten schlechtsitzenden Kneifer mit einer hastigen Bewegung empor.
Als wenn er es gewesen, der die Annonce in die Zeitung gesetzt! So hätte es heißen müssen, wenn er sich dazu hergegeben, seinen Namen öffentlich auszubieten. Und der merkwürdige Zufall der Annoncenchiffre – war sie nicht fast gleichlautend mit der Jahreszahl, in welcher die Wurzel des Stammbaumes dort an der Wand gründete? Ein verstorbener Bruder hatte der Anfertigung dieses Stammbaumes über zehn Jahre seines Lebens gewidmet. Mit einem Eifer, der zuletzt in eine Art Manie ausgeartet, hatte er den leisesten Verzweigungen der Namensspur bis in die Tiefe der Jahrhunderte hinein nachgegraben. Er hatte darüber Besitz und Hausstand vernachlässigt und die Reisen und Forschungen hatten einen guten Theil seines Vermögens aufgezehrt. Es stand sogar in der Familie fest, daß diese aufreibende Manie seinen Tod verursacht hatte. Nun hielt der Stammbaum, mit kostbarem Eichenschnitzwerk umrahmt und mit dem Wappen der Gamlingen gekrönt, in fast aufdringlicher Arroganz die eine Wand der niederen Stube besetzt: die Raumhöhe eines vierten Stockwerks ist eben nicht für den Luxus solcher Art von Bildwerken berechnet.
Es war wie eine stete Mahnung an ihn, den Letzten, die Zweige des Baumes, der sechs Jahrhunderte gegrünt, nicht elendiglich verdorren zu lassen. Mit dem Tode seiner Söhne hatte er oft genug an die Verpflichtung einer Adoption gedacht; doch war es nur bei dem Gedanken geblieben, bis vor ein paar Tagen Frau Belzig in ihrer resoluten Weise den Bann brach und einfach die Frage aufdeckte: „Aber, verehrtester Herr Oberstlieutenant, Sie haben keinen Sohn, Lieutenant Eff hat keinen Vater mehr; er ist ein ausgezeichneter Mensch; Sie können sich keinen besseren Adoptivsohn wünschen. Adoptiren Sie ihn doch!“
Er hatte etwas sagen wollen, aber es nur zu einem lebhaften Zwinkern der kleinen Augen gebracht.
Ja, ja, ja! der ist der Richtige! Eff ist tüchtig, sympathisch, ein seltener Charakter – er wird eine glänzende Karrière machen, d. h. ob er sie mit seinem Namen machen wird? Seinen Schultern darf man die kostbare Last dieses Namens schon anvertrauen! – Wie liebenswürdig von Frau Belzig, daß sie sofort die Sache in Angriff nahm und gleich heute Abend das Terrain rekognoscirte!
Würde Eff zugreifen? – Natürlich kam ihm der Antrag als eine Ueberraschung; in seiner diskreten Weise wich er zur Seite. Man müßte ihm jedenfalls Zeit gewähren!
Die Aeuglein des Alten stöberten unruhig in den Annoncen der Zeitungsseite weiter. Immer wieder, wie von einem Magnet angezogen, fuhren sie auf die Namensofferte zurück. Das nackte Elend lugte unter dem Prunk dieser Anzeige hervor. Man verlangt also Vermögen als solide Stütze für den Namen. Es werden sich die Söhne von Schlächtern und Bierbrauern melden; an Bewerbern wird kein Mangel sein. Ein Gefühl der Scham über diese Preisgabe beschlich ihn. Nun gottlob, bei der Adoption eines Eff ist doch der Verdacht eines schmutzigen Eigennutzes nicht zu befürchten. Eff ist arm; nur seine Tüchtigkeit und seinen Charakter setzt er für den Namen ein. Alle die Ahnen des Stammbaumes mögen ruhig ihre Jahrhunderte weiter schlummern; es ist nun Jemand da, der die Ehre des Geschlechtes weiter bewacht!
„Olga, mein Kind, da lies einmal,“ sagte der Freiherr plötzlich, indem er das Blatt über den Tisch hinüberreichte.
„Gleich, Pa’, daß die Farbe nicht eintrocknet!“ antwortete sie, ohne aufzublicken. Sie saß auf der anderen Seite des Tisches in der vollen Helle des Lampenlichtes, mit herabgebeugtem Köpfchen, dessen üppig aus dem Zwang der Frisur umherwuchernde Wildhaare wie Seide in dem grellgelben Scheine erglänzten. Ein Haufen lithographirter Blätter lag vor ihr, und die feinen Hände führten in flinker Behendigkeit den Pinsel – immer dieselbe maschinenhaft regelmäßige Bewegung: zwei Karminklexe, die aufgetuscht und dann mit dem Wasserende des Pinsels abgetönt wurden; es bedeutete die blutroth gesunden Bäckchen zweier Kinderfiguren.
„Papa, ich habe noch 300 Bäckchen zu malen; ich werde nicht vor elf Uhr fertig. Und ich muß mich noch sehr sputen,“ hatte sie dem Vater bei dessen Rückkunft gemeldet.
„Ich dachte, Du littest an Deinem Kopfschmerz, mein Kind? Du solltest Dich schonen!“
„Ach, dazu ist keine Zeit,“ wich sie aus, stark erröthend. Sie hatte wohl die Schnelligkeit im Erröthen den Karminklexen der Bäckchen abgelernt, die sie ihren Figuren anmalte. Der „Einseitige“ war ja am Nachmittag nur vorgeschützt worden; nun hatte sie die kleine Nothlüge vergessen. „Macht mir außerdem Spaß. Sieh, wie fix es geht, Papa!“ Und sie malte ihm ein halbes Dutzend Rothbäckchen vor.
„Du gutes, liebes Kind!“ Zärtlich hatte seine Hand über das rundliche Köpfchen gestrichen.
Aber in das Wohlgefallen, das er beim Anblicke des Köpfchens empfand, mischte sich ein Schatten von Sorge: was soll werden, wenn er selbst nicht mehr sein wird? Und wäre auch die Sehnsucht nach dieser Adoption nur der Sorge des Vaterherzens entsprungen, dem zarten süßen Geschöpf einen brüderliehen Schutz gegen kommende Unbill zu schenken!
„Nun, was ist, Pa? Gieb her!“ sagte Olga, den Pinsel endlich fortlegend, um nach der Zeitung zu greifen. „Darf ich Dir noch eine Tasse Thee einschenken?“
„Wenn Du die Güte haben willst.“
Eff würde ihr einen vortrefflichen Bruder abgeben … Während er die zierliche Figur neben sich betrachtete, deren Gesichtchen vom weißen Dampf des ausgegossenen Thees umwallt war, mußte er an die imponirende Erscheinung des Generalstäblers denken: welch ein Bild männlicher Kraft! Wohl dem auserwählten Weibe, dem das Los zu Theil wird, von solchen Händen durch das Leben getragen zu werden! Ein fast unmerklicher Seufzer entfuhr ihm – so pflegen Mütter zu seufzen, die ihre Töchter immer wieder aussichtslos vom Balle heimführen. Die [243] Tochter eines Pensionirten – wird sich für sie ein Bewerber finden, dem das Silber ihres Lachens und das Gold ihres Gemüthes den gestanzten und gedruckten Inhalt eines Arnheim ersetzen kann?
„Was meinst Du denn, Papa?“ Olga suchte immer noch auf der Zeitungsseite.
„Ganz oben, fettgedruckt – ‚Ein Kavalier‘ –“
„Ah, da ist’s!“ Olga’s Augen weiteten sich voll wachsender Verwunderung. Und nun, fast mit dem Ausdruck des Schreckens blitzte sie den Vater an. Es war doch nicht der Vater, der die Annonce eingesetzt?! Aber sofort verneinte sie sich solchen Verdacht und las, das Köpfchen schüttelnd, noch einmal. Hätte Papa Solches hinter ihrem Rücken ausführen können? Nein, so heruntergekommen waren die letzten Gamlingen doch noch nicht, daß sie ihren Namen gegen Geld in den Zeitungen ausboten!
„Was soll das, Papa?“ Sie blickte ihn verdutzt über das Zeitungsblatt an.
„Ze … ze … ze …“ Es war nicht so leicht, ihr in kurzen Worten Alles zu erklären. Das kam davon, daß er diesen Winkel seiner Gedanken vor ihr versteckt hatte!
„Setz’ Dich hierher, Kind!“
Sie rückte den Stuhl an seine Seite und ließ sich darauf nieder.
„Sieh, ich hätte mich längst nach einer Adoption umsehen sollen. Ich bin es unserem Namen schuldig.“ Es war der Seufzer, der ihm schon Anderen gegenüber entfahren. „Es ist Zeit, daß ich daran denke, ich werde alt, mein gutes Kind. Sehr traurig, wenn unser Name spurlos verschwände. Freilich nicht nobel von dem sogenannten Kavalier – man stellt seinen alten ehrwürdigen Namen nicht so ins Schaufenster. Aber wenn sich eine Gelegenheit bietet, so muß man doch zugreifen. Nicht Jedem möchte man den Namen anvertrauen. Ze … ze … ze … ich weiss Jemanden, bei dem er gut aufgehoben wäre. Er wird ihn schon in Ehren halten. Er wird Dir ein braver Bruder sein, aber ich möchte nicht, daß Du eine Einwendung gegen die Wahl hättest.“
„Du machst mich sehr neugierig, Pa’.“
„Ze … ze … ze … war neulich davon die Rede und auch heute. Halb Scherz, halb Ernst. Aber bin überzeugt, kostet nur ein Wort zur richtigen Zeit, und die Sache kann perfekt werden. Ich weiß, Du schätzest Lieutenant Eff sehr –“
„Ah!“
Ein kurzes Ah! der Ueberraschung. Eine Röthe übergoß ihr Gesichtchen, ein starkes Karmin, das wohl gemalt dort auf dem Papier als besonders gelungen erschienen wäre. „Doch nicht Herr Lieutenant Eff?“
„Hast Du etwas an ihm auszusetzen? Seine Tüchtigkeit, seine Ehrenhaftigkeit stehen über allem Zweifel – ein wahrhaft vornehmer Charakter – wüßte nicht, wer besser paßte.“
„Lieutenant Eff ist ein reizender Mensch! Er ist der liebenswürdigste Mensch, den ich mir denken kann!“ rief Olga mit einem übertriebenen Enthusiasmus. Wollte sie dadurch ihre seltsame Erregung verbergen?
„Er wird Dir ein vorzüglicher Bruder sein. Ich wüßte nicht … ze … ze … ze … unter wessen Schutz Du besser aufgehoben wärest.“
„Ein herrlicher Mensch!“ fiel sie nochmals ein. „Ich würde mich unendlich freuen, Pa’!“ sie sprang auf, ihre Arme umschlangen des Vaters Hals, und eine kurze Weile fühlte er den lebhaften Athem des Kindes an seiner Wange.
Was ist ihr denn? Ei, die Nachricht kommt ihr nur so neu und überraschend – sie freut sich wirklich!
„Ist er denn damit einverstanden? Weiß er denn davon?“ fragte sie dann in anscheinender Ruhe.
„Er wird es nicht ausschlagen mein Kind.“
Sie erinnerte sich plötzlich, daß sie in der Küche noch Wichtiges für morgen früh zu ordnen hatte – man kann sich auf diese Aufwärterinnen nie verlassen! Und sie schlüpfte hinaus. Gleich darauf hörte der Freiherr von der Küche her das klirrende Poltern von Geschirr und das feinknarrende Umhertrippeln von Olga’s Füßchen. Dann, während er sich selbst wieder in die Lektüre seiner Zeitung vertiefte, ward es draußen still. Wenn er die Küche betreten hätte, wäre er Zeuge von etwas Außergewöhnlichem geworden. Das liebe fröhliche Ding stand mit dem Köpfchen an die kalte Scheibe des Küchenfensters angelehnt und blickte gedankenschwer hinaus nach dem Stückchen Sternenhimmel, das über der schwarz und finster aufragenden Häuserfronte hereinleuchtete. Eine schwere Thräne löste sich langsam von ihrer Wimper und rollte über die Wange herab; sofort schüttelte Olga heftig den Kopf. Thorheit! liebte Er nicht Melitta? War das nicht ausgemacht? Und wenn dies nicht der Fall wäre, würde er denn jemals an ihr unbedeutendes Persönchen denken?
Sie hatte Eff zuerst im vorigen Winter auf dem alljährlich stattfindenden Ball des Pensionirten-Vereins kennen gelernt; sie hatte ihn dann oft genug im Belzig’schen Hause getroffen. Zuletzt siegte doch die Vernunft über den unbegreiflichen Trotz ihres Herzens, und sie hatte einen Vorwand gefunden, einzelnen Einladungen dorthin auszuweichen. Sie wollte der Thorheit Herr werden. Keines Menschen Auge sollte hinfort Zeuge sein, welch seltsame Flamme ein Jahr hindurch in ihrer Brust geglimmt. Eff und Melitta würden ein Paar werden, und man würde auf der Hochzeit recht lustig tanzen und lachen, man würde die Miniaturböller der Knallbonbons losschießen und die Glocken der Gläser erklingen lassen. Und so, unter all der Ausgelassenheit würde diese Backfischliebe zu Grabe getragen werden.
Und nun hatte Papa den „Herrlichen“ zu ihrem Bruder erkoren! Soll sie sich dagegen auflehnen? Eine neue Thorheit, und sie gäbe damit zu, was sie sich wegzuleugnen so eifrig bemüht war. Nein, nein, nein! So sei er als Bruder willkommen!
Bald darauf saß sie wieder an der Arbeit. Ihre Augen strahlten klar wie vordem, und fast schien es ein Muthwille, wie flink der Pinsel in ihren Fingern Bäckchen auf Bäckchen tupfte und abtönte.
„Gute Nacht, mein Liebling! Strenge Dich nicht zu sehr an. Bleib’ nicht zu lang’ auf,“ sagte der besorgte Vater, als er sich zur Ruhe begeben wollte.
„Nur noch hundertfünfzig Bäckchen, Papa. Es macht mir besondere Freude heut. Es giebt nichts Besseres als Arbeit. Die armen reichen Leute, die solche Wohlthat nicht kennen! Meinst Du nicht auch, Papa?“
Und dann, beim eintönigen Schlag des Regulators, während da draußen die vielartigen Geräusche der großen Stadt nach und nach verstummten, saß die kleine Heldin und malte Bäckchen; sie wollten ihr immer hübscher gerathen, und es war schade, daß das fünfte Hundert so bald vollendet war.
Orientalische Sprüche.
Die Wohlthaten der Eltern sind so unbegrenzt wie die Ausdehnung des Himmels. Mongolisch.
Ein verzogener Sohn nimmt nicht Lehre noch Erziehung an, und der beschattete Palmbaum giebt keine Frucht. Afghanisch.
Die Tage sind Blätter im Buche des Lebens. Darum schreibt nichts hinein, als gute Thaten und reines Streben! Persisch.
Durch Anstrengung gelingen die Werke, nicht durch Wünsche; es läuft das Wild nicht in den Rachen des schlafenden Löwen. Indisch.
Leichter ist es, mit einer Nadel ein Gebirge aus seiner Wurzel zu reißen, als die Sünde der Selbstsucht aus dem Herzen. Persisch.
Der Mensch sieht das Unheil nicht, er sieht nur den Gewinn; der Fisch sieht die Angel nicht, er sieht nur den Köder. Mantschu.
Ihr, die Ihr jung seid, verlacht nicht den weißhaarigen Greis; die Blume, die sich entfaltet, wie viele Tage wird sie roth bleiben? Mantschu.
Am besten erkennt man den Charakter eines Menschen bei Geldangelegenbeiten, beim Trinken und im Zorn. Hebräisch (Talmud).
Wenn ein Vogel dem Tode nahe ist, so wird sein Gesang klagend; ist ein Mensch dem Tode nahe, so sind seine Worte ernst und heilsam. Chinesisch (Konfucius).
Deutsche Städtebilder.
Für eine Großstadt ist, wie man weiß, die Lage Stuttgarts und seine nächste Umgebung so ungeeignet, wie sich nur denken läßt. Eine Großstadt will Raum zur Entwicklung, Zugänglichkeit von allen Seiten, wo möglich auch einen großen Strom. Stuttgart aber liegt recht eigentlich im Kessel, ist rings von ansehnlichen Bergen umschlossen, und der Nesenbach, durch dessen Thalrinne die Stadt mit der Welt draußen in Verkehr tritt, ist kein Rhein und kein Main. Die Sache erscheint um so wunderbarer, weil kaum eine Stunde abwärts, wo der Nesenbach in den Neckar fällt, die schönste Gelegenheit zu bequemer Ausbreitung geboten war. In der That hat auch schon vor 200 Jahren kein Geringerer als Leibniz in einer seiner Flugschriften (Amsterdam 1682) den Herzog und seine Räthe darauf hingewiesen, wie günstig für die Entwicklung des Handels und der Wohlfahrt des ganzen Landes es werden müßte, wenn die Universität von Tübingen und der Hof von Stuttgart nach Cannstatt verlegt und damit dem Lande sein natürlicher Mittelpunkt gegeben würde, und noch der verstorbene König Wilhelm soll sich, wie man von bejahrten Herren erzählen hört, im Anfang seiner Regierung mit dem Gedanken beschäftigt haben. Inzwischen ist aber Stuttgart der Theorie zum Trotz in seinem Kessel thatsächlich zur Großstadt geworden, und es hat nicht an Geschichtsphilosophen gefehlt, die es ganz bezeichnend für die Hauptstadt des schwäbischen Stammes gefunden haben, daß sie sich, seitab vom Strom der Welt, in sich selbst zu vergnügen und ihre mehr oder minder berechtigten Eigenthümlichkeiten ungestört auszubilden befähigt sei. – Wie dem auch sein mag, jedenfalls ist, was Handel und Verkehr als lästige Schranke empfinden, für ein Auge, das an schönen Landschafts- und Städtebildern seine Freude hat, eine Quelle unendlichen Genusses. Stuttgart hat von jeher in seiner Art als ein Juwel unter den deutschen Städten gegolten. Es dankte das seiner Lage im weichen Schoß der schöngeformten Berge, die es in mannigfach gegliedertem Kranze umziehen, und so lange die mäßig große Stadt noch ganz im Grün der Gärten und Baumkronen eingebettet lag, bedurfte es kaum der Menschenhand, um dem Bilde nachzuhelfen. Als aber das überwältigende Wachsthum der Häusermasse mehr und mehr den Thalgrund nach allen Richtungen ausfüllte, mußte sich die Stadt auch der besondern Verpflichtungen bewußt werden, welche die Gunst dieser Lage ihr auferlegt, und seit einem Jahrzehnt etwa wetteifert das Talent erfindungsreicher Architekten und bewährter Gartenkünstler, um nicht nur das Stadtbild selbst, sondern auch die herrliche Umgebung immer reicher und eigenartiger zu gestalten.
Glänzende Straßenlinien schlingen sich an den weicheren Abhängen der Berge hin, breiten sich, von rückwärts emporgestiegen, überraschend auf den vorgelagerten steilen Hügeln aus; zahllose Landhäuser tauchen in den traulichen Schluchten und Bergfalten aus den Baumwipfeln der Gärten auf, setzen sich keck auf jeder Kuppe, jeder vorspringenden Ecke, über dem schroffen Abfall der Steinbrüche fest; in mächtigen Windungen, durch Tunnel und über Viadukte weg, steigt an der einen Langseite des Bergzugs die Eisenbahn, die nach der Schweiz, dem Gotthard führt, zu imposanter Höhe hinan, während gegenüber auf der andern Seite des Thales die Zahnradbahn kurzer Hand den steilen Berg emporklimmt. Da, wo die beiden Bahnen den höchsten Punkt erreichen, steht hier wie dort am Saume prächtiger Wälder, welche die Hochfläche bedecken, ein steinerner Aussichtsthurm, beide mit weiter Schau ins Land hinaus.
Es ist in der That ein unvergleichlicher Blick, den man von diesen Höhen genießt, auf das Häusermeer tief unten im Thalgrund mit all den Thürmen und Kuppeln und Palästen, auf die saftig grünen Rebengehänge, die rings die weichgeschwungenen Bergeshalden umkleiden, auf die dunkeln Laubmassen des langgestreckten Schloßgartens, der den Blick zu der sonnigen Breite des Neckarthales hinausgeleitet, auf die reichgesegneten Fluren des Unterlands mit all den milden Thälern und Höhenzügen.
Dort grüßt der Rothenberg mit seiner Kapelle herüber, wo die Stammburg der Württemberger stand, dort Ludwigsburg und Marbach mit ihren Schiller-Erinnerungen, dahinter der Hohenasperg [245] Schubart’schen Angedenkens, und weiterhin das bestimmte Profil des Wunnensteins, wo einst der „gleißend Wolf“ gehaust; rechts aber, von der blauen Kette der schwäbischen Alb herüber, zwischen Hohenzollern und Achalm, glänzt die Perle des schwäbischen Landes, der poesieverklärte Lichtenstein.
Das Besondere Stuttgarts ist eben die schwesterliche Beziehung der Stadt zur Natur, zum frischen Schmuck ihrer Berge, an die sie sich so traulich anschmiegt. Stuttgart ist darum auch das eigentliche Dorado für den Freund friedlicher Naturspaziergänge: wo immer er die Stadt verlassen mag, steht ihm eine Fülle von genußreichen Pfaden offen, und wie lange er auch Tag um Tag in der Umgegend herumgewandert sei, immer noch hat er die Freude, einen hübschen Berg, eine malerische Partie, einen entzückenden Ausblick zu entdecken.
Auch der Stift unseres Zeichners, den wir nun auf seinen Wanderungen zu begleiten uns anschicken, ist durch manchen schönen Punkt in der Umgebung der schwäbischen Hauptstadt gefesselt und zu liebenswürdig gewandter Wiedergabe aufgefordert worden.
Von der Höhe des Schützenhauses, von wo er das wohlgetroffene Gesammtbild der Stadt vor uns ausbreitet (vergl. S. 240 und 241), steigen wir zunächst mit ihm zum Schloßgarten hinab, zu dem reizvollen obern See, wo zwischen den uralten Baumriesen der Kastanien, die ihn in weitem Rund umgeben, die eine Front des königlichen Schlosses den Hintergrund abschließt, wo die Schaumwolken der großen Fontaine auf die bewegte Fläche mit den schaukelnden Schwänen und Enten niederstäuben, wo die herrliche Nymphengruppe, eines der edelsten Werke Dannecker’s, und erlesene Marmorkopien antiker Statuen im See sich spiegeln. Wir folgen ihm weiter durch das grandiose Laubgewölbe der Platanenallee zu dem Kolossaldenkmal, das vor wenigen Jahren König Karl der treuen Anhänglichkeit des württembergischen Volkes an das angestammte Fürstenhaus aufgerichtet hat: Graf Eberhard nach Kerner’s bekanntem Gedicht im Schoß eines Hirten ruhend.
Die langen Baumgänge des Schloßgartens führen uns von selbst über das Lustschloß Rosenstein (vergl. S. 246) zur Wilhelma (S. 240 u. 241) bei Cannstatt, jener ganz eigenartigen Schöpfung des verstorbenen Königs, welche die maurische Wunderpracht der Alhambra in großartig reichen Bauwerken und die zauberhafte Ueppigkeit der südlichen Pflanzenwelt in einer unendlichen Flucht von herrlichen Gewächshäusern und weitgedehnten Gärten wiedergiebt.
Ein kurzer Gang über die Neckarbrücke und durch die freundliche Bäderstadt Cannstatt führt uns zu den Anlagen am Sulzerrain über dem Kursaal. Da mögen wir uns gerne unter dem köstlich kühlen Schattendach zur Seite der plätschernden Fontaine niederlassen und zwischen den Bäumen und Sträuchern durch auf Cannstatt und Stuttgart und die wunderbar reiche und weiche Fülle dieser gesegneten Gegend hinausblicken. Oder, noch besser, wir suchen das stille Plätzchen am obern Rande der Anlagen auf, das ein schlichter Stein neben der von wilden Rosen umwachsenen Ruhebank als „Freiligrathsblick“ bezeichnet. Dort ruhte er am liebsten, der edle Dichter, der nach manchem Sturm den milden Lebensabend hier in Cannstatt verbracht hat, und erfreute sich an dem Blick auf das grüne Neckarthal mit seinen Pappeln und Erlen, auf das freundliche Untertürkheim und die Grabkapelle des Rothenbergs (vergl. S. 247) und die ferne Kette der Alb. Dort mag auch das schöne Lied zu Hölderlin’s hundertjährigem Geburtstag entstanden sein, in dem er so stimmungsvoll die stillen Reize dieses „wonnigen Landes“ und „seines Flusses blaue Wogen“ preist. Dort sehen wir auch ganz nahe unter uns den traulich schlichten Thurm des uralten „Uffkirchleins“ über die Kirchhofmauer sich erheben, an dessen Seite Freiligrath seit zehn Jahren im Grabe ruht, das sein mächtiges Haupt, von Donndorf’s Meisterhand geformt, in schimmerndem Erz bezeichnet.
Der Weg zur Stadt zurück führt uns an der königlichen Villa bei Berg vorüber (vergl. Vignette S. 247). Vor nun schon vierzig Jahren von Leins erdacht und ausgeführt, ist dieser Prachtbau eines der frühesten und maßvoll edelsten Muster der wiedererstandenen italienischen Renaissance in Deutschland und darum von dauerndem Werth für unsere Kunstgeschichte, besonders ansprechend durch die Mannigfaltigkeit der feinsten geistigen Durchbildung und durch einen unaussprechlichen Hauch von ewiger Jugend. Dazu die entzückende Lage auf beherrschender Höhe über dem Stuttgarter und Cannstatter Thal und die herrliche Pracht der musterhaft gehaltenen Gärten, welche den ganzen Hügel und seine Abhänge bedecken, fürwahr ein Kleinod höchster Art unter den deutschen Fürstensitzen!
Wollen wir nun dem Künstler nach der entgegengesetzten Richtung folgen, so thun wir am besten, vom Hauptbahnhof mitten in der Stadt zum Hasenbergbahnhof zu fahren. Das ist wohl eine lange Fahrt in weitausgezogenem Bogen, aber vom mannigfaltigsten Genuß durch den Ausblick auf das Stadtbild unter uns und die Höhen gegenüber und die farbenreiche Landschaft in der Ferne, mit jeder Minute wechselnd und immer neue Gruppirungen vor das Auge stellend.
[246]Auf der Hasenbergstation nimmt uns sofort der Buchenwald in seine kühlen Schatten und geleitet uns auf anmuthigen Pfaden rasch zu dem runden Aussichtsthurm (vergl. S. 240 und S. 241), wo wir wieder mit unserem Künstler zusammentreffen. Haben wir dann vom hohen Thurm des Blicks genossen „hernieder auf ein schönes Land“, so wenden wir uns dem Denkmal des Dichters zu, der den Reiz dieser Gegend so voll empfunden, so hinreißend geschildert hat. Nur fünfzig Schritte abwärts in den Gartenanlagen an wunderschöner Stelle erhebt sich über dem Halbrund einer edelgeformten Exedra die Marmorbüste Wilhelm Hauff’s, während die Ruhebank unter ihr zu beschaulicher Betrachtung einlädt. Es war ein sinniger Gedanke, hier in freier, lichter Höhe, wo der Blick zur Alb mit dem Lichtenstein schweift, dem liebenswürdigsten der schwäbischen Dichter sein Denkmal zu setzen, der, in Stuttgart geboren und, noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt, in Stuttgart gestorben, am frühesten von allen, denen die Muse den Scheitel berührt, von der Welt hat scheiden müssen, die so sonnenhell vor seinem Auge lag. Seine Märchen sind das Labsal der Kinder, sein „Lichtenstein“ das Entzücken der ersten, romantisch empfindenden Jugend, und es hat etwas Rührendes, wenn so eine jugendliche Schar die Feldsträuße, die sie droben im Walde gepflückt, heimkehrend an seiner Büste niederlegt.
Doch der Künstler mahnt zum Weitergehen. Immer auf der Hochfläche fort, und immer im Waldesschatten, gelangen wir nach einer Stunde oder mehr zu seinem fernsten Punkte, dem alten Lustschloß Solitude (vergl. Vignette S. 247). Erstaunt bemerken wir, aus dem Wald an den steilen Abhang tretend, wie hoch wir stehen und welch unermeßliche Fernsicht vor unseren Augen liegt. Noch verwunderter aber betrachten wir das Schloß, das auf dieser einsamen Waldeshöhe in das Land hinausblickt. Da sind wir nun auf einmal in der Welt des Rokoko. Nichts Zierlicheres, Kapriciöseres als dieser elegante Bau mit den breiten, seltsam gewundenen Freitreppen, mit der mächtigen, ringsum laufenden Balustrade, mit den geschweiften Mauern und Wänden, und nun vollends innen die flottgemalten Decken und die verschwenderische Fülle der Spiegel, und die Amoretten und Putten und vergoldeten Schnörkel und all der tändelnde, glitzernde, frivole Zierrath der Kunst von damals – die echte Schöpfung des geistreichsten unter den kleinen Tyrannen jener Tage, des Herzogs Karl Eugen. Fürwahr, wenn man durch diese Prunksäle wandelt, versteht man mit einem Male den Geist der Zeit, in welche Schiller’s Jugendjahre fallen. Und er selbst! – Die Solitude ist ja voll von Schiller-Erinnerungen: hier ist der Dreizehnjährige scheu und schüchtern vor den Gewaltigen getreten, der nun sein Schicksal in die Hand nimmt; hier hat er dritthalb Jahre, so lange die Schule auf der Solitude blieb, unter dem Druck einer geistlosen Disciplin gelitten, während schon der Morgenglanz der Ideale vor seiner trunkenen Seele stand; hier hat dann sein Vater als Verwalter der herzoglichen Gärten tüchtig und würdig geschaltet, und wie manchmal ist der Herr Regimentsmedikus, die „Räuber“ in der Tasche, von Stuttgart heraufgeritten gekommen, als schon der Ruhm mit verlockendem Schimmer seine Stirn streifte! Und wie er mit Streicher in jener Nacht entfloh, da hier oben dem Großfürsten Paul ein Prunkfest gegeben ward, und auf der Straße nach Ludwigsburg die Solitude tageshell erleuchtet sah, da kam, wie uns der treue Streicher erzählt, das ganze Gefühl seines Schicksals über ihn, und mit dem Ruf: „Meine Mutter!“ sank er auf seinen Sitz zurück.
Wenden wir uns nun von diesen Streifzügen in die Umgegend zu der Stadt selbst zurück und durchwandern wir ihre Straßen! Stuttgart fehlt das bestimmt ausgesprochene geschichtliche Gepräge, das den Stolz der alten Reichsstädte bildet. Wohl ist die Vergangenheit in verschiedenen Epochen durch eine Reihe von Bauten nicht unwürdig vertreten; aber der Gesammteindruck der älteren Theile bis über die Hälfte unseres Jahrhunderts hinaus zeugte weder von verbreitetem Wohlstand, noch von besonderer Freude an schöner Gestaltung der Wohnräume. An die alterthümlich hohen Häuser mit den übergebauten Stockwerken in den engen Gassen der Altstadt und an die immerhin behäbigeren, aber doch noch recht schlichten und anspruchslosen Gebäude der sogenannten oberen Stadt, die schon von Graf Eberhard am Ende des 15. Jahrhunderts in regelmäßigen Quadraten angelegt wurde, schlossen sich vom Beginn des jetzigen Jahrhunderts an lange, einförmige Straßenlinien mit den nüchternsten Fachwerkbauten, ganz nur für zinstragende Ausnützung bestimmt. Das ist nun in neuerer Zeit völlig anders geworden.
Die Ansprüche an Bequemlichkeit des Wohnens, an gefälligen Schmuck des Hauses im Aeußern wie im Innern sind im Laufe eines Jahrzehnts in ungeahntem Grade gestiegen, haben immer weitere Schichten der Bevölkerung ergriffen und dadurch einen stets sich steigernden Wettkampf in Befriedigung der veredelten Bedürfnisse hervorgerufen, der für die Physiognomie der Stadt vom größten Einfluß werden mußte. Dabei hat sich die gewaltige Bewegung auf diesem Gebiete durchweg in erfreulichen Bahnen gehalten und eben sowohl in Erfindung und Verwendung der künstlerischen Formen und Stilgattungen wie in der Sorgfalt und Tüchtigkeit der technischen Ausführung den gesteigerten Ansprüchen genügt. Die Grundlage für eine gesunde Entwickelung bot die neue Bau-Ordnung, die den Massivbau zur Vorschrift machte; die Muster und Vorbilder aber und die festen Zielpunkte gaben die beiden Altmeister Egle und Leins, neben und unter denen ein ganzer Generalstab von trefflichen Meistern erstanden und durch die Fülle und Mannigfaltigkeit der Aufgaben zu immer höherem Streben angeregt worden ist.
Der Natur der Sache nach sind es auch hier zunächst die Außentheile der Stadt, denen die neue Bau-Entwickelung zu Gute kam. Zumal in jenen Straßen, die an den Höhen emporsteigen, sind auf weite Strecken Bauten zu sehen, welche durch Feinheit der Erfindung und Reiz der Façaden dem musternden Auge Genuß gewähren, und die Hunderte von Landhäusern, die an den Abhängen oder in Bergfalten zerstreut liegen, boten ja von selbst der Phantasie und dem Raumgefühl des erfindenden Künstlers den mannigfaltigsten Anreiz.
Aber auch das Innere der Stadt hat sich in seinen Haupttheilen wesentlich gehoben, in seinem Gesammteindruck völlig verändert. Staat und Gemeinde, Vereine und Institute haben eine stattliche Zahl von glänzenden Monumentalbauten aufgerichtet; vier neue große Kirchen sind erstanden, die zugleich mit ihren Kuppeln und Thürmen die Silhouette der Stadt aufs Günstigste beleben; Lücken in den älteren Straßen sind ausgefüllt, unscheinbare Häuser durch prachtvolle Neubauten ersetzt worden. Das Merkwürdigste aber ist der unaufhaltsame Drang, der dem Alten selbst in die Glieder gefahren ist, durch bunte Bemalung der Façaden, durch farbige Hervorhebung der Bauglieder, durch geschickt aufgesetzte Zieraten, kurz durch Mittel aller Art sich ein [247] stilgerechtes Ansehen zu geben. Das ist ja nun wohl überall so, wo in einer Stadt frisches Leben pulsirt. Aber von der schwäbischen Hauptstadt ist es doch besonders bemerkenswerth, weil in ihr so gar lange die Kunst auf die akademischen Kreise eingeschränkt und sorgsam vor der Berührung mit dem Leben auf der Straße verwahrt worden ist, und nun treibt und sproßt und blüht das Kunstgewerbe an allen Ecken und Enden und überwuchert lustig mit seinen Ranken die puritanische Nüchternheit von ehedem.
Auch der älteste Platz der Stadt, der Marktplatz (vergl. Vignette S. 244), hat nach Kräften sein alterthümliches Gewand stilgemäß aufgefrischt. Zwar das Rathhaus selbst will nicht viel bedeuten, nachdem ihm die Prosa der Zeit vor fünfzig Jahren die zierliche Renaissance-Ornamentik vom Haupte gerissen hat. Es ist längst zu klein und soll in Kurzem einem Neubau weichen. Aber der „Gasthof zum Adler“ z. B., wo der alte Schubart einst nach den bösen Aspergszeiten allabendlich im lustigen Kreis die Funken seines Witzes sprühen ließ, und die ganze gegen die Stiftskirche gelegene Seite mit den hohen Giebeldächern, den traulichen Erkerbauten, den steinernen Heiligen unter zierlichen Baldachinen erinnert noch trefflich an die alten Zeiten, da der Marktplatz der Mittelpunkt eines kräftigen Bürgerthums war, an die guten Tage vor dem „großen Krieg“, da die Herren vom Gericht und von der „Ehrbarkeit“ nach des Tages Last und Hitze in der „Bürgerstube“ beim Becher zusammensaßen, stattliche Gestalten in kurzem Haar und spitzem Bart, vom gefältelten Scheibenkragen ansehnlich umrahmt.
Ganz von alterthümlichen Bauten umschlossen ist auch der nahe Schiller-Platz, zur Seite des schönen Chors der Stiftskirche. Da steht, dem lärmenden Gewühl des Tages entrückt, das älteste aller Schiller-Standbilder, von Thorwaldsen’s Hand, den tiefsinnigen Denker mit mild gesenktem Haupte in ergreifender Hoheit darstellend. Der mäßig große Platz mit seiner würdigen Umgebung stimmt zu dem weihevollen Eindruck des Bildes, und am vollsten wird man seinen Adel empfinden, wenn in stiller Nacht das Mondlicht den schönen Raum erfüllt. Da stehen dann auch die gewaltigen Mauermassen und die riesigen Eckthürme des Alten Schlosses (vergl. S. 240 u. 241) gegenüber doppelt ernst und groß vor dem Auge da. Es ist ein mächtig wuchtiger Bau, der sich so trotzig und unnahbar über die Wipfel der alten Kastanien erhebt; aber wie traulich und würdig heiter sieht sich das Innere (vergl. S. 244) an, wenn wir durch eines der hohen Thorgewölbe in den stillen Hofraum treten, in dem das Reiterstandbild Eberhard’s im Barte steht! In drei Stockwerken über einander ziehen sich die Arkaden hin, starke Säulen mit eigenartiger Ornamentik und durchbrochenem Steingeländer dazwischen, eine seltsame Mischung von schwerwuchtiger Kraft und zierlicher Eleganz. Es ist hier Alles so ganz im Geiste der Zeit, daß wir den hallenden Tritt der Trabanten zu hören glauben, wie sie im spanischen Mantel, den Federhut auf dem Kopfe, die Hellebarde im Arm, zwischen den Säulen auf- und niederschreiten, wenn wir uns nicht gar aus dem Gruftgewölbe der Stiftskirche herüber die weiße Frau geisterhaft durch die Gänge und Wendeltreppen huschend denken.
Sollen wir nun dem Leser, der uns bisher freundlich gefolgt ist, auch noch ein Bild von dem neuen Stuttgart geben, so führen wir ihn natürlich zunächst nach jener Straße, die dem Stuttgarter ans Herz gewachsen ist, zu der großen Hauptader des Verkehrs, wo sich Alles zusammendrängt, was den Charakter der Stadt und der Bevölkerung bezeichnet, wo Mittags, von Hunderten begleitet, mit klingendem Spiel die Parade durchzieht, wo sich vor Tisch und am Abend die Stuttgarter Welt ergeht und alle Zeit das Volk sich bewegt, das „mit Spazieren den Tag lebt“: zur geliebten Königsstraße; wir führen ihn zu den hohen und edlen Hallen des Königsbaus mit den schlanken griechischen Säulen und den glänzenden Läden und Magazinen; wir führen ihn vor Allem zum Schloßplatz (vergl. S. 240 und 241) mit der zum Andenken an die fünfundzwanzigjährige Regierung des Königs Wilhelm 1841 errichteten Jubiläumssäule, den sprudelnden Fontänen links und rechts, den wundervoll gehaltenen Rasenflächen und dem ausgesuchten gärtnerischen Schmuck an Blumen und Teppichbeeten und dunklen Lorbeerbäumen und ernsten Koniferen und wehenden Palmen. Dort wölbt sich über den mächtigen Kastanienkuppen die monumentale Kraft des alten, die heitere Pracht des neuen Schlosses, Theater und Königsbau dazu, und obendrein die grünen Rebenberge im Sonnenglanz, und das Alles um die Mittagsstunde, wenn die Klänge der Militärmusik ertönen, von einer heiter plaudernden Menge erfüllt: es ist ein Bild, das man gern in der Erinnerung festhält. Zu guter Letzt aber geleiten wir den fremden Gast zu dem erlesensten und am feinsten vollendeten Kleinod des heutigen Stuttgart, zu dem Stadtgarten, der, von den Prachtbauten des Polytechnikums, der Baugewerbeschule, der neuen Gewerbehalle umfaßt, alles Schönste in sich vereinigt, was liebende Sorgfalt und geistvolles Verständniß der großartigen und wunderlieblichen Pflanzenwelt abzugewinnen vermag, um es, wirksam gruppirt, zu einer entzückenden Augenweide für empfängliche Herzen zu machen. Ist doch Stuttgart, dank der Anregung seiner Lage und der trauten Beziehung zu der Natur, zur Garten- und Gärtnerstadt im vollsten Sinne des Wortes geworden. Da findet sich denn im Schatten der hundertjährigen Kastanien wohl ein lauschiges Plätzchen, wo wir, von herrlich üppiger Vegetation umgeben und halb den Akkorden des abendlichen Gartenkoncertes lauschend, von der Wanderung ausruhen und in freundlichem Rückblick uns der Bilder erfreuen mögen, die uns Stuttgart und seine Umgebung vor das Auge geführt haben.
Herzenskrisen.
In Hohenberg kam Lucie am andern Morgen an. Ein leichter Herbstnebel hing über der weiten Landschaft, undeutlich schimmerten die Thürme und Häuser der Stadt daraus hervor. Sie hatte kein Herzklopfen, als der Zug in den kleinen Bahnhof einfuhr, wie damals, als sie ihrem Glücke entgegen zu eilen vermeinte, auch nicht das peinliche Gefühl, wie bei der zweiten Ankunft, sie stand ruhig und müde am Fenster des Koupés und reichte Peter, der sie mit freundlichem Gesichte empfing, ernst nickend ihr kleines Reisegepäck zu. Die Woltersdorfer hatten wohl telegraphirt, daß sie ankomme. Die dicken Schimmel mit dem Landauer hielten vor dem Bahnhofe, sie stieg ein und fuhr durch die morgenstillen Gassen.
Frau Steuerräthin klopfte eben ein Wischtuch am offenen Fenster aus und sah verwundert ein wohlbekanntes blasses Gesichtchen in dem Wagen. „Da haben wir’s ja,“ murmelte sie vor sich hin, „und nun kommt das wieder hierher!“ Verdrießlich trat sie zurück und erschlug einen Brummer an der Gardine mit dem Tuch. „Unnützes Zeugs! Was sie hier nur will? – Die Frau Hortense wird wohl schon dahinter gekommen sein, was für eine Last sie sich und ihrer Familie aufgepackt hat mit solcher Freundschaft.“
In der Thür des Meerfeldt’schen Hauses stand Mademoiselle mit ausgebreiteten Armen.
„O quel bonheur, Lucie!“ rief sie, „Gott segne es Ihnen! Es war absolument nicht mehr zu ertragen hier!“
Sie drückte die schlanke Gestalt an sich und liebkosend zog sie das Mädchen in ihr Zimmer. Sie ließ sie kaum zu Worte kommen, die ganze Leidensgeschichte des Barons, der unerhörte Schreck, als man ihn bewußtlos gefunden, seine Wuthanfälle, wenn er sich nicht verständlich machen konnte: Alles floß in unaufhaltsamem Redestrom in Luciens Ohr, während sie ohne Appetit vor dem heißen Kaffee saß und ihre schmerzenden Schläfen mit dem Tuche hielt.
„Die Nachtfahrt, ma petite! Ja freilich, das macht Kopfweh. Wie geht’s Hortense?“ 0, ich kann mir denken, wie verzweifelt sie über Ihren Weggang –. Zürnen Sie nur nicht, ich kam auf die Idee, Sie zu bitten, unsere barmherzige Schwester, unser Engel des Trostes zu werden. Sie haben so eine eigene Art, so leicht, so zart, und ich bin so ungeschickt, ich kann mich nicht drehen und wenden, nicht bücken. Kommen Sie, der Baron wartet mit Ungeduld.“
Lucie ging hinüber zu dem alten Herrn. Er lag in einem fahrbaren Krankenstuhl.
„Lucie, mein Kind,“ lallte er, „wollen Sie bei mir bleiben? Alter Krüppel geworden –. Danke Ihnen, Lucie,“ er zog ritterlich die kleine Hand an seine Lippen; „dankbar,“ stammelte er, „dankbar übers Grab hinaus.“
Sie setzte sich zu ihm und erzählte von Hortense, daß sie glücklich sei, von ihrer schönen Heimath, von ihrem Gatten, der sie auf Händen trage.
„Ehrenmann! Prächtiger Mann!“ sagte der alte Herr, und ein freudiger Strahl brach aus seinen Augen.
Als Doktor Adler, wie gewöhnlich seinen Krankenbesuch bei dem Baron machend, in das Zimmer trat, verschwand eben eine schlanke schwarze Gestalt hinter den Vorhängen der gegenüberliegenden Thür. Er blickte ihr befremdet nach.
„Doktor! Giebt noch Engel in der Welt, Kleine gekommen, mich zu pflegen. Bin so dankbar! Armes Kind! Schlechtes Vergnügen, einen Halbtodten zu versorgen!“
Adler’s Miene blieb finster. „Wie geht es Ihnen?“ fragte er dann, sich setzend und in gewohnter Weise seine Untersuchung des Kranken beginnend.
In ihrem alten Zimmer oben stand Lucie und blickte sich
um; Alles unverändert. Dort lag der stille Garten vor den
Fenstern, in den gelbseidenen Gardinen des Himmelbettes fand sie
jeden Bruch, jede Falte wieder. Auf der Kommode aber prangte
ein Strauß von Georginen und Astern und ein paar späten Rosen,
die sich dazwischen sehr gedrückt zu fühlen schienen. Den hatte
wahrscheinlich Mademoiselle hingestellt.
Eine furchtbare Müdigkeit überkam sie nach den zwei durchwachten Nächten, sie legte sich auf das Bett und schlief einen bleiernen Schlaf, der nicht erquickt, wie er nach großer Abspannung einzutreten pflegt. Erschöpft wachte sie auf, trocknete die feuchten Perlen von ihrer Stirn und begann ihr Tagewerk.
Bald lebte sie sich ein in die neuen Pflichten; es waren ihrer nicht viele, aber unendliche Geduld beanspruchten sie bei dem Kranken, dessen Sprache sie allein recht verstand. Und nun folgten sich die Tage in öder Einförmigkeit, die Stunden jedes einzelnen glichen sich genau in ihrer Wiederholung; wie eine aufgezogene Uhr spann sich das Leben ab. Es ist schlimm, wenn ein junges Herz den Schlaf herbeisehnt, um den Tag zu vergessen, der ihm nichts weiter bringt als Arbeit und Gram, schlimm, wenn es Morgens das Erwachen wie einen Schmerz empfindet und mit umflorten Augen in den goldigsten Sonnenglanz schaut, als wäre es ein grauer Regenhimmel. „Schon wieder ein Tag? Wäre er vorüber! Was soll ich noch auf der Welt, wozu lebe ich?“
Und Lucie stand vor dem Spiegel und wand ihr blondes Haar zu einem Knoten wie jeden Morgen, und wie jeden Morgen ging sie hinunter zu dem alten Baron und fragte, wie er geschlafen? und las ihm die Zeitung vor. Und jeden Morgen winkte Mademoiselle sie in ihr Zimmer und plauderte mit ihr über die kleinlichen Vorkommnisse des Städtchens. Und Mittags saßen sie sich gegenüber in dem großen kühlen Speisezimmer, und Peter brachte die Suppe, die Lucie vorlegte, und dann den Braten, den sie zerschnitt. Nachmittags hielt mit gewissenhafter Pünktlichkeit der Wagen vor der Thür, und nach der Uhr gemessen fuhren die Damen eine und eine halbe Stunde spazieren, immer den nämlichen Weg zum Wasserthor hinaus. Mademoiselle that es nicht anders, nach dieser Seite war keine Bahnlinie zu passiren, und Schienen, die den Weg kreuzten, machten sie stets nervös. Die dicken Schimmel kannten genau den Fleck, an dem umgewendet wurde, sie wandten jedesmal, ohne den Wink des Kutschers abzuwarten, und trabten in einem ein klein wenig schnelleren Tempo der Heimath zu.
Dann kam das Allerschrecklichste, die Zeit der Einsamkeit droben in ihrem Zimmer. Lucie konnte dort stundenlang sitzen, ohne sich zu rühren. Die kleinen Hände, die früher so fleißig gewesen am Nähtisch, lagen müde im Schoß, die Augen blickten in den stillen Garten hinaus, ohne etwas zu sehen. Zuweilen holte sie Bücher, als wollte sie sich Vergessenheit darin erlesen; aber sie hatte Unglück mit der Lektüre: Alles was sie las, verstimmte sie noch mehr. Sie hatte im „Manfred“ geblättert, und die düstere Verzweiflung des Helden schuf ihr eine bange schlummerlose Nacht:
„Es ist ein Wirken in mir, das mich hält
Und Weiterleben mir zum Schicksal macht,
Wenn Leben heißt, so einen öden Geist
In sich herumzutragen.“
Jetzt verstand sie es; hätte sie nie gelernt, es zu verstehen! Wie Recht hatte er!
Ein andermal ergriff sie Chamisso’s Gedichte, und ihre Blicke fielen auf folgende Strophen:
„Ich hätte nicht den reichsten, den schönsten nicht begehrt,
Nur einen, der mich liebe, der meiner Liebe werth,
Ja, keine Prunkgemächer, nur ein bescheiden Haus –“
Und da stand plötzlich neben den schwarzen Buchstaben, wie ein zierliches Aquarell, ein kleines von der Abendsonne beschienenes Haus – das Paradies, das sie verloren, auf ewig verloren durch eigene Schuld!
Sie warf das Buch auf den Tisch und lief in den Garten hinunter, um ihrer schmerzlichen Gedanken Herr zu werden, und dort fand sie sich an der Gartenmauer wieder, wie sie starr zu einem Paar purpurrother, wilder Weinranken aufsah, die vom Nachbargarten herübergeklettert waren. Sie nickten und winkten im Winde, als wollten sie sagen: „Sollten wir Dich nicht kennen, Du blondes Mädchen? Saßest Du nicht auf der Bank unserer Laube im vorigen Jahr mit Deinem Schatz? Damals konnten
[249][250] wir noch nicht über die Mauer sehen, wir kannten nur das kleine Gärtchen drüben. Wie kommst Du hierher? Und so allein?“
Und dann ging sie weiter, so eilig und rasch, als gelte es einen Wettlauf; und die Erinnerung zauberte ihr jeden Blick, jedes Wort zurück, wie sie mit ihm dort gesessen, und die Gegenwart sagte höhnisch: „Vorbei! Dort wartet eine Andere auf ihn!“ Daß sie ihn verlor durch eigene Schuld, war furchtbar; daß er aber im Stande gewesen, sie zu vergessen und so bald, das dünkte sie das Schwerste von Allem. Und sie hatte doch so gar kein Recht, ihm Vorwürfe zu machen, nein, wahrhaftig nicht!
Und dennoch! Es waren Zorn und Schmerz zugleich, die sie aufspringen und flüchten ließen von der Seite des alten Herrn, wenn sie die Schritte des Doktors im Flur hörte. Und dann wieder konnte sie stundenlang dabei verweilen, sich auszumalen, wie sie ihn um Verzeihung bitte und er ihr die Hand entgegen strecke, um zu sagen: „Laß es vergessen sein, Lucie, ich habe Dich noch immer lieb.“ Hinterher schalt sie sich und versuchte ihr armes Herz durch Stolz zu trösten und aufzurichten, aber es war so schwach und verzagt, so demüthig und klein geworden, daß das alte Stärkungsmittel gramvoller Herzen sich als wirkungslos erwies.
Hortense schrieb oft; es waren kurze und abgerissene Briefe, die stets eine Bitte um Verzeihung enthielten und von dem Befinden des Patienten meldeten, so, als ob die Schreiberin keine Zeit habe und doch eine Pflicht nicht versäumen wollte. Und dabei schimmerte durch die nüchternen Zeilen eine mühsam verhehlte Glückseligkeit. Warum gestand Hortense sie nicht offen ein? Fürchtete sie, ihr, der Einsamen, wehe zu thun? Ach, sie wußte es ja so genau, welch strahlendes Glück in Woltersdorf seinen Einzug gehalten! Gott möge es hüten! Sie fühlte sich nur immer so doppelt arm nach solchen Briefen. Auf der ganzen weiten Welt hatte sie ja doch nichts mehr, woran die sehnsüchtigen Gedanken haften konnten in Hoffnung und heimlichem Glück.
Trüb und still gingen der September, der Oktober vorüber;
der November kam, in den Kachelöfen brannten die Feuer,
und im Speisesaal war es so finster, daß zum Diner eine der
Lampen des Kronleuchters angezündet werden mußte. Mademoiselle
stemmte ihre Füße gegen das Gitter des Kamins und trug einen
rothen Shawl, in den sie sich wie ein Eskimo einwickelte.
Der Baron stand fast gar nicht mehr aus dem Bette auf, ihn fror beständig. Lucie saß geduldig neben ihm, die Zeitung lesend, plaudernd, oder sie hörte zu, wenn er aus seinem bewegten Leben erzählte in der abgebrochenen Redeweise, die seine Krankheit mit sich brachte. Es waren Geschehnisse aus einer Zeit, die sie nicht gekannt, sie lernte daraus, daß es schon immer Kummer und Gram gegeben in der Welt und daß sie sich am schwersten tragen, wenn eigene Schuld sie brachte. Mademoiselle und Lucie speisten allein in dem großen Gemach. Es waren peinlich stille Mahlzeiten, wovon sollte man auch sprechen? Es kam, außer Doktor Adler, kein fremder Mensch ins Haus, und dieser hatte immer merkwürdig wenig Zeit und erzählte nichts Neues, der alte Major von Schenk lag schon seit Wochen krank. Und wenn Mademoiselle einmal bei Fräulein Dettchen gewesen war und heimgekommen erzählte, so wechselte Lucie schon bei der geringsten Andeutung die Farbe und senkte den Kopf, aus Furcht, sie würde sagen: „So, nun ist die Verlobung erfolgt.“
Sie wußte, sie würde es hören eines Tages, und sie hatte allerlei wirre Gedanken über den Seelenzustand, der darauf folgen müßte; sie meinte, sie könnte dann nicht weiter leben.
So saßen sie wieder an einem trüben Tage des Novembers; draußen hing ein düsterer Himmel hernieder; einzelne große Schneeflocken taumelten in der Luft und legten sich wie Sterne gegen die Scheiben der Fenster. Die kleine Französin sprach heute wenig; die Hammelrippchen, die Peter zu eingelegten grünen Bohnen servirte, nahmen ihre volle Aufmerksamkeit in Anspruch: sie waren nach ihrer Aussage fast so excellent, wie daheim im schönen Frankreich.
Endlich wischte sie sich den Mund, legte die Serviette auf die Tafel und fragte: „Lucie, würden Sie mir einen Gefallen thun? Würden Sie den Kaffee bei mir trinken? Ich bekomme Besuch.“
Die Augen des Mädchens kehrten aus irgend einem Winkel zurück und hefteten sich erstaunt auf das runde Antlitz der alten Dame. „Besuch?“
„Ja! Warum nicht? Sehen Sie, Lucie, ich mußte endlich einmal Fräulein Adler invitiren; sie bietet mir jedesmal etwas an, Kaffee, Kuchen oder Limonade. Ich fürchtete mich – entre nous – immer ein wenig vor diesem événement, aber was soll ich thun? Eigentlich wollte ich sie zum Abend bitten, zum Thee, mit dem Doktor – natürlich hätte ich Sie dann nicht inkommodirt; aber – denken Sie – er sagte ab, und sie – die deutschen Frauen sind wunderlich, wenigstens diese Art – sie wollte lieber einmal gemüthlich zu einem Täßchen Kaffee kommen, erklärte sie; Abends ginge sie ungern aus, sie vertrüge es schlecht. Nun war ich gestern da und lud sie auf heute ein, und sie nahm es an, bedauerte aber gleichzeitig, nicht lange bleiben zu können, da sie zu ihrer Schwägerin müsse, um Fräulein Selma im Ballstaat zu bewundern, und dann gleich wieder heim; denn auch ihr Neffe gehe zum Ball. Ich glaube, irgend so ein Klub hat Stiftungsfest. Na, das paßt ja denn auch sehr schön; kommen Sie, Kleine? 0, Sie thäten mir einen so großen Gefallen.“ Und als Lucie zögernd schwieg, sagte sie hinzu: „Ich weiß, Fräulein Dettchen würde sich freuen, sie hat immer nur Gutes von Ihnen gesprochen.“
Lucie hatte die kleine freundliche Dame nicht wiedergesehen seit jenem letzten Morgen im Hause der Schwiegermutter, es ergriff sie eine förmliche Sehnsucht nach diesem guten Gesicht.
„Wenn Sie erlauben,“ sagte sie, halb gegen ihren Willen, „so komme ich.“
„Charmant! Also um vier Uhr? Bis dahin will ich schlafen, ich bin entsetzlich abgespannt.“
Mademoiselle verbarg in der That ein Gähnen hinter der kleinen rundlichen Hand. Als Peter mit dem Nachtisch eintrat und sie statt der vielgeliebten Mehlspeise nur Aepfel und kleine Kuchen erblickte, wie sie die Köchin für alle Fälle stets in Blechbüchsen vorräthig hielt, zuckte sie unmerklich die Schultern, und, Lucie die Hand reichend, sagte sie im Davongehen: „Auf Wiedersehen!“ und trippelte aus dem Speisezimmer.
Lucie hatte dem Diener einen Brief abgenommen; er war von Hortense, aber sie konnte sich nicht entschließen, ihn gleich zu lesen; sie hatte einen ihrer bittersten Tage. Als sie diesen Morgen am Bette des Barons saß, der über außergewöhnliche Mattigkeit klagte, war Adler hereingekommen, ohne daß es ihr möglich gewesen, vorher zu entschlüpfen. Er hatte ihr eine Verbeugung gemacht, sie einen Augenblick angesehen und dann, ihre Gegenwart völlig ignorirend, sich mit dem Kranken beschäftigt. Es war etwas wie Trotz, das sie dennoch mehrere Minuten auf ihrem Platz neben dem Lehnstuhl des Barons verharren ließ; als er aber nach einigen Fragen über den Gesundheitszustand des alten Herrn mit wahrem Feuereifer von der gestrigen Stadtverordnetensitzung und dem dabei zur Verhandlung gekommenen Projekte, den Bau eines Krankenhauses betreffend, zu erzählen begann, erhob sie sich langsam und schritt hinaus. Sie hörte nur noch, wie er sagte: „Und ich werde nicht ruhen, die Beweise zu führen, daß der von der Stadt bewilligte Bauplatz die ungesundeste Stelle im ganzen Weichbild ist.“
„Vorbei!“ sagte sie sich auch heute wieder, „verloren!“ und sein kühler gleichgültiger Blick ließ sie förmlich aufschauern. Sie nahm das Tuch, welches über der Lehne ihres Sessels hing, und stieg die Treppe wieder hinauf; sie hatte hier unten augenblicklich nichts zu thun, bis fünf Uhr hielt der alte Herr Ruhe. Sie hatte auch oben nichts zu thun, überhaupt kaum noch etwas auf der ganzen weiten Welt; sie war so überflüssig, so grenzenlos überflüssig!
Sie saß in der zunehmenden Dämmerung am Ofen auf einer Holztruhe, die einst Hortense nach einem alten Renaissancemodell hatte anfertigen lassen und die hier verblieben war, weil sie nicht zu der Rokoko-Einrichtung in Woltersdorf paßte, und spann weiter an diesen schwarzen Fäden.
„Ich bin recht schlecht geworden,“ sagte sie halblaut vor sich hin, „ich bin eine von den Naturen, welche Unglück bitter macht. Wenn mich der liebe Gott gut haben will, muß er mich besser behandeln; ich weiß nicht mehr, wie es weiter gehen soll; ich glaube, ich kann niemals wieder Jemand lieb haben; ich bin keiner guten Regung mehr fähig.“
Sie begann an Alle zu denken, die ihr nahe gestanden; Hortense? Was war sie ihr noch! Der alte müde Mann dort unten? Das morsche Tau, das ihr Schifflein noch in sicherem [251] Hafen hielt, ehe es hinausgetrieben ward in die Wellen und den Sturm des Lebens! Aber dieses stille flache Wasser drückte sie noch schrecklicher als der Sturm, der sie draußen erwartete. – Georg? Sie zuckte die Schultern; Georg war froh, daß er dieser Last ledig; was ging ihn die Schwester seiner verstorbenen Frau an? Er hatte nicht das mindeste Interesse für sie, das zeigte er jetzt deutlich, übergenug! Er hatte nie wieder nach ihr gefragt.
Sie erhob sich und suchte am Nähtisch nach ihrer Häkelarbeit und strich ein paarmal mit dem Schildpattkämmchen durch das Haar, sie stand dabei vor dem Spiegel, blickte aber nicht hinein. Im Begriff hinunter zu gehen, dachte sie an Hortense’s Brief. Sie zog ihn mit raschem Griff aus der Tasche, trat zum Fenster und begann zu lesen:
„Meine liebe kleine Luz!
Du wirst immer geiziger mit Deinen Briefen, und ein liebes
herzliches Wort hast Du gar nicht mehr für mich. Ich ängstige
mich, Du könntest krank sein, oder Du seiest nicht mehr gerne
dort, jetzt, wo es Großpapa wieder besser geht. Aber Du weißt
doch, wie willkommen Du uns jeder Zeit bist, und dann – man
soll zwar nicht aus der Schule schwatzen – hatten wir noch einen
anderen Plan für Dich. Waldemar meint nämlich, Du würdest
seiner Mutter außerordentlich gefallen und könntest bei ihr
angenehme Tage verleben als liebes verhätscheltes Pflegetöchterchen.
Mich hat dieser Gedanke sehr beglückt. Du weißt, Luz, ich leide
furchtbar unter der Idee, Dich nicht glücklich zu wissen.
Ich glaube, Luz, Mama würde auch über das Grab hinaus für Dich sorgen; wen die Webers einmal lieb haben, den lassen sie nicht wieder, es sind so treue prächtige Menschen. Habe ich Dir schon geschrieben, daß Waldemar Papa nach Ungarn gebracht hat auf sein Gut, das meiner Schwiegermutter gehört? Er soll eine Art Inspektor dort vorstellen.
Möchte er sich doch einleben! Ich kann nicht verhehlen: mir macht es Sorge, aber Waldemar sagt, Papa wisse, daß dies der letzte Versuch ist. Gott gebe das Beste!
Noch eine Neuigkeit, Luz. Kannst Du rathen, worin das Geburtstagsgeschenk meines Mannes besteht? Du erräthst es nicht – er hat Dillendorf zurückgekauft, er überraschte mich mit der Urkunde, sie steckte in einem Rosenstrauß! Du weißt, Luz, ich weine selten, aber da habe ich geschluchzt an seinem Halse vor lauter Seligkeit. Ach, Lucie, laß es mich einmal aussprechen, auf das Papier schreiben, daß ich den besten Mann auf der Welt gefunden habe. Möchte Dir ein gleiches Glück beschert werden, darum bitte ich Gott jeden Tag.
Du siehst die Flecke auf dem Briefbogen befremdet an? Luz, es sind Freudenthränen – vergieb mir, daß ich mich so gehen lasse. Ich habe eine Bitte an Dich. In meinem Schlafzimmer, im Wandschrank steht im untersten Fach ein kleiner Koffer aus Juchtenleder, es sind die ersten Sächelchen darin, die ich getragen, Mama hat sie selbst für mich gemacht. Ich möchte sie haben – Du ahnst es, Lucie? Ach, Du glaubst nicht, wie glücklich wir sind! Wenn Großpapa es doch noch erleben möchte! Leb’ wohl! Ich hoffe, zu Weihnacht sehen wir uns, Waldemar versprach mir die Reise. Wie freue ich mich!
Ich muß schließen; wir haben Gäste heute Abend, und ich
habe noch allerlei zu thun. Waldemar grüßt, sowie
Deine Hortense.“
Lucie zerdrückte das Papier in der Hand, sie legte den Kopf an die Scheiben und blickte hinaus. Der allerletzte Tagesschein lag über dem einsamen Garten; leise taumelten die Schneeflocken hernieder; eine Schar Dohlen zog mit heiserem Geschrei ihren Nestern in dem alten Wartthurm zu. Eine Eiseskälte rann durch des Mädchens Glieder; so muß einer Bettlerin zu Muthe sein, die von windiger kalter Straße aus in ein behagliches warmes Zimmer lugt. Ach nein, die hatte doch vielleicht noch eine Seele, die mit ihr hungerte und darbte; sie war allein, ganz allein!
Mit diesen bitteren Gedanken ging sie hinunter. In Mademoiselle’s Zimmer brannte die Lampe noch nicht; vom Sofa her scholl die bekannte Stimme Tante Dettchen’s.
„Ja, meine Schwägerin glaubt, daß sie einig sind; er ist so verschlossen und geht vollständig in seinem Berufe auf. Man erfährt nichts Sicheres; sie meinte aber, heute Abend würde wohl – ich –“
Sie verstummte, es war ihr, als habe sie einen leisen Schrei gehört. „Was war das?“ fragte sie.
„Ach Sie sind es, Lucie?“ klang jetzt die Stimme der Französin. „In der That, ich hatte es schon aufgegeben, Sie zu sehen. Seien Sie vorsichtig; es ist ja ganz finster hier, Fräulein Adler wollte noch kein Licht.“
„Guten Abend,“ sprach dann eine weiche Frauenstimme, und Lucie, die zum Tische hinüber getreten, fühlte ihre Hand leicht erfaßt. „Wie geht es Dir – Ihnen, Lucie?“
„Ich danke, gut,“ sagte sie klanglos. Sie saß dann neben Tante Dettchen und blickte durch das Fenster auf die leicht beschneiten Dächer der Stallgebäude, die sich blendend von dem abenddunklen Himmel abhoben, und auf den hellen Stern, der durch eine zerrissene Wolke funkelte. Sie hörte wohl die Beiden weiter sprechen, das leise Klirren der Kaffeetassen und das Knistern des Feuers im Kachelofen, aber sie achtete nicht darauf.
„Aber, was wollten Sie doch erzählen, Liebste?“ fragte die lebhafte Wirthin mit der ihr eigenen Ungezwungenheit.
„Ich weiß es nicht mehr,“ stotterte Dettchen.
Die Dienerin war mit der Lampe eingetreten, und die kleine gutmüthige Dame sah in diesem Moment ein paar so glanzlose traurige Augen, daß sie abbrach.
„Lucie,“ sprach sie nach einer Weile und ergriff des Mädchens Hand, „Lucie, sind Sie – bist Du krank?“
„Nein,“ antwortete sie und richtete sich in die Höhe, während ein leises Roth ihr schmales Gesicht überflog. Und sie griff nach ihrer Arbeitstasche und begann zu häkeln mit zitternden Fingern.
Das Gespräch schleppte sich mühsam weiter, Mademoiselle fragte und Tante Dettchen antwortete. Sie redeten über die vielen Krankheiten in der Stadt und von dem Ball, der heute Abend stattfinden werde. Es sei das fünfundzwanzigjährige Stiftungsfest der Reunion, erzählte Dettchen, und werde ganz besonders glänzend gefeiert in diesem Jahre. Selma ziehe ein grünes Kleid an; darauf blinke es wie Tropfen, und Wasserrosen und Schilfblätter bildeten die Garnirung, berichtete sie auf eine Frage nach der Toilette.
,O, wie poetisch!“ hauchte Mademoiselle; „Hortense trug einmal einen ähnlichen Anzug, natürlich in Seide und Illusionstüll, magnifique! Sie war bezaubernd an diesem Abend. Liebste, tanzt er denn?“
„Wer? Ach so – nein – ich glaube, er macht sich nichts daraus; aber er lebt doch nun einmal hier und kann sich nicht zurückziehen – Sie verstehen wohl?“ Tante Dettchen stockten die Worte im Munde, sie konnte nicht vor dem Mädchen seinen Namen aussprechen. Sie sah in ihrer Verlegenheit nach der silbernen Uhr, die sie an einer Haarkette mit goldenem Schieberchen trug, und sagte: „Schon dreiviertel auf Sechs! Ich möchte wohl, ich müßte –“
„O Himmel!“ fiel Mademoiselle ein, „Sie sind ja eben erst gekommen, und mein Marasquino-Kreme – Lucie, bitte, läuten Sie einmal.“
Das Mädchen stand auf.
„Ich danke! Ich danke!“ wehrte Fräulein Adler, „ich muß wirklich gehen; ich will doch Selma noch helfen, denn Klara hat mit sich genug zu thun; ich glaube, sie warten schon.“
Sie ließ sich nicht halten. Lucie legte ihr den wattirten Mantel um die Schultern und reichte ihr die Kapuze.
„Es war mir eine große Ehre,“ sagte Tante Dettchen unbehilflich und schüchtern zu Mademoiselle, welche sie mit dem Anstand einer Fürstin zur Stubenthür begleitete. „Vielen Dank, herzlichen Dank für Ihre Freundlichkeit! Leb’ wohl, Lucie. Einen Regenschirm hatte ich noch – danke vielmal!“
Lucie stand am Fenster und sah sie durch den Schnee über den Hof trippeln, von Peter geleitet.
„Um Gotteswillen, Lucie, können Sie langweilig sein!“ schmollte Mademoiselle. Aber das Mädchen erwiederte nichts; sie sah starr hinüber, wo durch die Pforte, die Tante Dettchen eben passirte, eine große Männergestalt trat, von Peter’s Laterne mit zuckendem Schein gestreift, und nun schloß sich die Pforte hinter ihm, und sie kamen auf das Haus zu. Lucie erkannte, daß noch ein kleines Wesen neben dem Fremden einherging. Dann trat sie bestürzt zurück und eilte aus dem Zimmer.
„Was giebt’s?“ rief Mademoiselle, aber Lucie hatte schon die Thür aufgerissen; „Georg?“ fragte sie athemlos, „Du?“
Es bebte freudig in ihrer Stimme; er kam zu ihr – er hatte sie nicht ganz vergessen!
[252] Im Hausflur stand der Oberförster, sein jüngstes Töchterchen neben ihm. Er nahm die Pelzmütze ab und streckte Lucie die Hand entgegen „Ja,“ sagte er, „ich! Ich habe den Zug in L. verpaßt und komme darum so spät. Ich wollte Dich sprechen Lucie –“ er stockte – „und die Annemarie soll zum Doktor; ich störe doch nicht?“
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, nein,“ erwiederte sie und sah ihn an. Er schien so gebeugt, so gealtert.
Mademoiselle, die einen Augenblick gelauscht, machte die Thür geräuschvoll wieder zu, was sie da sah, ging sie nichts an. Peter hatte sich entfernt, nachdem er die Laterne auf einen Bord im Flur gestellt. Die Drei standen noch immer in dem kalten Raume.
„Mich friert,“ sagte die Kleine weinerlich.
„Kommt,“ bat das Mädchen und ging der Treppe zu. Dann wandte sie sich und führte die unerwarteten Gäste in das Eßzimmer. Im Kamin glühten die Kohlen noch und eine der Lampen brannte am Kronleuchter über dem Tisch inmitten der Stube.
„Lege doch ab,“ sagte Lucie zu dem Schwager und knieete vor dem Kinde nieder, um ihm das Mäntelchen auszuziehen. „Ihr seid gewiß hungerig und durstig und erfroren, gleich sollt Ihr essen.“
„Die Kleine vielleicht,“ erwiederte der Oberförster, „ich esse lieber im Hôtel, wo ich wohne. Kannst Du Annemarie hier behalten?“
Er hatte den Pelz abgenommen und sah zu Lucie hernieder, die eben das Hütchen von dem Blondkopf nahm und das Kind küßte und wieder küßte. Sie nickte mit überströmenden Augen. „Was fehlt ihr?“ fragte sie aufstehend.
„Immer noch dasselbe; sie wird von Tag zu Tag magerer. Es ist ja auch kein Wunder.“
Lucie ging in die Küche und bat um etwas Milch und Weißbrot für die Kleine, und dann trat sie an das Bett des alten Herrn.
„Mein Schwager ist ganz plötzlich angekommen,“ sagte sie, mit einer Stimme, aus der man ihre freudige Aufregung erkannte, „sonst wäre ich schon hier und läse die Zeitung vor. Darf ich Mademoiselle an meiner Stelle schicken?“
„Dank! Dank!“ stammelte der Baron. „Was will Remmert? Doch nicht Sie holen, Lucie? Wünscht er mich zu sehen – gerne, gerne!“
„Ich werde ihn nachher schicken,“ erwiederte das Mädchen. „Warum er kommt, weiß ich nicht.“
„Oder lieber morgen früh,“ sagte der Baron. „Ja, das ist besser, besser – bin so müde heut.“ Er reichte ihr die Hand. „Schlafen Sie wohl, Lucie!“
Sie kam wieder in die Eßstube zurück. „Was mochte er wollen?“ Und mit dieser Frage in den großen Augen setzte sie sich still ihm gegenüber in den hochlehnigen Kaminsessel. Er hielt die Kleine auf dem Schoß und sah in die Gluth.
„Wie geht es Dir denn sonst?“ fragte er, ohne aufzublicken, mit leiser, etwas heiserer Stimme, die bei vielen Menschen das Zeichen großer Gemüthserregung ist.
„Ich danke, gut. Und Dir?“
„Wie soll es mir gehen? Du kannst es Dir denken – allein mit den Kindern! Sei nur nicht böse, daß ich Dir nie geschrieben habe,“ fuhr er fort. „Im Anfang wußte ich nicht, was? Ich war so erbittert, auch auf Dich, und jetzt dachte ich: es wäre besser, ich redete selbst mit Dir; Du weißt, ich bin nicht fürs Schreiben.“
Lucie antwortete nicht; ein tiefes Mitleid überkam sie. Sie bemerkte, wie seine Rechte zitterte, die das Kinderhändchen hielt, und wie über sein vergrämtes Gesicht ein Zucken ging. Er sah so unordentlich aus, so vernachlässigt. Und das Kind! Die hübschen blonden Löckchen mittelst Wasser zu glatten Scheiteln gebändigt, das Kleidchen von schwarzem Wollstoff mit aufgedruckten weißen Punkten so bäuerisch im Schnitt; das karrirte Knüpftüchelchen um den Hals an den Ecken zerrissen. „Ich hatte auch schuld,“ sagte sie, „ich bin Dir nicht böse, aber wenn Du wüßtest, wie damals die Verhältnisse lagen! Sprich, Georg, kann ich irgend etwas für Dich thun?“
„Lucie,“ und er ließ das Kind von seinem Schoß und drängte es zu ihr hinüber, „Du weißt, wie ich Mathilde geliebt habe –“
„Ja!“ sagte sie.
„Und Du auch, Du auch! Wenn Du auch damals nicht gekommen bist.“
„Ich auch, Georg, Gott weiß es!“
Er schwieg und zog das rothbunte Taschentuch hervor, und fuhr sich über die Stirn.
„Es geht nicht länger so,“ sprach er, „wenn nicht die Kinder ganz verkommen sollen.“
„Du möchtest, Georg, daß ich –?“
„Die Kousine verträgt sich mit den Erzieherinnen nicht; sie hat vorige Woche die Dritte weggebissen, sie keift den lieben langen Tag im Hause umher, die Kinder haben Angst vor ihr, und ewig sehe ich weinende Gesichter. Ich möchte schelten und strafen, sobald ich mich blicken lasse, und wahrhaftig – nie war Friede mir nöthiger, als jetzt.“
„Du meinst, ich soll kommen, Georg, der Kinder wegen?“ fragte sie noch einmal. „Du weißt es ja, ich wollte schon damals bei ihnen bleiben.“
„Sie sind verlassener, als Du denkst, Lucie,“ sagte er ausweichend.
„Und glaubst Du, daß die Kousine sich mit mir vertragen wird, Georg?“ Sie war aufgestanden und hatte ein kleines Präsentirbrett mit der dampfenden Tasse aus Peter’s Händen genommen.
Er antwortete nicht, er betrachtete sie, während sie das Kind an den Tisch führte, auf den Stuhl hob und ihm die heiße Milch in der Untertasse verkühlte. Es lag wie Angst in seinen Blicken.
„Nein, die Kousine bliebe nicht, wenn Du –“
Lucie kam zurück und stand jetzt vor dem Schwager, ihn erstaunt ansehend.
„Setze Dich,“ sprach er, „ich will Dich etwas fragen.“
Sie saß gehorsam nieder.
„Viel schöne Worte machen kann ich nicht, Lucie,“ begann er tief athemholend.
„Es ist auch nicht nöthig, Georg,“ unterbrach sie mit ihrer müden Stimme, „wenn mich Mathildens Kinder brauchen, so komme ich; sie müssen dann sehen, wie sie hier ohne mich fertig werden.“
„Ja – schön! Aber – Du weißt nicht, wie ich es meine. Ich denke nämlich, Lucie, es wäre das Beste, wir – wir heiratheten uns – wenn Du – wenn ich Dir –“
Er kam nicht weiter. Sie war von ihrem Sitz emporgesprungen und streckte tödlich erschreckt die Hände wie zur Abwehr aus. Sie wollte sprechen, aber brachte kein Wort über die Lippen.
„Denke Dich nur in meine Lage,“ sagte er wie entschuldigend. Er war ebenfalls aufgestanden, nun setzte er sich wieder. „Höre mich doch wenigstens an, Lucie! Ich bin weit entfernt davon, Dir vorzuschwatzen von Liebe und so etwas, ich kann Dir weiter nichts versprechen, als ehrliche rechtschaffene Dankbarkeit für das, was Du an mir und den Kindern thun würdest, Dankbarkeit bis an mein Lebensende. Was hast Du denn so auch, Lucie? Du drückst Dich bei Fremden umher und wirst verdrießlich und verbittert. Für mich verlange ich ja so wenig, aber die –“ er zeigte auf das Kind und ward still; es hing ihm ein großer Tropfen in den Wimpern.
Sie stand noch immer so; nur die Arme waren ihr herabgesunken. Als ob sie bei der geringsten Bewegung in einen Abgrund versinken müsse, so regungslos verharrte sie.
Eine lange Pause entstand. Das Kind glitt von seinem Stuhl und kam herüber mit trippelnden Schrittchen. „Es thut weh,“ sagte es und zeigte auf den Hals. Er nahm das kleine Geschöpf auf seine Kniee und strich ihm über die Löckchen.
„Es wird wieder gut,“ tröstete er leise.
„Warum weinst Du denn, Vater?“ Und das Gesichtchen, das dem Mathildens so ähnlich war, verzog sich ebenfalls zum Weinen. „Mein Kopf thut weh, Vater.“
„Sie hat Hitze,“ bemerkte er gepreßt zu Lucie, „sie wird doch nicht krank werden?“
„Ich will sie ins Bette legen,“ brachte das Mädchen endlich hervor, „komm, Annemarie!“
Die Kleine kam gehorsam zu ihr.
„Ich gehe dann, Lucie,“ sagte er. „Du weißt nun, was ich will, drängen mochte ich Dich nicht; Deine Antwort hole ich morgen. Gute Nacht, Lucie!“
„Gute Nacht!“ klang es tonlos dagegen, aber die Hand, die sich ihr entgegenstreckte, wurde nicht erfaßt. Stumm zog er den Pelz an und nahm den Hut, und stumm ging er aus dem Zimmer, ohne sich noch einmal umzusehen.
Sie stand noch immer da und sah in dem Gemach umher; es war ihr, als träumte sie einen furchtbaren Traum.
„Tante Lucie!“ sagte das Kind weinend.
[253] Sie faßte die kleine Hand und trat mit dem Kinde auf den Flur; Mademoiselle öffnete ihre Stubenthür und schaute hinaus.
„Kommen Sie zu Tische, Lucie? Mon dieu, bleibt la petite hier? Wie alt ist sie?“
„Vier Jahre,“ antwortete das Mädchen, das Kind empor nehmend, und ging mit sonderbar schwankenden Schritten der Treppe zu.
„Himmel! Was ist Ihnen denn?“ schrie Mademoiselle, als sich Lucie an dem Knauf des Treppengeländers hielt. „Sie werden das Kind fallen lassen!“
„O nein; ein wenig Schwindel nur. Ich will mich legen, ich habe es öfter –.“ Sie stand da wie erschöpft; es war ihr, als hebe sich der Fußboden im Flur schräg in die Höhe, als flöge die Lampe dort oben an der Decke in einem feurigen Kreise. Mit Aufbietung ihrer ganzen Kraft erstieg sie die Treppe und betrat ihr Zimmer. Sie zündete Licht an und begann die Kleine auszuziehen, Alles ganz automatenhaft.
„Tante böse?“ fragte die zarte Stimme. Sie hörte es nicht. Sie legte das Kind in ihr eigenes Bett, und dann flüchtete sie in den dunkelsten Winkel des Zimmers und fuhr wild mit den Händen an ihre Schläfen. „Muß ich denn? Muß ich denn? Giebt es denn keinen Ausweg?“
Aber was wollte sie eigentlich? Noch einmal that sich ihr eine Zukunft auf! Was hatte sie denn noch zu hoffen, daß sich ihr innerstes Herz empörte bei dem Gedanken, an Mathildens Stelle zu treten? – O, es war so furchtbar! So furchtbar, eines ungeliebten Mannes Weib zu werden! Nie! Nie! Sie sah ihn vor sich, so müde, so gebrochen, wie er ihr Dankbarkeit bot – weiter nichts als Dankbarkeit! Aber mußte sie’s denn nicht thun der armen Kinder wegen? Nein! Hätte sie’s denn gekonnt, wenn sie Adler’s Frau geworden wäre? Ja dann, dann!
Und mächtiger als je erwachte in ihr die Sehnsucht nach dem Verlorenen. Ein schluchzender Schrei klang durch das Zimmer: „Ich kann nicht! Ich kann es nicht!“ – Sie wollte Alles thun, seine Kinder pflegen, sein Haus in Ordnung halten, Alles, nur nicht sein Weib werden!
„Nie!“ sagte sie laut und zornig, und ihre Hände ballten sich. „Nie! Ich will nicht!“
„Tante, komm doch her,“ weinte das Kind. Sie ging hinüber und beugte sich über das fiebernde Gesichtchen. „Mich dürstet, Tante; mir thut der Kopf so weh.“
Sie reichte Wasser und legte ihre kühle zitternde Hand auf die heiße Stirn. Sie setzte sich auf den Bettrand und starrte auf einen Fleck. Vor ihren Augen tanzten glühende Funken; dann flog ein leichter grüner Schein vorüber.
„Das ist seine Braut im Ballkleide! Geh weg,“ murmelte sie; „geh weg, was willst Du hier?“
Aber näher und näher kam es; sie schreckte empor – sie hatte doch nicht geschlafen?
Ein leises Flüstern drang in ihre Ohren; es war das alte Gebet, das Mathilde ihre Kinder gelehrt:
„Müde bin ich, geh zur Ruh –“
„Amen! Mein Kopf thut so weh!“ Die Kleine warf sich unruhig hin und her. „Bleibst Du bei mir, Tante? Geh’ nicht weg, wie die Kousine; ich fürchte mich.“
Lucie war vor dem Bette auf die Kniee gesunken. Sie dachte, wie auch sie einst krank gelegen und die Schwester nicht von sich gelassen, Tag und Nacht nicht.
„Ich muß! Ich muß!“ flüsterte sie. „Ich bleibe bei Dir, mein Annemariechen, schlafe, damit Dein Kopfweh besser wird.“
„Liebe, liebe Tante! Und ein weiches Aermchen schlang sich um ihren Hals.
Sie wagte nicht, sich zu rühren, bis das Kind schlief. Dann stand sie auf und tastete sich zu der Ofentruhe; dort saß sie regungslos im Kampfe mit sich selbst, stundenlang.
„Barmherziger Gott!“ schrie sie endlich, „ich kann es nicht, ich kann es nicht!“ Und schwer sank ihr Kopf gegen den Ofen.
Das erste Jahr im neuen Haushalt.
Liebste Marie!
Gestern war ich bei dem ersten großen Damenkaffee! Du erinnerst Dich gewiß noch, daß ich es verschworen habe, in einen solchen zu gehen, und auch vor ein paar Tagen, als die Einladung kam, sagte ich zu Hugo: „Nein, ich mag nicht hin, es ist zu gräßlich!“
„Warum nicht gar!“ erwiederte er, „Du kannst Dich davon nicht ausschließen, ohne für hochmüthig verschrieen zu werden. Ueberwinde Dich, Schatz! Es giebt schlimmere Dinge im Leben!“
Mit solchen Redensarten setzen sie ja immer ihren Willen durch; ich ging also, nach höherem Befehl, zur Frau Amtsräthin, aber wenigstens eine halbe Stunde später als die Anderen, die schon vollzählig um den [254] langen, weißgedeckten Tisch saßen, als ich die Thür öffnete. Ein lebhaftes Stimmengewirr ertönte mit dem Löffel- und Tassenklappern zusammen; auch Körbe mit Kuchen in jeder Gestalt machten die Runde; ich bekam eine etwas gehaltene Begrüßung von der Hausfrau und eilte im Gefühle meiner Schuld so schnell wie möglich, am unteren Tischende neben ein freundlich aussehendes junges Mädchen zu versinken, das mit unendlicher Beflissenheit sofort anfing, mir Kuchen, Kranz, Vanillenschnitte, Hefenbretzeln beizuschaffen und immer dringender nöthigte: „Ach, nehmen Sie doch!“
Ich merkte, daß das Mägdegespräch bereits in gutem Zuge war. Die Geister der jüngstverflossenen Köchinnen schwebten über der Versammlung, und aus dem allgemeinen Chor erhob sich die Stimme von Fräulein Berghaus, welche eine längere Erzählung also beschloß:
„Und darum sage ich: es ist eine vorzügliche Probe für die Tüchtigkeit einer Hausfrau, ob sie über ihre Milchreste Kontrole führen darf oder nicht!“
Hier erhob sich ein vielstimmiges Klage- und Entrüstungsgemurmel; ich dachte auch im Stillen an den Topf Milch, den Rike jeden Abend füllen und im Laufe des andern Tages verschwinden läßt. Würde ich es wagen, sie darüber zur Rede zu stellen? Nein, sicher nicht. Also auch noch weit von der guten Hausfrau!
„Ach, die Milch!“ rief eine junge Officiersgattin, „die gehört nun einmal zu den nothwendigen Uebeln; das ist ja doch auch nur eine Kleinigkeit –“
„Fünf Pfennig täglich macht in der Woche fünfunddreißig,“ bemerkte Fräulein Frida.
„Aber denken Sie sich!“ fuhr die Andere unbekümmert fort. „Neulich komme ich um zwölf Uhr in die Küche, finde den Herd weißglühend, alle Töpfe an den Rand gerückt und doch noch zischend im Ueberkochen.
‚Um Gottes willen, Babette, was fällt Ihnen ein, solch ein Feuer zu machen?‘ ‚Ei,‘ erwiedert sie mir, ‚weil noch so viel Holz im Holzstall ist, hab’ ich mir gedacht: ich will’s wegbrennen, bis das neue kommt!‘“
„Nun, da haben Sie’s noch gut gehabt mit Ihrem Eintritt in die Küche,“ sagte kaltblütig ihre Vorgesetzte, die Majorin. „Als ich neulich ins Zimmer meines Mannes trat, stieß ich im Dunkeln an einen Fuß, der von der Chaiselongue herunterhing. Es war die Köchin, die sich hier nach dem Abspülen ‚etwas ausruhte‘, wie sie sagte.“
Alles lachte.
„Ja, es ist arg,“ rief jetzt die Gutsbesitzerin von Walden, die eine lustige und resolute Frau zu sein scheint. „Ich sage Ihnen, wer, wie ich, dreißig Jahre lang Haushaltung führt, der kommt zuletzt dahin, sich die ewige Seligkeit als den dienstbotenlosen Zustand vorzustellen. Ich freue mich heute schon darauf; denn den Himmel habe ich mir an meinen verschiedenen Köchinnen und Hausmamsells redlich verdient.“
„Meine Erfahrung hat mir gezeigt,“ sagte eine andere ältliche Mama, „daß es nur zwei Sorten von weiblichen Dienstboten giebt: die Freundliche, Sanfte, Lahme, Bigotte, Schmutzige, dann die Grobe, Heftige, Unverschämte, die gut kocht und gern putzt. Ich habe fünfundzwanzig Jahre lang zwischen Beiden alternirt und bin im Augenblick wieder bei der Sanften. Aber der Schmutz wächst im Hause, und zu Ostern muß ich eben doch wieder zur zweiten Sorte greifen.“
„Ich,“ erwiederte eine geprüfte Kreuzträgerin, indem sie die Augen zum Himmel hob, „ich habe noch eine dritte Sorte kennen gelernt, die Grobe, Heftige, Unverschämte, Lahme, Bigotte und Schmutzige in Einer Person!“
„Es giebt auch noch die Flinke, Freundliche, die gut kocht –“ wehrte lachend Mama Baer vom Sofa her ab, aber es war umsonst; die Wellen gingen zu hoch.
Ich wandte mich unter ihrem Brausen zu dem jungen Mädchen an meiner Seite und sah in ein paar große, braune Rehaugen und ein rosiges Gesichtchen, von krausem braunem Haar umgeben. Wenn man dem guten Kinde das abscheuliche, grell karrirte Kleid und die Kravattenschleife von hartem Mull und gelber Kartoffelspitze hätte durch etwas Besseres ersetzen können, wäre sie sogar sehr hübsch gewesen. Sie sah mich andachtsvoll an: „Ach, Frau Assessor, ich bin so glücklich, daß ich einmal neben Ihnen sitzen darf! Ich kenne Sie schon lange; Sie werden nicht auf mich geachtet haben, aber allemal, wenn Sie mit Ihrem Herrn Gemahl draußen an unserer Sägemühle vorüber gehen (der Vater ist Holzhändler), dann sehe ich Ihnen noch lange nach, weil Sie mir gar so gut gefallen haben. Nicht wahr, Sie nehmen es nicht übel?“
„Daß ich Ihnen gefalle – gewiß nicht!“
„Nein, daß ich mich so ungeschickt ausdrücke. Aber das ist jetzt einerlei, ich bin ja so froh, daß ich überhaupt mit Ihnen reden darf.“
Na, so etwas sagt man Einem doch nicht umsonst; ich bekümmerte mich also ein wenig um sie und erfuhr, daß Klara ihre Mutter kürzlich verloren hat und nun dem Vater die Haushaltung führt. Aber bei diesem Geschäft geht es dem armen Ding noch viel schlimmer als mir! Sie hielt denn auch nicht zurück mit ihren Nöthen, sondern schüttete gleich ihr ganzes Herz aus, froh, eine theilnehmende Seele zu finden:
„Sehen Sie, beste Frau Assessor, meine Mutter war eine sehr sparsame Frau, und so lange sie lebte, hätte man denken sollen: wir dürften uns gar nichts gönnen – alle Tage Ochsenfleisch und Gemüse; dabei ist in der Küche nichts zu lernen, und so kommt es, daß ich jetzt eben ganz unerfahren bin. Der Vater aber, der mir Alles überläßt, möchte gern manchmal etwas Gutes essen, und morgen ist sein Geburtstag; da habe ich mir in den Kopf gesetzt, ihn mit einem Hasenbraten zu überraschen. Sie müssen nämlich wissen: ich habe keine selbständige Köchin genommen, sondern ein junges, recht braves Mädchen; ich habe gedacht, wir lernen zusammen. Gustel heißt sie. Nun, also heute Morgen schickt der Förster den Hasen; ich gehe erst hinauf, in meiner ‚Davidis‘ nachzulesen; dann nehme ich das Buch mit in die Küche: ‚Also, Gustel, hänge den Hasen dort an den großen Nagel und stelle eine Schüssel unter und jetzt paß auf!‘ Ich lese also langsam vor: ‚Man packt mit der linken Hand die rechte Hinterpfote des Hasen – hast Du’s, Gustel? – dann nimmt man ein scharfes Messer, schneidet rings an den Läufen das Fell ab und zieht es gegen den Leib herunter.‘ Das liest sich ganz leicht, ist aber sehr schwer auszuführen; wir zogen, die Gustel und ich, aus Leibeskräften, bis das Fell endlich herunter war. Und nun las ich wieder vor vom Aufschneiden, und wir suchten es auch so zu machen; aber das wurde schrecklich, Frau Assessor, wir verloren gleich den Kopf! Wenn Sie gesehen hätten, wie das zuging, wo wir in der Verzweiflung überall hinschnitten und wie das Blut in der Küche herumspritzte! Ich weiß nicht, wie wir mit dem Hasen fertig geworden sind – die ‚Davidis‘ hatte ich schon lange bei Seite gelegt – ich war zuletzt nur froh, als er nach einer guten Stunde endlich abgezogen und ausgenommen war! Nicht wahr, so Etwas sollte man eben gezeigt bekommen? Ach, es ist so schwer, nur nach dem Kochbuch zu kochen!“
Ja, das wußte ich am besten; das arme Ding dauerte mich deßhalb von Herzen, und ich nahm mir vor, ihr behilflich zu sein. Sie sah mich strahlend vor Dankbarkeit an, als ich ihr sagte: sie möge zu mir kommen; wir wollten ihre Sachen gemeinsam überlegen.
Die Andern waren mittlerweile von den Mägden auf den lieben Nebenmenschen im Allgemeinen übergegangen, und zwischen Massen von Punsch, Torten, Eingemachtem und kleinem Konfekt flogen verschiedene: „Da muß ich doch bitten, Frau Räthin“ und: „Nein, meine Liebe, da sind Sie ganz irrig berichtet“ hinüber und herüber. Ich setzte mich noch ein wenig zu meiner guten alten Obristin, brach dann so schnell auf, wie es überhaupt anging, und ich kann Dir sagen: ich hatte auf dem Heimweg ein ganz miserables Gefühl. Welch verlorene Zeit, nein, schlimmer als das, welcher Schaden am eigenen Innern sind solche Kaffeegesellschaften! Ich war noch ganz wild beim Nachhausekommen und wollte gerade Hugo erklären, daß ich eben doch künftig nicht mehr hingehe, als ich einen Herrn bei ihm im Zimmer traf – aber wen? Du räthst es nicht: den „großen Unbefriedigten“, jenen sogenannten interessanten Doktor Brandt, der sich vor zwei Jahren auf allen Bällen herumtrieb und Einem mit seinen Redensarten über die „Unzulänglichkeit der Existenz“ das lustigste Souper verderben konnte. Trotz seiner Weltverachtung suchte er im Stillen eine reiche Frau; aber sie sollte zugleich eben so schön als geistvoll sein, um das Opfer seiner Person einigermaßen aufzuwiegen. Nun, er fand diesen Ausbund nicht unter uns, so lebhaft er auch einstweilen bald da, bald dort Kour machte, und sich schleunigst wieder zurückzog, sobald er eine verlockendere Aussicht zu finden glaubte. Darüber mag denn sein kleines Vermögen immer „unzulänglicher“ geworden sein: eines schönen Tags war er fort, und es gab Leute, die ihm zutrauten, er möge am Ende den „Sprung ins Dunkle“ wirklich gemacht haben, den er manchmal als das Ende eines verfehlten Lebens anzudeuten liebte.
Nun, jetzt ist er hier, der „Sprung“ hat ihn in der großen Leimfabrik draußen niederfallen lassen, die bei Westwind so schrecklich riecht, daß man alle Fenster schließen muß, und dort kann er sein ästhetisches Feingefühl an der Frau seines Direktors und ihren drei dicken Töchtern erproben. Das nennt man, glaube ich, dramatische Gerechtigkeit!
Mir ist sein Erscheinen hier keine große Freude und Hugo, glaube ich, auch nicht; aber annehmen muß man sich seiner doch.
Werden wir uns zu Weihnacht sehen, liebste Marie? Ich hoffe es, ich wünsche es sehnlichst; aber ob wir wirklich heimreisen werden, das weiß ich noch nicht. O, wie himmlisch wäre es! Einstweilen hofft darauf Deine Emmy.
Blätter und Blüthen.
Chamisso-Büste. (Mit Illustration S. 237.) Berlin hat sein Schiller- und Goethe-Denkmal; es soll auch seine Chamisso-Büste erhalten. Einen Aufruf zur Errichtung eines Denkmals für den gefeierten Sänger des „Salas y Gomez“ hatte schon im Namen des Komité’s der im vorigen Jahre verstorbene Professor Scherer 1882 erlassen; ein erneuter Aufruf von der Feder Friedrich Spielhagen’s ist im März dieses Jahres veröffentlicht worden. Spielhagen widerlegt die Behauptung, der Name Chamisso’s klinge nicht stark genug an das Ohr der Zeitgenossen, sein litterarisches Bild sei nebelhaft, das Interesse an seinen Poesien dahingeschwunden. „Fragt den Knaben, der begeistert seinen ‚Abdallah‘ recitirt, mit dem Dulder von ‚Salas y Gomez‘ verzweifelt auf die Oede des Weltmeeres starrt! Fragt die Jungfrau, die Frau, die in ,Frauenliebe und Leben‘ ihr eigen Lieben und Leben wie in einem knistallenen Spiegel ahnend vorausschaut, wehmuthsvoll noch einmal an sich vorübergehen läßt! Fragt den Jüngling, der mit ,Peter Schlemihl‘ den Schattenbildern seiner Hoffnungen und Entwürfe nachjagt! Fragt den Gelehrten, welche Hochschätzung er dem Manne zollt, der, als es noch keine Dampferlinien und tausendmeilige Eisenbahnen gab, die Erde umkreiste und von Allem, was sein klares Auge geschaut, so treubescheiden zu berichten wußte. Nun, das Angedenken eines der edelsten, liebenswürdigsten, sinnigsten Menschen, Dichter und Forscher, des geborenen französischen Aristokraten, der sich zu einem deutschen Bürger in des Wortes bester Bedeutung und – was viel mehr sagen will – in einen wahrhaft deutschen Dichter umzuwandeln verstand, ist noch nicht erloschen unter uns.“
Gewiß kann man dieser sinnvollen schönen Charakteristik eines Poeten, von dem einzelne Gedichte dem Hausschatze unserer Litteratur auf die Dauer
[255] angehören, nur beistimmen und hoffen, daß sie ein Echo in vielen Kreisen finden wird. Die Ausführung der Kolossalbüste ist dem Bildhauer Julius Moser in Berlin anvertraut worden. Man darf mit Recht behaupten, daß für Dichter und Denker die Form der Büste am meisten geeignet ist, wo es eine monumentale Verherrlichung gilt. Die bisher eingegangenen Beiträge reichen indeß nicht aus für Herstellung von Reliefs auf dem Piedestal und für die Aufstellung des Denkmals, für welches zunächst ein Platz an der Lisière des Thiergartens der Matthäikirchstraße gegenüber in Aussicht genommen ist. Jeder Freund des Dichters wird gewiß gern sein Scherflein dazu beitragen, daß das sinnende Antlitz desselben, wie es unser Bild zeigt, freundlich anregend den Spaziergänger im Thiergarten an die liebenswürdigen Schöpfungen eines begabten Dichters erinnert.[1] †
Lieder von Martin Greif. Martin Greif, der so viele stimmungsvolle Lieder geschaffen, erfreut uns durch immer neue Kundgebungen seiner sinnigen Muse, von denen wir einige unsern Lesern hier mittheilen.
Im Gebirge.
Daheim zu süßem Schlaf geneigt,
Gebiet’ ich hier der Ruh’
Und eile, eh’ die Sonne steigt,
Den frischen Wäldern zu.
Ich schwinge mich den Hang hinauf,
Der noch vom Tann mich trennt,
Und suche jeden Zauber auf
Bis an das Firmament.
Die Berge, die so still und groß
Im Morgenroth erglühn,
Der Ache Sausen und Getos
Läßt mich nicht weiter ziehn.
Und gar des Sees erhab’ne Pracht,
Der wallend vor mir blaut,
Da mich Natur zum Zeugen macht,
Wie sie sich selbst beschaut!
Nun hin, wo sie die Schauer drängt
In starrer Einsamkeit,
Wo schroff der Felsen überhängt
Seit ungedachter Zeit!
Wohl stellt auch dort sich wirkend dar,
Der Alles liebend schuf;
In jedem Habichtschrei sogar
Erkenn’ ich seinen Ruf.
Drum bet’ ich, wenn im tiefen Thal
Geläute fromm erhallt,
Und Nebel dort mit Einemmal,
Wo ich genächtigt, wallt.
Und dringt mir ans gerührte Herz
Erst Herdenglockenton,
So fliegt mein Gruß auch mattenwärts
Zur trauten Alme schon.
Ergebung.
Wohl, das Tagwerk ist vollbracht,
Ruhe naht mit hehrem Frieden.
Alles webt in hoher Macht;
Selbst das Aug’, vom Schlaf gemieden,
Fühlt, daß Einer droben wacht:
Lenk’ es, Herr, wie Du’s beschieden!
Bei meiner Mutter Begräbniß.
Als verstummt der Grabgesang,
Meint’ ich vor des Friedhofs Schwelle
Zu vernehmen leis, doch helle,
Noch ein Lied im Feierklang.
Näher zog es mehr und mehr;
Zu dem dröhnend dumpfen Rollen
Der hinabgestürzten Schollen
Drang es voller Trost daher.
Und dies war der Kündung Sinn
Durch den Chor aus Engels Mitten:
„Ausgelitten, ausgestritten
Hat die sanfte Dulderin.“
Ein heimgekehrter Afrika-Reisender. Am 16. März fand zu Ehren des Dr. Junker eine Festsitzung im Centralhôtel zu Berlin statt. Junker gehört zu Denen, die muthig in das Innere Afrikas vordrangen; er hatte sich die Erforschung der Zwischengebiete zwischen dem Nil und dem Kongo zum Ziel gesetzt; namentlich wollte er den Lauf des Uëlleflusses festsetzen, der sich in den Kongo ergießt, von wo aus der untere Flußlauf schon untersucht ist. Trotz wichtiger Entdeckungen hat Dr. Junker dies Ziel nicht erreicht; er vermochte es nicht, bis zum Kongo vorzudringen, und es liegt noch eine terra incognita von mehreren hundert Kilometern zwischen der von ihm durchwanderten Landstrecke und jenen bereits bekannten Uferlandschaften des Kongo; gleichwohl hat sich Junker um die Kenntniß von Land und Leuten im inneren Afrika große Verdienste erworben und bei seinen Reisen jene Unerschrockenheit bewährt, welche all diesen unternehmungslustigen Männern der Wissenschaft und Pionieren der Civilisation zur größten Ehre gereicht.
Ende 1879 war Junker nach Kairo gekommen, im Januar 1880 langte er in Khartum an. Der Nil war damals wegen des hohen Wasserstandes durch Grasbarren verstopft; doch Junker gelangte noch glücklich durch dieselben hindurch, glücklicher als der Negerdampfer ein Jahr später, der mit mehreren hundert Eingeborenen sich in einer solchen Verstopfung festgefahren hatte und nicht vor- und zurückkonnte, so daß die unglücklichen Passagiere zum Theil den Hungertod starben, zum Theil sich von den Leichen der Gestorbenen nährten. Seine Forschungen begann er in Dem Bekir und südlich davon bei dem Fürsten der Niam-Niam, Ndoruma, bei dem er eine freundliche Aufnahme fand. Von hier wandte er sich zum Semio im Lande Palembatas. Weiterhin legten ihm die Mangballefürsten Schwierigkeiten in den Weg, so daß es ihm nur mit Mühe gelang, zum Uëlle zu gelangen, welchen er zweimal überschritt.
Bei einer Forschungsreise weiter nach Süden und Südwesten besuchte er einen anderen Fürsten der Niam-Niam, Bakangai. Auch hier fand er freundliches Entgegenkommen; ein Schimpanse und zwei schwarze Zwerge von der Rasse Akka-Akka wurden ihm zum Geschenk gemacht. Es giebt also verschiedene Zwergvölker im Innern Afrikas: wir berichteten erst neulich von einem solchen Stamme, der im Süden des Ngamisees wohnte. Dr. Junker machte der Kolonie der kleinen Leute einen Besuch. Nach einigen Streifereien in das Gebiet der Monbuttu und Momon kehrte er noch einmal zum Semio zurück, von wo aus er 1882 eine Rundreise unternahm, die ihn wieder zweimal an den Uëlle führte.
Inzwischen war ihm die Rückkehr durch den Aufstand des Mahdi gesperrt, welcher auch die von Emin Bey verwaltete Aequatorialprovinz bedrohte. Er begab sich nach der Hauptstadt derselben, Ladò, wo er Emin Bey traf; die Mahdisten schrieben fanatische Drohbriefe; es erschien unmöglich, ihren Bannkreis zu durchbrechen. Da faßte Junker den heldenmüthigen Entschluß, sich über die südlichen Nachbarreiche Unyoro und Uganda den Weg zur Heimath zu bahnen: es gelang ihm dies; er vermochte sogar die Briefe der Eingeschlossenen zu befördern und mit Hilfe arabischer Kaufleute für 2000 Thaler Munition und Vorräthe an sie abzusenden, die auch glücklich dahin gelangten. Auf der Handelsstraße nach Sansibar schloß er sich dem Elfenbeinhändler Tibu Tibb an, der ihn glücklich an die Küste geleitete. Leider wurde noch ein Deutscher, Giesecke, Vertreter des Hamburger Handelshauses Meyer, von den Arabern erschossen, ehe Sansibar erreicht war.
Wer würde nicht in das begeisterte Lob einstimmen, das beim Berliner Fest ein anderer großer Reisender und Völkerkundiger, Adolf Bastian, dem Gefeierten spendete, dem Dulder und Wanderer, der sieben lange Jahre hindurch gebannt gewesen sei in diesen Zauberkreis von Centralafrika, inmitten der jungfräulichen Wildnisse auf dem Grenzgebiete der großen Stromsysteme, der dort an den Grenzen des Unbekannten sinnend und spähend gewandert sei, den Eintritt zu suchen, mitten unter rings drohenden Gefahren, denen er glücklich entkommen? †
Entzündbare Gase im Magen. Im vorigen Jahre wurde in dem „British medical journal“ von einem Fall berichtet, in welchem der Magen eines Kranken Gase enthielt, welche bei der Berührung mit einer Flamme explodirten. Es handelte sich dabei um einen Mann im Alter von etwa 70 Jahren. Derselbe litt eine Zeit lang an einer Magenerkrankung, welche neben den Symptomen eines starken Katarrhs auch eine lästige Bildung von Gasen hervorrief. Oft wurden dieselben durch die Speiseröhre hervorgestoßen und verbreiteten alsdann einen sehr lästigen üblen Geruch. Eines Abends wollte der Kranke gerade seine Pfeife anzünden, als er von jenem unangenehmen Aufstoßen überrascht wurde; das Gas entflammte sich an dem brennenden Streichhölzchen und versengte dem Kranken Schnurrbart und Lippen, was ihm einen nicht geringen Schrecken einjagte. Dieser Vorgang wiederholte sich im Ganzen fünf- oder sechsmal.
Die Bildung entzündbarer Gase im Magen ist schon früher beobachtet worden. Friederich untersuchte chemisch ein solches Gasgemenge und fand in demselben außer Kohlensäure und Stickstoff geringe Mengen von Grubengas und 32,30% Wasserstoff, welcher in Verbindung mit dem Sauerstoff eine explodirbare Mischung darstellt.
Waldenburg berichtete von einem Fall, in welchem die von einem Magenkranken ausgestoßenen Gase sich leicht entzündeten und unter Erzeugung einer bläulichen Flamme verbrannten.
In einem anderen von Beatson beobachteten Falle war die Gasexplosion sogar von einem so starken Knall begleitet, daß die Frau des Kranken durch denselben erwachte. Die entzündbaren Gase entstehen ohne Zweifel durch die Zersetzung unverdauter Speisereste im Magen. *
Ein neuer Roman von Konrad Telmann. Von den jüngeren Romanschriftstellern verdient Konrad Telmann hervorgehoben zu werden, der in letzter Zeit überaus fleißig ist, ohne in das seichte Fahrwasser oberflächlicher Unterhaltungslektüre einzulenken; denn in allen seinen Romanen herrscht ein leitender Grundgedanke. Seine Novellen spielen zum Theil auf italienischem Boden und zeigen ein glänzendes Lokalkolorit. Im Ganzen liebt er eine düstere, grelle Beleuchtung. Das zeigt sich auch in seinem neuesten vierbändigen Roman „Dunkle Existenzen“ (Leipzig, Karl Reißner). Der Dichter schildert uns zwei Theologen, Vater Ringelhard und Sohn, als heuchlerische Intriganten, welche heimtückisch in das Leben der andern Hauptgestalten des Romans eingreifen: es sind dies zwei vollendete Schurken, und es ist fast des Guten zu viel, sie beide gleichzeitig auf der Bildfläche des Romans erscheinen zu lassen: der Vater geht mitten in seinen Intrigen beim Brande des gräflichen Schlosses zu Grunde, welches rebellische Gutsarbeiter angezündet hatten; der Dichter verhängt ein grausames Strafgericht über diesen verbrecherischen Scheinheiligen, und auch dem jüngeren Tartüffe wird ein tragisches Los zu Theil. Der eigentliche Held des Romans ist ein aufgeklärter junger [256] Geistlicher, Wolfgang, der durch die Kabalen der Dunkelmänner seines Amtes entsetzt wird, zuletzt aber bei einem thüringischen Fürsten eine Freistatt findet; auch sein Herz hat, nach abenteuernden Verirrungen, eine solche gefunden bei einem liebenswürdigen Mädchen.
Die eigentlichen „dunklen Existenzen“ sind nicht jene Tartüffes: es sind die Mitglieder einer geheimen Gesellschaft, der Freunde des Todes, die unter seinem Zeichen sich versammeln. Diese Gemeinde, in welcher sich auch Haschischraucher befinden, wird uns mit ihrem geistigen Kultus lebendig geschildert; alle unheimlichen Ideen der Schwarzseher, der Lebensmüden, der Verherrlicher des Nichts finden eine geistvolle Vertretung seitens der „verlorenen Leute“, der gescheiterten Existenzen. Der Held des Romans wird durch dies dunkle Reich hindurchgeführt, ohne sich darin zu verlieren.
Der Roman enthält neben einzelnen grellen Effektscenen auch anmuthende Bilder, vor Allem eine Fülle geistreicher Betrachtungen. Nur zuweilen ist der Faden zu lang, an den diese gereiht sind, und die Debatte überwiegt in einer Weise, welche die Theilnahme für die Begebenheiten und die Handlung selbst gefährdet. †
Verwendung des Gasrohrs als Baumpfahl. Die Firma Chr. Schubart und Hesse in Dresden hat neuerdings recht praktische Baumpfähle aus schmiedeeisernen Gasröhren eingeführt. Das Rohr ist an seinem unteren Ende zugespitzt und enthält hier einige Oeffnungen. Die Verwendung dieses Baumpfahls ist aus der Abbildung ersichtlich. Das Begießen geschieht derart, daß man das Wasser in die obere Oeffnung des Rohres hineingießt; es sickert alsdann durch die unterste Oeffnung direkt in das von den Baumwurzeln durchsetzte Erdreich ein.
Der Gebrauch der Ostereier ist ziemlich allgemein verbreitet. Die Sitte ist uralt, eine jener aus dem Heidenthum stammenden Ueberlieferungen, welche das Christenthum später mystisch gedeutet hat. Ursprünglich war das Osterei das Symbol der neuerwachenden fruchtbaren Natur; die Kirche deutete es in folgender Weise: das Ei ist das Symbol der Hoffnung; diese Hoffnung besteht darin, daß der Keim, der in demselben ruht, zur Welt kommen werde; oder das Gefühl, das bei der Feierlichkeit des Osterfestes, dem Gedenktag der Auferstehung Christi, erwacht, ist die Hoffnung unserer eigenen künftigen Auferstehung. Das Schenken von Ostereiern, wie es in früheren Zeiten beinahe überall und noch jetzt an vielen Orten unter Verwandten und Freunden Sitte ist, gilt als Pfand dieses religiösen Glaubens.
Unter Ludwig XIV. und XV. brachte man nach der Ostermesse Körbe mit vergoldeten Eiern zum König in sein Kabinet, der sie unter die Hofleute vertheilte. Die Eier, die sich die Vornehmen gegenseitig schenkten, waren nicht selten werthvolle Kunstgegenstände. So bewahrt das Versailler Schloß in der Antikensammlung der Bibliothek zwei Ostereier, die Madame Victoire, der natürlichen Tochter Ludwig’s XV., gehörten. Die darauf befindlichen Bilder sind von der Hand Watteau’s gemalt und stellen ein junges Schäfermädchen vor, das von Räubern angefallen, später aber von Soldaten befreit wird, welche es zu dessen Eltern heimbringen. – Der russische Kronschatz bewahrt gleichfalls ähnliche Kunstprodukte in Form von Ostereiern in Porcellan, gemalt, vergoldet und mit eingelegten Perlmutterzieraten und sinnbildlichen Inschriften verziert.
Zwei Genrebilder aus dem Leben. (Mit Illustrationen S. 249 und 253.) Wir bringen in dieser Nummer zwei frisch aus dem Leben herausgegriffene Bilder. Das erste „Bei der Arbeit“, von einem jungen talentvollen Künstler, W. Auberlen, gemalt, weist uns ein anmuthiges Mädchen, das mit Handarbeiten beschäftigt ist, und macht den Eindruck eines nach der Natur gemalten Portraits. Das Bild zeigt eine schöne Lichtwirkung und eine sorgfältige Behandlung des Details, wie der Nähutensilien und Blumen. Das Ganze ist ein durchaus ansprechendes Interieur.
Das zweite „Belauschte Liebe“ gehört ganz der freien künstlerischen Erfindung an. Der würdige Rentier, der dort hinter seinen Blumen hervorlauscht, möchte gern wissen, was unten bei dem Rendez-vous auf der Bank vorgeht; er hat den Frühling des Lebens und der Liebe weit hinter sich; aber er ist neugierig, was sich zwei Glückliche zu sagen haben. Doch wenn der Schwerhörige auch die Worte nicht vernimmt: der junge Nachbar Schmied, der am hellen Tage seine Arbeit und sein Handwerkszeug bei Seite gelegt hat, läßt über seine Absichten keinen Zweifel übrig. Will er doch dem anmuthigen Mädchen den Brautring an den Finger prakticiren, und dies kühne Unternehmen scheint auf keinen Widerstand zu stoßen. Der Rentier wird also von einem wichtigen Ereigniß zu berichten haben, und es bleibt nur, im Interesse des ungestörten Glückes der Liebenden, zu wünschen übrig, daß er nicht im Eifer, einige Worte des Dialogs aufzufangen, einen oder den andern Blumentopf vom Fenster herunterstößt und das plaudernde Paar durch einen plötzlichen Knalleffekt aus allen seinen Himmeln wirft. †
Allerlei Kurzweil.
Jedes der nachstehenden Wörter ist durch Versetzung der Buchstaben in ein anderes Wort zu verwandeln. Die Anfangsbuchstaben der neugebildeten Wörter, der Reihe nach zu einem Wort verbunden, nennen eine bekannte Persönlichkeit.
Die durch Versetzung der Buchstaben zu verwandelnden Wörter sind: Traben, Kain, Falsch, Saum, Latona, Herder, Schiene, Talk.
Kleiner Briefkasten.
P. H. in Breslau. Ihr Gewährsmann hat durchaus Recht. Es giebt in der That transportable Krematorien, das heißt fahrbare Feuerbestattungsöfen. In Nr. 8 der „Neuen Flamme“, einer Zeitschrift zur Förderung der Feuerbestattung, befindet sich eine Abbildung des Wagen-Feuerbestattungsapparates, welchen Kapitän Domeniko Rey zu Alessandria konstruirt hat. Die Anhänger der Feuerbestattung treten darum für die Einführung dieser Neuerung ein, weil durch dieselbe die Kosten bedeutend ermäßigt werden. Der Transport des Wagens ist billiger als der eines Sarges mit der Leiche. So betrugen z. B. sämmtliche Transport- und Feuerbestattungskosten in einem Falle, wo der Wagen auf eine Entfernung von 96 Kilometer von Mailand transportirt werden mußte, nur 60 Mark, während eine Leichenbeförderung von Wien nach Gotha nebst Verbrennung in dem dortigen Krematorium zur Zeit etwa 800 Mark kostet.
B. H. in Wien. Der Trabersport ist allerdings in Amerika am meisten ausgebildet, und die amerikanischen Traber sind den russischen überlegen. So viel wir wissen, ist das schnellste Tempo eines amerikanischen Trabers mit 2 Minuten 11¼ Sekunden angegeben worden, das heißt, das Pferd legte in jener Zeit im Trabe eine englische Meile zurück. Die Königin des Traberturfs ist jetzt Maud S., welche sich im Besitz von Rob. Benner in New-York befindet. Vor Kurzem sollen ihm für dieselbe 100 000 Dollars (gleich 420 000 Mark) geboten worden sein.
B. in K. Um ein Zimmer gründlich zu lüften, genügt es durchaus nicht, die unteren Fensterflügel zu öffnen. Die verdorbene, wärmere Luft sammelt sich an der Zimmerdecke und man muß darum den oberen Fensterflügel öffnen. Die Konstruktion unserer Fenster ist leider derart, daß es recht umständlich ist, auf diese Weise für die Ventilation zu sorgen. Die Rouleaustangen bilden ein lästiges Hinderniß für das Oeffnen der oberen Fensterflügel. Wir rathen Ihnen darum, eine der obersten Scheiben in eine sogenannte Glasjalousie verwandeln zu lassen. Durch einen Zug an der herabhängenden Schnur können Sie die Jalousie nach Belieben öffnen oder schließen.
R. R. in Neustadt a. O. Wie viel elektrische Lampen jetzt auf der ganzen Welt leuchten, das können wir Ihnen nicht sagen. Die Zeiten sind längst dahin, wo alle elektrischen Beleuchtungsanlagen als Seltenheit aufgezählt werden konnten. Einen Begriff von der Verbreitung des elektrischen Lichtes möge Ihnen die Mittheilung geben, daß in den Vereinigten Staaten von Nordamerika allein gegen 400 000 Edisonlampen im Betrieb sind. Dies entspricht einem Konsum an Leuchtgas von 1 630 000 Kubikmeter für den Tag. In Berlin befinden sich zur Zeit 20 900 Glühlampen in Thätigkeit.
P. R. in Berlin. Sie fragen, ob auch bisweilen Preise für wissenschaftliche Arbeiten ausgesetzt werden? Das ist erst neuerdings geschehen. Herr Privatmann Jenny in Dresden hat 10 000 Mark zu einer „August Jenny-Stiftung“ gegeben, deren Zweck die wissenschaftliche und litterarische Förderung und Verbreitung der Lessing’schen Anschauungen über die Erziehung des Menschengeschlechtes ist. 1500 Mark resp. 1000 Mark werden für die beste, resp. zweitbeste Abhandlung ausgesetzt, welche die letzten sieben Paragraphen in Lessing’s Schrift „Die Erziehung des Menschengeschlechts“ mit der Tendenz der eindringlichsten, überzeugenden Vertheidigung ihres Inhalts behandelt, und 2500 resp. 2000 Mark für die beste, resp. zweitbeste Erzählung von gleicher Tendenz. Die Erzählungen sollen in Bezug auf Geist, Komposition und Sprache litterarische Kunstwerke sein.
E. F., St. Petersburg. Nicht verwendbar; die Manuskripte stehen zu Ihrer Verfügung.
S. M. in Frankfurt a. M. Wir bitten um Angabe Ihrer genauen Adresse.
F. F. in Zürich. Nicht geeignet. Besten Dank!
Inhalt: Götzendienst. Roman von Alexander Baron v. Roberts (Fortsetzung). S. 237. – Orientalische Sprüche. S. 243. – Deutsche Städtebilder. Stuttgart. Von Oberstudienrath Dr. J. Klaiber. S. 244. Mit Illustrationen S. 240, 241, 244, 245, 246 und 247. – Herzenskrisen. Roman von W. Heimburg (Fortsetzung). S. 248. – Das erste Jahr im neuen Haushalt. Eine Geschichte in Briefen. Von R. Artaria. IV. S. 253. – Blätter und Blüthen: Chamisso-Büste. S. 254. Mit Illustration S. 237. – Lieder von Martin Greif. S. 255. – Ein heimgekehrter Afrika-Reisender. S. 255. – Entzündbare Gase im Magen. S. 255. – Ein neuer Roman von Konrad Telmann. S. 255. – Verwendung des Gasrohrs als Baumpfahl. Mit Abbildung. S. 256. – Der Gebrauch der Ostereier. S. 256. – Zwei Genrebilder aus dem Leben. S. 256. Mit Illustrationen S. 249 und 253. – Allerlei Kurzweil: Bilder-Räthsel. S. 256. – Metamorphosen-Räthsel. S. 256. – Kleiner Briefkasten. S. 256.
- ↑ Zur Annahme von Beiträgen ist bereit die Depositenkasse der Deutschen Bank, Berlin W Mauerstr. 29, und die Wechselstube der Bank für Handel und Gewerbe, Berlin W 3 Schinkelplatz.