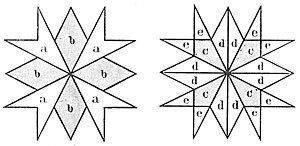Die Gartenlaube (1892)/Heft 12
Der Klosterjäger.
(4. Fortsetzung.)
Herr Heinrich schaute lächelnd empor in das endlose Blau, dann fuhr er mit einem ernsten Blick auf Pater Desertus fort:
„Als der Falter meinen Augen entschwunden war in der goldigen Luft, da kam es über mich … ich wußte nicht wie. Mir war, wie wenn Gottes Stimme mir geboten hätte: Steh’ auf und lebe! Ich erhob mich, wusch meine Wunden und kühlte sie mit Balsam. Wie ein Träumender trat ich aus dem Kloster und wanderte hinaus in das herrliche Thal. Die Sonne spann in den Lüften, silberne Fäden flogen und der Laubwald leuchtete in den bunten Farben des Herbstes. Die Kinder liefen auf mich zu und küßten meine Hände – ach, wie traulich blickten ihre lieben Augen zu mir auf! Alle Felder waren belebt, überall hörte ich Lachen und Gesang. Und als ich heimkehrte in das Kloster, trat ich vor Herrn Conrad von Altentann, meinen Propst, und sagte. ‚Gebt mir Arbeit!‘ Ach, die Tage, die nun kamen! Ich zog wie ein Roß, das des langen Stehens im Stalle müd’ geworden ist. Ueberall griff ich zu. Ich ordnete und mehrte das Gut meines Klosters, hob den Salzbau, war Fischmeister, Kellermeister, Wildmeister, alles in einem – wo immer nur ein anderer müde wurde, trat ich an seine Stelle; und alles wandelte sich mir zur Freude! Ich milderte die Strenge meines Oberen, versöhnte die grollenden Landsassen, half, wo zu helfen war … und je mehr ich den Menschen helfen durfte, desto mehr begann ich, sie zu lieben. Ihr Dank, Dietwald, hat mich das Lächeln gelehrt! Und keinen schloß ich aus … meinen Bruder stützte ich in schwerer Noth, die Kinder jenes Weibes hob
[358] ich aus Elend empor zu freundlichem Leben und meinem Fürsten, welcher Kaiser geworden ist, diene ich mit der ganzen Treue meines Herzens. Sage, Dietwald ... war es nicht eine Gotteslehre, die mir der Falter gab, da er emporflog in das Blau: ‚Willst Du den Himmel finden, dann geh’ in die Sonne!‘ Das thu’ ich, Dietwald ... ich suche am Leben die Sonne, und in den unvermeidlichen Schatten trag’ ich die Helle, so gut ich es vermag. Da fließt mir nun jeder Tag wie eine schöne Gabe Gottes. Ich freue mich jeder Blume, die auf meinem endenden Wege blüht ... wenn auch ein attderer sie pflücken mag! Und schickt mir Gott mit aller Freude zuweilen auch einen Schmerz, dann trag’ ich ihn und such’ ihn zu verwinden. Aber ich frage nicht, warum ich leide.“ Er legte die Hand auf des Paters Schulter und fügte lächelnd bei: „Daß ich leide, das genügt mir! Homo sum, Dietwald – ich bin ein Mensch!“
Pater Desertus hatte das Haupt an die Mauer seiner Klause gelehnt, hielt die Hände im Schoße gefaltet, und während er durch die leise schwankenden Zweige der Buchen, an denen die Blättchen schüchtern sproßten, emporblickte zum blauen Himmel, perlten die Thränen über seine bleichen Wangen – die ersten Thränen nach langen Jahren.
Herr Heinrich schwieg eine Weile. Dann sagte er: „Verzage nicht, Dietwald ... auch Dein Falter wird noch fliegen! Flog er in fünfzehn Jahren nicht, gieb acht, er fliegt im nächsten!“
„Fünfzehn Jahre!“ glitt es leise von des Paters Lippen. „Und mir ist, als war’ es gestern gewesen, als läge dazwischen nur eine einzige Nacht, eine lange, bange, grauenvolle Nacht, nach welcher kein Tag mehr kommen will!“ Und jählings die Hände des Propstes fassend, rief er in heißem Flehen. „Ach, Herr Heinrich, lasset mir Eure Hände, hebet mich empor zu Euch ... dorthin, wo Sonne ist! Seht mich an ... ich habe doch gekämpft und gerungen, bis alle Kräfte mir versiegten ... und ich fand ja auch Stunden ruhiger Ergebung. Und als Ihr erkanntet, daß die Enge der Zelle mich erdrückte, und als Ihr mich hierhergesandt in diese herrlichste Kirche Gottes, da ward es still in mir, während der Föhn mich umrauschte und draußen im See mein Einbaum gegen die Wellen kämpfte. Und nun alles wieder verloren!“ Seine Augen glühten und seine Stimme verlor sich in dumpfem Murmeln. „Verloren – seit vier Tagen! Und Pein ist, was ich fühle, Sehnsucht, was ich denke, Verlangen, was ich sinne! Ein Gespenst ist mir erschienen ...“
Herr Heinrich erschrak. „Dietwald!“
„Ein Gespenst, wie aus der Asche gestiegen ... und dennoch Fleisch und Blut, mit meines Weibes Haar, mit meines Weibes Augen, mit dem holden Kindermund, der mir gelächelt in Liebe ...“
„Dietwald!“ Herr Heinrich sprang auf und rüttelte den Arm des Paters. „Deine Sinne taumeln und Dein Geist ist krank. Was Dir das Herz erfüllt, tritt in die Lüfte. So fing es bei vielen an ... Einer wurde heilig und hundert wurden Sünder, eidvergessene Schelme! Greife nach einem Halt oder Du bist verloren! Ich muß Dir Arbeit geben. Die Angel zu ködern für Hecht und Ferch, das taugt Dir nicht!“
„Herr!“ stammelte Pater Desertus. „Ich soll fort von hier?“
„Höre mich an! Kaiser Ludwig will mit dem Papst verhandeln. Es zwingt ihn die Noth. Und er will einen Priester senden, doch einen, der ein deutsches, ritterliches Herz unter seiner Kutte trägt. Er fragte mich um Rath ... ich hatte an Dich gedacht. Nun will ich, daß Du gehst! Und ich hoffe, daß ich mich in Dir nicht täuschte!“ Herrn Heinrichs Worte klangen, als schlüge Stahl auf Stein.
Ueber das Antlitz des Paters rann eine dunkle Röthe; er richtete sich stolz empor. „Wann soll ich reisen, Herr?“
„Du wirst es erfahren! Und in andere Luft sollst Du mir noch heute – in kühlende Gletscherluft! Begleite mich! Was stehst Du noch? Rasch, Dietwald, rasch! Schürz’ Deine Kutte, nimm das Griesbeil und den Basthut!“
Pater Desertus trat in die Klause.
Herr Heinrich blickte ihm nach mit sorgenvollen Augen. „Gespenster sieht er? Warte nur, wir wollen sie jagen!“
Zur Bergfahrt gerüstet, kehrte Pater Desertus zurück.
Als sie den Wildbach entlang gingen, kamen sie zu einer Stelle, an welcher sich über moosigem Grunde eine Bucht mit spiegelndem Wasser gebildet hatte.
„Herr Heinrich!“ sagte Pater Desertus und deutete in das Wasser.
„Was soll ich sehen?“
„Diese beiden ... der eine trägt das Kleid der Kirche, der andere das Lederwams, die Armbrust und das Weidgehenk. Welcher von den beiden ist der Priester?“
Herr Heinrich lächelte. „Ich sehe nur zwei Menschenköpfe ... der eine grau, der andere noch schwarz!“
Und dem Pater voran überschritt er sicheren Ganges den schwankenden Steg.
Bei Einbruch der Dämmerung erreichten die Bergfahrer das Steinthal in der Röth’. Sie hatten im Almenwald die Bärenfährte auf dem Steig gefunden und dieselbe, obwohl sie auf dem aaberen Waldgrund nur mühsam zu erkennen war, über eine Stunde weit verfolgt – Pater Desertus allen anderen voran. Ein übles Los hatte Frater Severin dabei gezogen: er fand den Muth nicht, allein auf dem Steig zu warten, bis die anderen zurückkämen; und so trollte er seufzend und keuchend hinten nach, über Felsblöcke und Wurzelknorren, über Steinlöcher und Windbrüche.
Die Richtung der Fährte versprach Herrn Heinrich keine Jagd; der Bär hatte sich thalwärts gegen den See gewendet.
Als der Propst, Herr Schluttemann und Pater Desertus den Steig wieder erreichten, mußten sie geraume Weile auf Frater Severin warten. Als er endlich kam, fand Herr Heinrich in des Fraters Aussehen alle Ursache, um zu sagen: „Bruder, ich schätze Dich schon um fünf Pfund leichter. Gelt, das ist gesünder, als im Kellerstüblein hocken und die neuen Fässer kosten!“
„Wenn Ihr es sagt, muß es wohl wahr sein!“ klagte Frater Severin und suchte an dem Kuttenärmel ein noch trockenes Flecklein für seine Stirne. Im Weiterschreiten sandte er einen jammervollen Blick zum Himmel und seufzte: „Das Kellerstüblein!“ Wie war es dort so schon, so kühl! Und durch die offene Thüre sah man den schier endlosen Keller mit den vom Zwielicht umwobenen Fässern, welche in Reih’ und Glied lagen, eine stattliche Armee von Sorgenbrechern. Besaß doch das Stift Berchtesgaden in der Umgebung von Krems und Klosterneuburg zahlreiche Weingüter: im Tailland, auf der Frechau, zu Oberndorf, Eisenthür, Armstorf, Wank, Sattelsteig, Mörtal, Rechberg und Stein! Frater Severin war in keiner Litanei so sattelfest wie in der Kunde dieser seinem Ohr so lieblich klingenden Namen. „Rechberg und Stein!“ Das Beste hob er sich immer für zuletzt auf; und der Klaug dieser beiden Worte stimmte ihn so träumerisch, daß er, des Weges nimmer achtend, über ein Felsloch stolperte und seine Nase nur noch mit knapper Noth vor einem unsanften Kuß der Mutter Erde bewahrte. Wie eine Erlösung aus dem Fegefeuer begrüßte er bei Einbruch der Dämmerung den Anblick der beiden Jagdhäuser.
Da hielt Herr Heinrich, der berggewohnten Ganges den anderen voranschritt, plötzlich an. „Mir ist, als hätt’ ich einen Ruf gehört!“
Sie blieben alle stehen und lauschten. Deutlich tönte es von der Höhe des Steinthales hernieder, von dort her, wo die Hütten standen, mit langgezogenem, angstvollem Ruf. „Hoidoooh!“
„Eine Mädchenstimme!“ sagte Pater Desertus. „Und sie klingt wie der Schrei eines verzweifelnden Herzens!“
„Dort oben ist jemand in Noth! Lasset uns rascher ausschreiten! Vorwärts! Vorwärts!“ befahl Herr Heinrich.
Als sie eine gute Strecke weiter emporgekommen waren, klang abermals der Ruf: „Hoidoooh! Hoidoooh!“ Trotz der Dämmerung nahm Herr Heinrich mit seinem scharfen Auge auf vorspringendem Fels unfern der Jagdhütte das rufende Mädchen wahr. Er höhlte die Hände um den Mund und gab den Ruf zurück.
Das Mädchen mußte ihn vernommen haben, denn sie hörten einen schluchzenden Schrei, wie in Freude und doch in Jammer, und dann, vom Winde herabgetragen, die gellenden Worte: „Leut’, Leut’! Um Gotteswillen ... da her, da her! Hoidoooh!“
„Diese Stimme!“ murmelte Pater Desertus. „Ich habe sie schon gehört!“ Und den anderen voran eilte er, so rasch es der steile Weg gestattete, durch die Senkung des Thals empor.
Herr Heinrich hielt sich nahe hinter ihm, Herr Schluttemann blieb keuchend zurück, Frater Severin rang athemlos die Hände und fiel auf einen Steinblock nieder.
Als Pater Desertus den Fuß der letzten Höhe erreichte, kam Gittli mit jammernden Worten ihm entgegengestürzt.
„Sie ist es!“ stammelte er und drückte, den Schritt verhaltend, die zitternde Hand auf seine Brust.
Nun stand sie vor ihm; wirr hingen ihr die Haare um das bleiche, von verzweiflungsvoller Angst verstörte Gesichtchen. Sie wollte sprechen, da erkannte sie ihn und erschrak. Sie machte eine Bewegung, als hätte sie fliehen mögen, aber die Sorge um jenen [359] Anderen bannte in ihr die Furcht vor diesem Einen. Schluchzend fiel sie vor ihm nieder und schrie: „Helfet ihm! Helfet ihm!“
Er hob sie auf. „Wem soll ich helfen? Rede, Mädchen, rede doch!“
Da klang Herrn Heinrichs Stimme: „Was ist geschehen?“
Gittli entwand sich den Händen des Paters, eilte dem Propst entgegen, umklammerte seine Hand, und während sie ihn schon mit sich fortzog, der Jagdhütte zu, schluchzte sie: „Ach, guter, lieber Herr, schauet, ich bitt’ Euch, helfet ihm, helfet ihm, er muß versterben!“
„Wer, Mädchen, wer!“
„Der Haymo, der Haymo!“
„Mein Jäger! Was ist mit ihm? Ist er gestürzt?“
„Nein, nein, viel ärger noch! Es hat ihn ...“ Ihre Stimme erlosch – sie durfte ja nicht reden, sie hatte geschworen! „Ich weiß nicht, weiß nicht ...“ schrie sie auf, „ich hab’ ihn gefunden ... und hab’ ihn heimgebracht ... gestern ... und er hat so gut geschlafen die ganze Nacht, und heut’ in der Früh’, da hat er noch gern genommen, was ich ihm gekocht hab’ ... zu Mittag aber, da hat er angefangen, hat schiech geredet, hat um sich geschlagen, und allweil hat er aufspringen und fort wollen ... ach, ich hab’ gebittet und gebettelt, daß er s[till?] halten soll und den Arm nicht rühren ... und schauet, mit zwei Händ’ hab’ ich ihn heben und zwingen müssen ... und nachher auf einmal ist er weggefallen, daß ich schon gemeint hab’, er verlischt wie ein Lichtl ... und so liegt er noch allweil ... und einmal war ich bei ihm und das andermal wieder bin ich hinausgelaufen und hab geschrien und geschrien, weil ich gemeint hab’, es müßt’ und müßt’ einer kommen! Ach, was hab’ ich ausgestanden!“
Sie hatten die Hütte erreicht; Gittli eilte voran, Herr Heinrich und Pater Desertus folgten. Auf dem Herde brannte ein flackerndes Feuer.
„Schauet doch her,“ weinte Gittli, „da liegt er und thut kein Rührerl nimmer!“
Herr Heinrich trat an das Lager. „Licht, Dietwald, Licht!“ Pater Desertus riß ein zur Hälfte brennendes Scheit aus dem Feuer und hob es über das Heubett. Während Herr Heinrich sich über den Kranken beugte und ihn zu untersuchen begann, zog sich Gittli scheu in einen Winkel zurück, dort stand sie mit angstvoll blickenden Augen, die zitternden Hände an den Lippen.
„Was ist das? Ein Wundverband?“ Herr Heinrich richtete sich auf. „Hast Du ihn angelegt?“
„Ja, Herr ... er hat doch geblutet!“
Jetzt stolperte Herr Schluttemann keuchend über die Schwelle. „Was giebt’s? Alle Wetter! Was giebt’s? Was giebt’s?“
„Seht nach, Herr Vogt, ob unsere Leute noch nicht kommen,“ sagte Herr Heinrich. „Ich brauche das Kästlein mit Verband und Balsam.“
„Was fehlt dem Bursch?“
„Das werdet Ihr erfahren, wenn ich selbst es weiß. Geht!“
Herr Schluttemann machte ein schiefes Gesicht und verschwand. Herr Heinrich beugte sich wieder über Haymo. „Er schläft,“ sagte er nach einer Weile zu Pater Desertus, „sein Herzschlag ist matt, aber ruhig, sein Athem gleichmäßig. Er mag einen schweren Anfall von Wundfieber überstanden haben und liegt nun in der Betäubung der Schwäche. Ich sehe keine Gefahr.“
Gittli faltete die Hände und rührte stumm die Lippen.
„Du dort, komm’ her!“ rief Herr Heinrich ihr zu. „Wie heißt Du?“
„Gittli!“
„Komm’ her, Gittli! Umd sag’ mir, was Du alles gethan hast zu seiner Hilfe.“
Zögernd kam sie näher, und nun erkannte er sie. „Warst Du nicht vor einigen Tagen beim Vogt? Du bist die Schwester Wolfrats, des Sudmanns?“
Gittli zuckte zusammen.
„So komm’ doch näher und rede! Was hast Du für meinen Jäger gethan?“
Mit zitternden Händen an ihrem Röcklein nestelnd, die Augen zu Boden gesenkt, so gab sie mit stockenden Worten Bericht. Aufmerksam hörte Herr Heinrich zu, und Pater Desertus hing mit den Augen wie gebannt an Gittlis Zügen.
Als sie geendet hatte, blickte sie mit scheuer, stummer Frage zu Herrn Heinrich auf, als wollte sie sagen: „Hab’ ich auch nichts schlecht gemacht?“
Da kam Herr Schluttemann zurück. „Die Leute sind da, Reverendissime, hier ist das Kästlein!“
Herr Heinrich nahm es. „Erwartet mich draüßen und laßt mir niemand in die Hütte. Frater Severin ...“
„Er ist noch immer nicht da.“
„Wenn er kommt, soll er rasten und Athem schöpfen, dann soll er die Herrenhütte in stand setzen. Der Walti mag hier bleiben, die vier Knechte sollen in den Almhütten nächtigen und morgen beizeiten wieder hier sein!“
Herr Schluttemann ging, und man hörte, wie er draußen die Knechte anschrie, als hätten sie Wunder was verbrochen. „Und morgen vor Tag seid Ihr wieder da!“ schloß er sein donnerndes Kapitel. „Oder ich reiß’ Euch die Ohren vom Kopf weg ... wurzweg!“
Herr Heinrich entnahm dem Kästlein, was er brauchte, um einen neuen Verband zu legen. Als er die mit Harz verklebte Leinwand von der Wunde löste, streckte sich Haymo stöhnend, schlug die Augen auf und schloß sie wieder.
„Dietwald, sieh her,“ rief Herr Heiurich erregt, „das ist keine Wunde, wie ein fallender Stein sie schlägt oder wie man sie bei einem Sturz erhalten kann. Das ist ein Stich, ein Messerstich! Der Mann ist überfallen worden, man wollte ihn morden! Das hat ein Raubschütz gethan, den der Jäger fassen wollte! Mädchen, komm’ her zu mir!“
Gittli zitterte an allen Gliedern.
„Aber so komm’ doch! Sag’ mir, wo hast Du ihn gefunden?“
„Draußen,“ stotterte sie mit versagender Stimme, „vor der Hütte.“
„Weit von hier?“
Sie schüttelte das Köpfchen.
„Und wie kam es, daß Du ihn fandest?“
Rathlos und angstvoll schaute sie zu Herrn Heinrich auf.
„Aber so rede doch! Ich will wissen, was Dich zu der Stelle führte, an der Du ihn fandest. Was hattest Du hier oben zu schaffen?“
Sie rührte lautlos die Lippen; dann plötzlich schlug sie die Hände vor das Gesicht und brach in Weinen aus.
„Ich bitt’ Euch, Herr Heinrich, quälet das Kind nicht!“ sagte Pater Desertus mit schwankender Stimme. „Ich glaube den Grund zu kennen, der sie hierher geführt hat. Gestern in der Nacht starb im Hause ihres Bruders ein Kind ...“
„Ein Kind des Wolfrat?“ Herr Heinrich ging auf das Mädchen zu. „Du wolltest Schneerosen holen ... zum Engelkränzlein? Und da hast Du den wunden Mann gefunden und bist bei ihm geblieben Tag und Nacht und hast alles für ihn gethan, was nur zu thun war?“ Er strich die Hand über Gittlis Haar. „Du bist ein braves, tapferes Mädchen! Ich will es Dir und Deinem Bruder danken!“
Gittli schluchzte laut auf, wandte sich hastig ab und wankte zur Thür hinaus. Draußen sank sie auf die Bank und weinte in heißem Kummer vor sich hin.
Walti kam herbei, zog ihr die Hände herab und schaute ihr ins Gesicht. „Je, Du bist es? Warum weinst denn?“
Sie riß sich los und schluchzte noch lauter.
„Weinst wegen dem da drin? Geh’, Du bist dumm! Der hat einen Gesund’ wie ein Trumm Eisen. Und wenn’s ihm auch ein bißl weh thut, ... Du spürst es ja nicht!“ Er lehnte sich an die Hüttenwand und gähnte. Da sah er dicken Rauch aus dem Dach der Herrenhütte qualmen. „Schau’, schau’! Der Frater feuert schon! Du! Da werden gute Sachen gekocht!“ Er schnalzte mit der Zunge. „Meinst? Kriegen wir auch was?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, schlich er zur Herrenhütte und spähte durch die Thür.
Der Eingang führte in eine geräumige Küche mit offenem Herd; daneben lag ein kleines Herrenstübchen, dessen einfaches Geräth aus dem röthlichen Holz der Zirbelkiefer gefertigt war, und die Schlafkammer mit zwei Heubetten. Von der Küche stieg man über eine Leiter zum Bodenraum, auf welchem Bergheu in genügender Menge aufgeschüttet war, um im Nothfall für ein halbes Dutzend müder Schläfer weiche Lagerstatt zu bieten.
Neben dem Herd, auf dem ein helles Feuer brannte, stand Frater Severin; er hatte die Aermel der Kutte aufgestülpt, eine weiße Schürze vorgebunden und war damit beschäftigt, ein „Spießchen Schwarzreiter“[1] zu putzen, welche, mit Eiern übergossen [360] und am jähen Feuer rasch gebacken, für den Abendtisch einen köstlichen Imbiß gaben.
Auf den Stufen vor der Thüre des Herrenstübchens saß Herr Schluttemann, nachdenklich, mit gesträubtem Schnauzbart, grimmig die Augen rollend. Die Geschichte mit Haymo war für ihn eine Nuß, welche zu beißen gab. Aber als wäre er des zwecklosen Grübelns müde, schüttelte er auf einmal schnaubend das Haupt, fuhr mit den Fäusten durch die Luft und platzte los: „Teufel! Teufel!... Wenn ich denke, daß ich jetzt drunten im Kellerstüblein säße!“
„Mit Pater Hadamar und dem Küchenmeister,“ schmunzelte Frater Severin, „bei Rechberg und Stein!“
„Höret auf, höret auf,“ stöhnte Herr Schluttemann, „ich kann’s nicht hören, es reißt mir die Seel’ aus dem Leib’!“ Dann wieder in grimmige Melancholie versunken, fragte er: „Es ist doch wohl gesorgt für unseren Durst?“
Frater Severin zuckte die Achseln. „Wie es Herr Heinrich anbefohlen hat! Fünf Tage sollen wir bleiben ... zehn Flaschen sind befohlen ... rechnet Euch aus, wieviel auf einen trifft!“
„Verflucht wenig!“ meinte Herr Schluttemann mit langem Gesicht. „Frater! Frater! Mir wird die Leber brandig werden ... ich kann das Wasser nicht vertragen! Aber schon gar nicht!“
Frater Severin betrachtete den unglücklichen Vogt mit zwinkernden Aeuglein, dann leckte er die von den Schwarzreitern fettgewordenen Finger ab, trat auf ihn zu und flüsterte ihm ins Ohr: „Habt Ihr den Korb nicht gesehen, den der Walti getragen hat?“
„Ja! Warum?“
Frater Severins Miene wurde immer geheimnißvoller. „Und habt Ihr’s nicht scheppern hören in dem Korb?“
Herr Schluttemann legte den Kopf auf die Seite und zeigte das Weiße in den Augen. Ein schüchternes Lichtlein der Hoffnung schien in seiner trostlos finsteren Seele aufzudämmern.
„Redet, Frater, redet, was hat gescheppert?“
„Heimliche Flaschen Rechberg und Stein. Hinter der Hütte liegen sie in kühler Erde vergraben, und wenn Herr Heinrich schlummert, dann holen wir uns einige Pärchen!“
„Frater Severin ... Ihr seid ein Heiliger!“ schrie Herr Schluttemann auf und wollte dem Frater um den Hals fallen.
Der aber schob ihn von sich. „Nicht so laut, Herr Vogt!“ flüsterte er und schielte nach der Thüre. „Herr Heinrich könnt’ uns hören!“
Des Fraters Sorge war unbegründet. Herr Heinrich weilte noch immer in der Jägerhütte. Er hatte einen neuen Verband auf Haymos Wunde gelegt und den Arm in einer Schlinge befestigt, damit nicht etwa eine ungestüme Bewegung des Schläfers eine neue Blutung hervorrufe. Nun blickte er suchend umher.
„Wo ist das Mädchen?“
Pater Desertus ging mit raschem Schritt zur Thüre. Vor der Hütte saß Gittli auf der Bank; ihre Thränen waren versiegt; mit verlorenen Blicken starrte sie hinaus in die sinkende Nacht. Pater Desertus berührte ihre Schulter. Sie fuhr erschrocken zusammen und erhob sich.
„Komm’, Gittli, Herr Heinrich fragte nach Dir!“ Er nahm ihre Hand und führte sie in die Stube.
„Nun, willst Du nicht sehen, wie es Deinem Pflegling geht?“ sagte der Propst. „Komm’ her ... sieh nur, wie gut und ruhig er schläft!“
In wortlosem Danke wollte sie Herrn Heinrichs Hände küssen.
„Laß doch, Du Kind!“ sagte er. „Ich habe zu seiner Rettung das Mindeste gethan. Haymo wäre ein verlorener Mann gewesen ... ohne Dich! Er hat es Dir allein zu danken, daß er nun leben wird.“
Ein Seufzer, heiß und freudig, schwellte Gittlis Brust. Mit leuchtenden Blicken hing sie an Haymos blassen Zügen; dann fuhr sie mit zitternder Hand über die feuchten Augen und wandte sich zur Thüre.
„Wohin willst Du?“ fragte Herr Heinrich.
„Jetzt braucht er mich ja nimmer!“ lispelte sie. „Heim will ich gehen.“
„Es ist finstere Nacht!“ sagte Pater Desertus erschrocken.
„Ich fürcht’ mich nicht! Es ist ja sternscheinig, den Weg kenn’ ich auch, und auf der Almen kann ich ja nächtigen.“
„Dort schlafen die Knechte,“ warf Herr Heinrich ein; dann lächelte er. „und denke nur, wenn Haymo morgen erwacht und fragt nach Dir, was sollen wir ihm sagen? Willst Du nicht bleiben?“
„Wenn ich darf!" stammelte sie. „Schauet, Herr, ich nehm’ ja doch keinem seine Liegerstatt weg ... ich setz’ mich halt dort auf den Herd.“
Sie wollte in ihren Winkel schleichen, aber Herr Heinrich rief sie noch einmal zurück. „Gittli,“ sagte er mit freundlicher Stimme, „Du bist ja doch kein Kind mehr, Du solltest nicht so herumlaufen.“ Er deutete auf ihre Arme, welche bis über die Schultern nackt waren, und auf einen Riß, der in ihrem Linnen fast bis zum Gurte des Rockleins ging.
Sie schaute ihn mit großen Augen an. „Ich hab’ mir die Aermel weggerissen, weil ich das Leinen gebraucht hab’, für ihn.“
Da ging er auf sie zu, legte ihr die Hand auf den Scheitel und sagte leise in lateinischer Sprache. „Auch in Deiner Blöße wirst Du Gott gefallen.“ Und zu Pater Desertus sich wendend, fuhr er gleichfalls auf lateinisch fort: „Kann eines Fürsten Tochter reicher sein an edlen Steinen und Geschmeide als dieses Bettelkind an Schätzen des Gemüths?“
Pater Desertus schwieg; seine träumenden Augen hingen an Gittli, welche zum Herde ging, in ihre Jacke schlüpfte und sich leise in den Winkel kauerte.
Herr Heinrich war an Haymos Lager getreten und hatte seine Hand auf die Stirne des Schlummernden gelegt. „Das Fieber ist gewichen und der Schlaf wird ihn erquicken. Er hat gesundes Blut und eine gute Natur – ich hoffe, wir haben den Mann in drei Tagen wieder leidlich auf den Beinen. Ich will Wein herüberschicken, davon soll er bekommen, wenn er munter wird in der Nacht. Und Frater Severin soll bei ihm wachen.“
„Ueberlasset mir dieses Amt!“ sagte Pater Desertus mit raschem Wort. „Der Bruder ist müde.“
„Gut, so bleibe!“ Herr Heinrich reichte dem Pater die Hand, nickte Gittli mit freundlichem Lächeln zu und verließ die Stube. Zu Häupten des Lagers setzte sich Pater Desertus auf die Bank. Es war stille in der Stube. Gittli rührte sich nicht in ihrem Winkel; man horte nur Haymos tiefe Athemzüge, und auf dem Herde knisterte es zuweilen noch leise in den glühenden Kohlen.
Draußen murmelte das Wasser, von der Herrenhütte herüber klang in Zwischenräumen die laute Stimme des Vogtes, und tief aus dem Steinthal herauf tönte der Gesang der vier Knechte, welche zu den Almen niederstiegen:
„Das Herzelein
Im Herzensschrein
Thut gar so weh dem schwarzen Knaben:
Das braune Mägdlein möcht’ er haben,
Ja haben, .
Wenn man es^ ihm nur gäb’,
Ja gäb’, ja gäb’ ...“
Nach einer Weile kam Walti, um den Pater zum Imbiß zu rufen; er brachte auch einen Teller für Gittli. „Du, das ist gut!“ flüsterte er dem Mädchen zu. „Ich hab’s auch schon verkosten dürfen, und was übrig bleibt, das kriege ich alles, hat der Frater gesagt.“ Gittli richtete sich auf und begann zu essen, während Pater Desertus die Stube verließ. Als er die Herrenhütte betrat, sagte er zu Frater Severin: „Schickt ein Kisselt und eine Lodendecke hinüber für das Mädchen; das Kind hat ein hartes Lager auf den Herdsteinen.“
Nun saßen sie beim Scheine einer Kienfackel im Herrenstübchen beisammen, der Propst, Herr Schluttemann und Pater Desertus, der letztere schweigend in sich versunken, während Herr Heinrich und der Vogt die an dem Jäger verübte Unthat besprachen. Herr Schluttemann beschwor die ganze Rache seines flammenden Zornes über das Haupt des Mörders, den er finden wolle, und wenn er sich auch in den untersten Schlupf der Hölle verkrochen hätte; sobald es Tag würde, gedachte er, sich mit den Knechten auf den Weg zu machen, um in weitem Kreise rings um die Hütte jeden Busch und jede Felsschrunde zu untersuchen; ein Häklein würde sich schon finden, an welches der Faden eines Verdachtes sich anknüpfen ließe.
Als Pater Desertus in die Jägerhütte zurückkehrte, fand er Gittli schlafend im Herdwinkel. Das Kissen, das ihr Walti gebracht, hatte sie unter Haymos wunden Arm gelegt; nur die Lodendecke hatte sie für sich behalten und zum Polster geballt unter ihr Köpfchen geschoben. So lag sie, die beiden Hände unter der Wange, die müden Glieder vom Schlafe sanft gelöst; sie schien auf den harten Steinen so gut zu ruhen, als läge sie in Daunen. Die verglimmenden Kohlen strahlten einen rothen Schimmer über ihr Gesicht, so daß es aus dem Dunkel hervorleuchtete wie ein liebliches Räthsel.
Lange, lange stand Pater Desertus vor dem schlafenden Mädchen. Immer näher zog es ihn, er beugte das Knie, er
[361][362] streckte die Arme, er neigte das Antlitz in dürstender Sehnsucht ... da bewegte sich Gittli und stöhnte leise, wie unter einem schweren Traume. „Haymo ... Haymo ...“
Pater Desertus taumelte zurück; die Hände vor das Antlitz schlagend, wankte er zur Thür und sank auf die Schwelle nieder. „Herr! Herr! Du versuchest mich über meine Kräfte!“ rang es sich mit erstickter Stimme von seinen Lippen, und mit brennenden Augen starrte er hinaus in die finstere Nacht, empor zu den ruhelos flimmernden Sternen.
In den Fenstern der Herrenhütte war das Licht schon erloschen; Herr Heinrich schlief. Durch die Ritzen der geschlossenen Thüre quoll aber noch ein matter Schein; in der Küche saßen Frater Severin und Herr Schluttemann beim erlöschenden Feuer auf dem Herdrand, leise plaudernd, mit den „heimlichen Pärchen“ beschäftigt, die sie aus dem Versteck hervorgeholt hatten. Walti hockte in einem Winkel und vertilgte die Reste des Mahles; dann trank er noch einen Krug Wasser leer und kletterte uber die Leiter hinauf ins Heu.
Als den beiden Zechern „des Himmels höchste Huld“ zur Neige ging, bekam Herr Schluttemann seine üblichen „Zustände“. Er schien völlig vergessen zu haben, wo er sich befand, wähnte im Kellerstüblein zu weilen und fürchtete, daß mit jedem Augenblick die handfesten Boten der Frau Cäcilia eintreffen möchten, um ihn heimzuholen. „Aber ich geh’ nicht, wirst sehen, Bruder, ich geh’ nicht! Jetzt sitz’ ich einmal, Donnerwetter, und jetzt bleib’ ich!“ Frater Severin drückte ihm die Hände auf den Mund und zerrte ihn zur Leiter; mit aller Mühe, stoßend und schiebend, brachte er ihn endlich über die Leiter hinauf und warf ihn ins weiche Heu. „Cäcilia, Cäcilia, Du treibst es heute wieder arg mit mir!“ brummte Herr Schluttemann, halb erstickt von dem über ihn herfallenden Heu. Eine Weile lallte er noch fort, dann begann er zu schnarchen. Frater Severin folgte diesem Beispiel, und da ging nun ein Sägen um die Wette los, so daß Walti erwachte und kein Auge mehr schließen konnte; dazu hatte er bald eine Faust des Herrn Schluttemann im Gesicht, bald dessen Füße auf der Brust oder zwischen den Beinen; er verkroch sich in den äußersten Winkel, aber Herrn Schluttemanns Füße fanden den Weg zu ihm. Schließlich erhob er sich, glitt über die Leiter hinunter und legte sich auf den warmen Herd. Jetzt konnte er schlafen.
Nach Mitternacht bewölkte sich der Himmel, und ehe der Tag noch graute, begann ein warmer Regen zu fallen. Bei Anbruch der Dämmerung kamen die Knechte. Pater Desertus saß noch immer auf der Schwelle der Jägerhütte, mit bleichen müden Zügen, die Augen heiß umrändert. Als er die Knechte sich nähern sah, erhob er sich und athmete tief, wie wenn ihm die Nähe wachender Menschen willkommen wäre. Einer der Knechte fragte ihn, was sie zu thun hätten. Er meinte, sie sollten sich, da Herrn Heinrich der Pirschgang auf den Auerhahn verregnet wäre, ruhig verhalten, bis die Schläfer von selbst erwachen würden. Dann trat er in die Hütte; Gittli war schon wach, sie stand über Haymo gebeugt, der immer noch ruhig schlief; als sie den Pater kommen hörte, trat sie scheu zurück, lispelte den Morgengruß und verließ die Hütte. Nach einer Weile kam sie wieder, gewaschen, mit frisch geflochtenen Haaren; sie schürte auf dem Herde ein Feuer an und ging geräuschlos ab und zu, um saubere Ordnung in der Stube zu machen. Als sie wieder einmal Wasser holte, wurde drüben an der Herrenhütte ein Fensterladen aufgestoßen.
„Guten Morgen, Gittli!“ rief Herr Heinrich.
Sie stellte die Wanne nieder und lief hinüber.
„Nun, wie geht es ihm?“
„Er schlaft noch allweil, Herr, und ich mein’, der Schlaf hat ihm gut gethan, denn er hat schon ein bißl Farb’ im Gesicht!“
„Dann wird er wohl auch bald erwachen. Freust Dich schon?“
„Und wie?“
„Gelt und frenst Dich auch schon auf seinen Dank?“
„Den hab’ ich schon, Herr!“
„So?“
„Ja, gestern auf die Nacht, da hat er ein lützel[2] reden können, und da hat er mir gleich ein Vergeltsgott gesagt, ja!“
„Aber ich meine, Du hoffst doch wohl noch auf besseren Dank?“ lächelte Herr Heinrich, während er sich breit ins Fenster legte.
Sie schaute mit großen Augen zu ihm auf. „Was sollt’ ich denn mehr noch wollen? Ich hab’ ja mein Vergeltsgott!“
Er betrachtete sie mit freundlichen Blicken. „So? So?“ Und leise zuckte es um seine Lippen, als er sagte: „Freilich, mehr kannst Du auch nicht verlangen von ihm. Aber jetzt geh’ nur, geh’, ich komme gleich hinüber!“
Hurtig lief Gittli davon, um aus dem Regen wieder unter Dach zu kommen.
Ueber diesem Zwiegespräch war Walti aus dem Schlaf erwacht. Er rieb sich erschrocken die Augen, als er den hellen Morgen schimmern sah, kletterte die Leiter empor und rief: „Frater! Frater! Stehet auf, der Herr ist wach!“
Frater Severin fuhr aus dem Heu wie der Hase aus dem Krautacker, wenn der Bauer kommt. Er packte seinen Schnarchgenossen an der Brust. „Herr Vogt! Auf! Auf! Auf!“
Herr Schluttemann drehte sich auf die Seite. „Aber Cäcilia!“
„Auf! Auf! Auf!“
„Aber Cäcilia!“ wimmerte Herr Schluttemann. „Geht denn der Teufel schon wieder los? Alle Tag’ und alle Tag’! Nicht einmal ausschlafen soll der Mensch können. Kreuz Teufel noch einmal! Laß mich in Ruhe!“
Frater Severin schüttelte den Kopf, überließ den Vogt seinem Schicksal und stieg mit starren Beinen über die Leiter hinunter.
Herr Schluttemann hatte sich tief eingewühlt in das Heu, als umschlänge er mit seinen Armen das Kissen, das er an jedem Morgen fest über die Ohren zu drücken pflegte, wenn Frau Cäcilia ihre Predigt begann. Die lautlose Ruhe aber, die ihn plötzlich umgab, mochte ihm als etwas ganz Ungeheuerliches erscheinen. Er richtete sich erschrocken auf und starrte mit weit aufgerissenen Augen im Dämmerlicht des Heubodens umher.
„Ach so!“ stotterte er, als er das stille Wunder langsam zu begreifen begann. Dann lachte er vergnügt vor sich hin. „Jetzt kann aber geschehen was will ... jetzt schlaf ich mich einmal aus!“ Sprach’s, legte sich wieder auf die Seite und streckte sich behaglich. „Aaaah!“ Eine kleine Weile, und er schlief schon wieder.
„Herr Vogt!“ rief Frater Severin aus der Küche herauf. Herr Schluttemann aber hörte nicht.
„Vogt! Vogt! Wo seid Ihr?“ rief Herr Heinrich selbst. Doch Schluttemann hörte nicht. „So laßt ihn schlafen!“ lächelte der Propst. „Das irdische Vergessen ist über ihn gekommen!“ Er drohte zum Heuboden hinauf: „Wartet nur, Vogt, der Morgen kommt schon wieder, da Euch die Donner des Gerichtes wecken!“
Als Herr Heinrich hinüberging nach der Jägerhütte, kam ihm Gittli entgegen. „Herr, Herr! Er wachet schon!“ stammelte sie. „Mein Gott, und soviel sorgen thut er sich, Ihr könntet ihm harb sein, weil ihm so was hat geschehen können.“ Die Freude redete aus ihr, aber es war eine bange Freude: nun konnte Haymo sprechen, nun mußte er sagen, wie alles gekommen war ...
So blieb sie, als Herr Heinrich die Hütte betrat, an der Thüre stehen, Freude im Herzen, Angst in der Kehle.
Haymo saß aufgerichtet in seinem Heubett. „Herr Heinrich ..“
Der Propst legte ihm die Hand auf den Mund. „Du sollst nicht sprechen, Haymo, ich will es so! Lege Dich zurück und laß mich nach Deiner Wunde schauen! Dann sollst Du essen und trinken und wieder schlafen, und wenn Du dann gestärkt erwachst, dann setz’ ich mich zu Dir, und Du erzählst mir alles. Und mach’ Dir keine dummen Sorgen. Du bist Haymo, mein getreuer Jäger, hast ja Deine Treue mit Deinem Blut besiegelt!“
„Herr Heinrich ...“
„Wirst Du wohl schweigen?“ schalt der Propst und drückte den Jäger mit sanfter Gewalt auf das Kissen zurück.
Gittli athmete auf; und da sie in der Jägerhütte nun entbehrlich war, lief sie hinüber in das Herrenhaus.
„Frater, kann ich Euch nicht helfen?“
„Ei freilich, mein Dirnlein, schürz’ Dich, tummel’ Dich!“ Und im Hui hatte er ein Dutzend Aufträge für Gittli bereit.
Sie griff mit flinken Händen zu, trug alles herbei, was der Frater in der Küche brauchte, brachte Ordnung in die Schlafkammer und machte das Herrenstüblein spiegelblank.
Draußen „schnürelte“ der Regen, und die Knechte, die unter dem vorspringenden Dach der Herrenhütte an die Balkenwand gelehnt standen, sangen mit leisen Stimmen, um sich die nasse Zeit zu vertreiben.
Als Herr Heinrich mit Pater Desertus aus der Jagdhütte [363] trat, sagte er: „Dein Aussehen ist schlimm, Dietwald. Die Nachtwache hat Dich erschöpft.“
„Ja, Herr!“ erwiderte der Pater, mit finsterem Blick zur Erde starrend.
„Aber ich hoffe, es hat Dich in dieser Nacht Dein Gespenst in Ruhe gelassen?“
„Meint Ihr?“
„Dietwald!“
„Es weilte mit mir unter einem Dach die ganze lange Nacht!“
Herr Heinrich betrachtete den Pater mit forschendem Blick. Dann sagte er: „Komm, lege Dich schlafen, Du bist übermüdet.“
Sie betraten die Herrenhütte; Pater Desertus ging in die Schlafkammer und warf sich aufs Lager, doch seinen Augen war anzusehen, daß sie den Schlummer nicht finden würden. Herr Heinrich füllte einen Becher mit Wein und goß dazu einige Tropfen aus einem Fläschchen, das er seinem Arzneikästlein entnommen hatte.
„Trink, Dietwald, das wird Dir Schlaf bringen!“
Pater Desertus leerte den Becher ... und es währte nicht lange, so lag er, tief athmend, in traumlosem schweren Schlummer.
Herr Heinrich wollte ins Freie treten; da sah er Gittli in der Küche schaffen. Ein Gedanke schien ihn zu befallen, er schüttelte wie abwehrend das Haupt, doch immer wieder kehrten seine Blicke zu dem Mädchen zurück.
„Gittli!“
Sie säuberte die Hände an der Schürze und kam auf ihn zugegangen. „Ja, Herr?“
„Erzähl’ mir doch, hast Du Dich mit dem Pater auch gut vertragen die lange Zeit vom Abend bis zum Morgen?“
„Allweil gut!“ meinte Gittli mit scheuem Lächeln. „Der Pater hat gewachet, und ich hab’ geschlafeu!“ Und als müßte sie sich entschuldigen, fügte sie bei: „Ich bin halt so viel müd’ gewesen.“
„Immer geschlafen? Die ganze Nacht?“
„Gott behüt’, Herr! Ein paarmal bin ich schon aufgekommen.“
„Nun? Und dann habt Ihr wohl miteinander Haimgart[3] gehalten, gelt?“
„Aber Herr!“ sagte sie ganz erschrocken. „Wie thät ich mir denn einfallen lassen, daß ich haimgarten wollt’ mit so einem Herren. Ich bin allweil gelegen und hab’ keinen Muckser gethan!“
„Und er? Er wird doch mit Dir geredet haben!“
„Kein Sterbenswörtlein! Ich glaub’, er hat mich gar nicht gesehen. Mein, allweil ist er gesessen und hat blinde Augen gemacht, als thät er einwendig schauen.“
„Einwendig schauen?“ wiederholte Herr Heinrich und nickte vor sich hin. „Aber sag’, hast Du ihn schon öfters gesehen?“
„Zweimal, Herr! Das erste Mal drunten am Seesteig ...“ sie stockte, denn sie durfte Herrn Heinrich doch nicht sagen, welchen Schreck sie damals vor dem „Schwarzen“ empfunden hatte ... Schreck und Furcht vor einem Gottesmann! Leise sprach sie weiter. „Und das andermal ... am Ostertag.“ Da kamen ihr die Thränen.
„Was hast Du, Gittli, warum weinst Du?“
„O mein Gott, schauet, Herr, er ist ja dazugekommen, wie unser Kindl hat verscheinen müssen, unser liebes, gutes Kindl.“
„Komm, Gittli, komm, setz’ Dich!“ Er führte sie zu einer Bank. „So! Und jetzt sag’ mir, wie war es mit dem Kindl?“
Unter Thränen erzählte sie in ihrer schlichten, rührenden Weise das kleine, traurige Geschichtlein von „Mimmidatzis“ kurzem Leben. „Schauet, Herr, wie ein Lichtkäferl ist das Kindl gewesen in unserem Sorgenhäusl, wie ein Blümerl im Winter, und in aller Herzensnoth wie ein Stückel ewigen Brots, von dem man allweil hat zehren können, und es ist doch nicht weniger worden. Und jetzt hat’s verscheinen müssen! Warum denn, warum?“
Frater Severin klapperte am Herd mit seinen Pfannen; ein Zittern war ihm in die Hände gekommen; auch mußte ihm was ins Auge geflogen sein, denn er wischte immer und wischte – aber es wollte nicht helfen.
Herr Heinrich hielt die Hände des Mädchens gefaßt und blickte tief bewegt in Gittlis Gesicht, das von Thränen überströmt zu ihm emporgerichtet war, wie einer tröstenden Antwort harrend.
Hätte nicht das Feuer geknistert, der Regen über dem Schindeldach geplätschert und Herr Schluttemann auf dem Heuboden geschnarcht, es wäre ganz, ganz stille gewesen in der Küche.
„Warum? Ja, warum?“ Herr Heinrich setzte sich an Gittlis Seite. „Das fragst Du? Das weißt Du nicht? So ein kluges Dirnlein wie Du? Geh’ doch, Gittli geh’ ... wie kannst Du nur so fragen!“
Sie wurde verlegen und suchte nach Worten. „Weil ... weil ich’s halt doch nicht weiß, Herr!“
„Aber freilich weißt Du es! Welch ein holdes, süßes Kindlein Euer Liebling war, das weißt Du doch, gelt?“
„Ja, Herr, ach ja!“
„Und nun denke Dir: wenn das Kindl hätte leben müssen und Schmerzen leiden und siechen, und die bösen Menschen hätten es gestoßen, getreten und geschlagen, und es hätte Unglück über Unglück erfahren, Kummer über Kammer, Noth und Elend ... und Du und des Kindleins Mutter, Ihr hättet das alles mit ansehen müssen – hätt’ Euch das im Herzea nicht noch viel weher gethan als jetzt, weil es verschienen ist?“
„Ach Gott!“ schluchzte Gittli und wehrte mit beiden Händen, als wollte sie den Gedanken, daß ihr „Mimmidatzi“ hätte leiden müssen, gar nicht eindringen lassen in ihr Herz.
„Gelt? Da ist halt wieder einmal der liebe Herrgott gescheiter gewesen als wir alle miteinander. Der hat sich gedacht: nein, so was laß ich nicht kommen über das liebe, gute Kindl, da nehm’ ich es lieber zu mir herauf in meinen Himmel und mach’ ein Engelein aus ihm, damit es in Freude und Glückseligkeit hinunterlachen kann auf sein Heimathl[4] und ein rechter, fester Schutzengel sein soll für all’ seine lieben Leut’!“
„O mein, brauchen thäten wir freilich einen!“ seufzte Gittli tief auf, und zu Herrn Heinrich emporblickend sagte sie: „Schauet, Herr, ich hab’ mir allweil so was gedacht, aber ich hab’ mir’s halt völlig nicht sagen können!“
„Gelt, siehst Du, daß Du es weißt!“
„Ja, und es muß auch wahr sein, denn hätt’ ich den Schutzengel nicht gehabt, ich hätt’ den Haymo nimmer finden können, und jede Stund’ derzeit, Tag und Nacht hab’ ich das Kindl allweil bei mir sitzen sehen, und allweil hat’s mich angelachet. Gelt, Herr Heinrich, unser Herrgott ist halt doch ein guter, guter Mann!“
„Das mein’ ich! Und darum sei gescheit, Gittli, verlaß Dich nur auf ihn und wisch’ Dir die Zähren ab! Und dann laß Dir vom Frater Severin eine tüchtige Schüssel voll Suppe geben, trag sie hinüber zum Haymo und schau darauf, daß er gehörig ißt.“
Jetzt lächelte Gittli, freilich noch in Thränen. „Da seid nur ganz ruhig, Herr Heinrich, ich will schon hineinstopfen in ihn, was das Zeug hält!“
Frater Severin kam bereits mit der Schüssel. „Nimm, Dirnlein, nimm!“ flüsterte er und zwinkerte mit freundlichen Augen. „Die besten Bröcklein hab’ ich für ihn gefischt!“
„Vergelt’s Gott!“ sagte sie, nahm die Schüssel und ging mit achtsamen Schritten davon, die Augen starr auf die Suppe gerichtet, um nur ja kein Tröpflein zu verschütten.
Herr Heinrich blickte ihr lächelnd nach. „Warum? Warum? Du alte, ewig menschliche Frage! Wärest du doch in jeder Brust so leicht zu geschweigen wie in dem Herzen dieses Kindes.“
Inzwischen hatte Gittli die Jägerhütte erreicht, in welcher Walti bei Haymo saß. „Da schau,“ sagte sie, „was ich da jetzt bring’!“
Haymo richtete sich auf. „Gittli!“ Hätte er tausend Worte gesprochen, er hätte mehr nicht sagen können, als was der Klang dieses Namens verrieth, was der Blick seiner Augen sprach.
„Du! Jetzt thu’ mir nicht reden!“ drohte sie. Jetzt mußt essen! Und alles, alles – bis auf das letzte Bröserl!“ Sie setzte sich auf den Rand des Lagers und zog das Knie herauf, um eine Stütze für die Schüssel zu haben. Er begann zu essen, und bei jedem Löffel, den er nahm, schaute er zu ihren Augen auf; und immer wieder nickte sie ihm zu und lächelte. „Gelt, das schmeckt?“
Walti steckte die Nase in den Suppendampf. „Kruzi, Kruzi, wenn ich allweil solche Sachen kriegen thät’, da ließ’ ich mir gleich auch eins auf den Buckel stechen ... von so einem schlechten Kerl!“ Er griff mit beiden Händen zu, denn die Schüssel wackelte bedenklich zwischen Gittlis Händen. „Was machst denn? So halt’ doch fest!“ Und zu Haymo sich wendend fragte er: „Sag’, Jäger, Du mußt aber doch wissen, was es für einer war?“
[364] Haymo schüttelte den Kopf. „Sein Gesicht war angerußt!“
Tief athmete Gittli auf; dann sagte sie zu Walti: „Geh’, thu’ den Becher spülen … jetzt muß er den Wein kriegen!“
Der Bub’ nahm den Becher vom Tisch und rannte hinaus.
„Haymo,“ stammelte Gittli leise, „gelt, wenn sie Dich ausfragen … nachher sag’s nicht, daß es beim Kreuz geschehen ist!“
„Warum nicht?“
Sie senkte das Köpfchen und lispelte: „Weil … weil ich Dich bitten thu’!“
Er nickte vor sich hin. „Ich weiß schon, wie Du’s meinst! Gelt, meinst, weil sie Gottesleut’ sind … und müßten sich kränken, wenn sie hören thäten, daß ihr Herrgott so was hat geschehen lassen!“ Ein bitteres Lächeln zuckte um seine Lippen. „Zu mir hat er reden mögen! Warum denn hat er nicht auch zum anderen sagen können: thu’s nicht, thu’s nicht?“
Gittli hing an ihm mit angstvollen Augen; sie verstand seine Worte nicht. „Haymo …“
Sie konnte nicht weitersprechen, denn Walti kam zurück. Mit zitternder Hand reichte sie dem Jäger den gefüllten Becher, den er mit dürstenden Zügen leerte, mit dem Becher zugleich ihre Hand gefangen haltend. Und als er dann aufblickte zu ihr mit glänzenden Augen, flüsterte er: „Nein, Gittli, nein, ich darf nimmer fragen: warum? Ich weiß ja schon, warum er’s hat geschehen lassen … ich weiß es … weiß es!“ Und er zog ihre Hand mit dem Becher an seine Brust.
Sie ließ ihn gewähren und stand, als wüßte sie nicht, wie ihr geschehe. Und da er ihre Hand nun freigab, blickte sie auf, wie erwachend, nahm wortlos die Schüssel und ging der Thüre zu.
„Gittli!“ rief er ihr leise nach. „Kommst bald wieder?“
„Wohl wohl, Haymo!“ lispelte sie und verließ die Hütte.
„Hohohoho!“ lachte Walti auf, klemmte die Hände zwischen die Knie und schüttelte vor Vergnügen die Schultern.
„Was hast denn, dummer Bub’?“
„Ich weiß auch was! Hohohoho! Ich weiß auch was!“ Und kichernd steckte er den Kopf in den Winkel zwischen Bett und Bank.
Draußen vor der Hütte stand Gittli, fuhr mit dem Rücken der freien Hand über ihre heißen Wangen und stammelte: „Was weiß er denn … was kann er denn wissen?“ Und mit zögernden Schritten ging sie der Herrenhütte zu.
Einer der Knechte kam ihr entgegen; er habe ihr eine Botschaft auszurichten. Ihr Bruder, der Sudmann, sei in der Nacht zu den Almen gekommen und habe gejammert, daß seine Schwester seit zwei Tagen fehle, und daß kein Mensch wisse, wohin sie gekommen sei. Als ihm die Knechte erzählten, daß seine Schwester den Jäger todwund gefunden und in der Hütte gepflegt habe, bis die Herrenleute kamen, da habe er sich vor Staunen kaum fassen können; jedes Wort, das er gesprochen, sei ein Lob für seine Schwester gewesen; und sie solle nur ja in der Hütte bleiben, solange die Herrenleute sie nöthig hätten; er selbst wäre gerne noch zu ihr hinaufgestiegen in die Röth’; aber da er nun wisse, daß sie wohlauf und sicher geborgen sei – habe er gesagt – so wolle er lieber wieder heimlaufen, um die Schicht im Sudhaus nicht zu versäumen. Er thue die Schwester recht, recht schön grüßen lassen. Mit Bangen und Zittern hörte Gittli diese Botschaft an, welche sie nicht zu verstehen vermochte. Wie wäre es ihrem kindlichen Sinn auch beigefallen, daß Wolfrat diesen Gang zur Alm, wo er die Knechte zu finden hoffte, nur gethan hatte, um einen drohenden Verdacht von sich abzuwenden! Denn wenn er die Schwester hätte gehen lassen, ohne sich weiter um ihr Verbleiben zu kümmern, dann mußte er wissen, weshalb sie gegangen war, wissen, wo und weshalb sie blieb.
Als Gittli die Herrenhütte betrat, kam sie gerade recht, um Herrn Schluttemanns Auferstehung mitzufeiern. Sein Kopf erschien auf einmal über dem Rand des Heubodens. Wo aber hatte er das Gesicht gelassen, das er sonst an jedem Morgen zu zeigen pflegte – jenes zornbrennende Gesicht mit den gerunzelten Brauen, den rollenden Augen und dem gesträubten Schnauzbart? Er schien sich verwandelt zu haben in diesem langen Schlaf; sanft hing ihm der Schnauzbart über die Lippen, lustig blitzten seine Augen, und mit einem Gesicht, lachend bis zu den Ohren, stieg er über die Sprossen nieder … Frater Severin meinte: wie der strahlende Erzengel Gabriel über die Himmelsleiter.
Auf der Erde angelangt, streckte und dehnte er sich, rieb vergnügt die Hände, schlug dem Frater die flache Hand auf den breiten Buckel, kneipte Gittli in die Wange und trat mit fröhlichem Gruß in das Herrenstüblein. Und während nun Stunde um Stunde verging, hörte man seine lachende Stimme an allen Ecken und Enden, bald im Herrenhaus und bald in der Jägerhütte. Hier wurde er freilich von Herrn Heinrich ausgetrieben, um Haymo einen ruhigen, stärkenden Schlaf zu sichern.
Einige Stunden nach Mittag versiegte der Regen, die Wolken klüfteten sich, und die Sonne warf, ehe sie hinter die Berge sank, noch einen goldigen Schein über die beiden Hütten.
Herr Heinrich nahm die Armbrust auf den Rücken und stieg zum Kreuzwald empor; der Vogt machte sich mit den Knechten auf die Suche, und Pater Desertus wanderte einer nahen Felshöhe zu – dort sah ihn Gittli auf einem Steinblock sitzen, bis der Abend dämmerte. Haymo schlief, und Gittli weilte mit Frater Severin und Walti auf der Bank vor der Hütte, mit halbem Ohr nur hörend, was die beiden plauderten; in Sorg’ und Unruh’ glitten ihre Blicke immer wieder hinüber nach dem Steinthal; die drückendste Angst war aber doch von ihr genommen. Sie hatte ja nun einen Schutzengel, der droben im Himmel sorgte für sie, für den Wolfrat und die Seph’. Und was der Bruder auch gesündigt … sie hatte es doch ein lützel wieder gut gemacht!
Der erste, der zurückkam, war Herr Schluttemann. Er hatte nichts gefunden, rein gar nichts! Der Regen hatte Haymos blutige Fährte und die Schweißspur des verschleppten Steinbocks ausgelöscht. Ja … der Schutzengel!
Bei Einbruch der Nacht kehrte der Propst mit Pater Desertus zurück. Herr Heinrich hatte eine Fehlpirsch auf den Auerhahn gethan. Beim Niederstieg aber hatte er einen Luchs aufgescheucht und dem fliehenden Raubthier einen Bolzen nachgeschickt. Nun sollten zwei der Knechte während der Nacht hinunter zum Kloster, um die beiden Schweißhunde zu holen, die Hel und den Weckauf. Einem der Knechte trug Herr Heinrich auf, im Hause des Sudmanns vorzusprechen, um für Gittli mitzubringen, was sie nöthig hätte an Gewand und Leinen. Bald nachdem der Abendimbiß eingenommen war, wurde es still in den beiden Hütten; Gittli und Walti wachten bei Haymo; Herr Heinrich, der vor Tag wieder auf den Beinen sein wollte, hatte sich zur Ruhe begeben, und Pater Desertus mußte seinem Beispiel folgen.
Heilig, Brüder, ist das Feuer,
Das in unsren Herzen flammt!
Ihr seid unser – wir sind euer:
Einer Mutter all’ entstammt!
Ob uns äußre Macht zerrissen,
Deutscher Geist zerbricht den Zwang:
Eins sind wir in deutschem Wissen,
Deutschem Wort und deutschem Sang!
Lichte Sterne, bleibt uns Lenker
Hoch am Himmel deutscher Kunst!
Deutsche Dichter, deutsche Denker,
Scheucht der Tiefe gift’gen Dunst!
Rings umdräut in wilder Welle
Uns der fremden Völker Drang –
Stärk’ im Kampf uns, Himmelsquelle,
Deutsches Wort und deutscher Sang!
Hört den Schwur, ihr ew’gen Firnen!
Donau, rausch’ ihn hin zum Rhein:
Stets auf deutscher Männer Stirnen
Throne deutscher Treue Schein!
Nord und Süd – die gleichen Flammen!
Ost und West – der gleiche Klang!
Sterbend noch halt’ uns zusammen
Deutsches Wort und deutscher Sang!
Ernst Scherenberg.
Polizei und Verbrecherthum in Berlin.[5]
Die millionenbevölkerte Großstadt mit ihrem Gewirr und Getriebe erleichtert das Verbrechen und erschwert die Entdeckung. So umfangreich und ausgedehnt auch die Einrichtungen der Berliner Polizei sind, die jeden Einwohner mit den nöthigsten biographischen Notizen in ihren Personalakten verzeichnet hat, so genau die An- und Abmeldungen Zu- und Fortziehender seitens der einzelnen Polizeibureaus verfolgt werden, so sorgfältig auch die Kontrolle der unter Polizeiaufsicht stehenden Personen geführt und die Kriminalpolizei durch ihre Vigilanten über den zeitweiligen Aufenthalt bestimmter Verbrecher auf dem Laufenden erhalten wird – die Weltstadt ermöglicht es doch dem einzelnen, in ihrem Menschenstrudel auf kürzere oder längere Zeit zu verschwinden und, falls nicht Zufall oder Verrath dies verhindern, erst wieder an die Oberfläche des öffentlichen Lebens emporzutauchen wenn eine Entdeckung nicht mehr zu befürchten ist.
Betrachten wir die Schlupfwinkel der Verbrecher, so müssen wir in erster Linie des Schlafstellenwesens (richtiger: -unwesens) gedenken, welches in Berlin besonders stark ausgeprägt ist und die schlimmsten sittlichen Schäden in sich birgt. Die Höhe der Berliner Miethpreise zwingt Tausende und Abertausende von Familien, um die Miethe überhaupt aufbringen zu können, noch aus ihrer Wohnung Kapital zu schlagen, indem sie deren Räume zum Theil als Schlafstellen vermiethen und sogenannte „Schlafburschen“ oder „Schlafmädchen“ bei sich aufnehmen. Diese gehören größtentheils dem Stande der Fabrikarbeiter an, aber auch die gering besoldeten Angestellten anderer Berufszweige, wie kaufmännischer Geschäfte, der Eisenbahn und Post, der Pferdebahnen etc., gesellen sich ihnen zu und lassen die Zahl dieser Schlafstellen-Inhaber auf viele Tausende anschwellen. Die Vermiether kümmern sich wenig oder gar nicht um ihre Schlafburschen; die Persönlichkeit derselben ist ihnen gleichgültig, sie sind zufrieden, wenn die Miethe pünktlich bezahlt wird, und haben keine Veranlassung und kein Interesse, sich um Herkunft, Vorleben oder gegenwärtige Beschäftigung ihrer Miether zu sorgen, wie sie es auch nicht so streng mit deren polizeilicher Anmeldung nehmen und unter Umständen von einer solchen gänzlich absehen.
Bei derartigen Schlafstellenvermiethern finden die Verbrecher, von deren Thätigkeit jene selbstverständlich nichts wissen, jederzeit Unterschlupf und können sich so wochen- und monatelang den Augen der Polizei entziehen; der Vermiether oder, da dieser ja auch stets in irgend einem Arbeitsverhältniß steht, dessen Frau läßt den angeblich „arbeitslosen“ Schlafstellenbesitzer, falls er eine Kleinigkeit bezahlt oder sich im Haushalt nützlich macht, gern auch während des Tages in der Wohnung; die Anmeldung bei der Polizei ist auf seinen Wunsch unterblieben, da er vorgiebt, irgend eine kleine Ordnungsstrafe wegen Lärmens, Betrunkenheit oder einer Prügelei bezahlen zu müssen und dazu nicht in der Lage zu sein; sein Kommen und Gehen wird in diesen verkehrsreichen Häusern, unter denen einzelne Hunderte von Bewohnern zählen, von niemand kontrolliert, wie es auch keinem einfällt, nachzuforschen, woher er das Geld zum Leben nimmt, oder, wenn er fortbleibt, wo er die Tage und Nächte zubringt – genug, er ist für die Behörden plötzlich verschwunden.
Einen willkommenen, wenn auch nie ganz sicheren Unterschlupf bieten ferner die „Pennen“, die über ganz Berlin verstreut sind, Herbergen der niedrigsten Art, welche während der Nacht die Aermsten der Armen und die Verworfensten der Verworfenen bei sich aufnehmen. In niedrigen, vor Unsauberkeit starrenden Zimmern, in elenden Kellerlöchern, in verfallenen Schuppen und einstigen Ställen wird den darum Bittenden das Nachtlager angewiesen, dessen Preis von fünf Pfennig bis auf dreißig Pfennig steigt. Und wie ist dieses Nachtlager beschaffen! Zerrissene Säcke, halbverfaulte Strohschichten, zerbrochene Pferdekrippen, Stühle, Bänke und Tische, sehr oft die bloße Erde. Ohne sich zu entkleiden, ohne etwas zum Zudecken zu haben, schlafen hier eng zusammengedrängt jene, die für ihr müdes Haupt kein anderes Obdach erschwingen können oder – wollen, Drehorgler und Hausierer, Lumpensammler und beschäftigungslose Arbeiter, herabgekommene Handwerker und einstige Kaufleute, eine buntgemischte Gesellschaft, von der sich mancher nicht hat träumen lassen, daß er dereinst auf solchem Lager seine Ruhe werde suchen müssen!
Sind diese Pennen im Winter gewöhnlich überfüllt, so stehen sie im Sommer häufig leer, denn ihre Stammgäste ziehen dann ein Quartier bei „Mutter Grün“ vor oder wählen sich ein anderes nächtliches Heim. Die Auswahl ist ja groß, und der Obdachlose greift ohne Bedenken zu! Ganz gern läßt er sich in einem Neubau nieder, den er oft auf gefährlichem Leiterwege erklimmen muß, auch Böden und Dächer in bewohnten Häusern werden aufgesucht, nicht minder beliebt sind Eisenbahnwagen, dann Scheunen und Ställe, Droschken, Omnibusse und Möbelwagen. Letztere erfreuen sich einer besonderen Werthschätzung, sie sind geräumig, enthalten fast immer alte Decken, bleiben, wenn nicht gerade Umzugszeit ist, monatelang unberührt auf demselben Fleck stehen und können gleich eine ganze Anzahl von Pennbrüdern und Strolchen aufnehmen, denn auch diese ziehen Gesellschaftslager dem Einzelquartier vor. Durch einen Zufall entdeckte man einmal in einem solchen Möbelwagen, der auf einem etwas entlegenen Gehöft stand, ein ganzes Nest von Herumtreibern. Ein Kriminalschutzmann patrouillierte zu später Abendstunde eine der einsamen, [366] neuen Straßen im Norden Berlins ab und vernahm hinter einem Zaune Stimmen. Er kletterte hinauf, konnte jedoch niemand bemerken, sah dafür aber aus einem Möbelwagen durch einen Ritz Licht schimmern und vernahm auch von dort verhaltenes Sprechen. Nachdem er zur Unterstützung einige Bewohner des Hauses herbeigeholt hatte, ging man an eine Untersuchung des Möbelwagens: behutsam hob mab das an der Rückwand angebrachte Plantuch hoch, und siehe da – nicht weniger als zwölf Bummler hatten es sich im Innern des Wagens sehr bequem gemacht und spielten bei dem Schein einer Lampe in höchster Gemüthlichkeit Karten. Brot, Wurst-, Schinken- und Speckreste ließen auf ein reichliches Abendbrot schließen, und aus anderen Anzeichen ging hervor, daß die Herren, unter denen sich mehrere von der Polizei seit langem gesuchte Individuen befanden, hier schon Wochen hindurch behaglich gelebt hatten. So gut treffen es nun nicht alle Obdachlosen und Flüchtigen, man fand und findet sie auch in Müllgruben und in den Fässern der Brauereien, in Wasser- und Abflußrohren, in leeren Kisten und selbst in Dampfkesseln, die wegen eines folgenden Feiertages nicht geheizt werden! Groß ist sodann die Auswahl bei „Mutter Grün“: da giebt’s Bänke und Lauben im Thiergarten und Friedrichshain, stille Plätzchen unter dichten Gebüschen und unter zusammengekehrten Laubhaufen; mit Vorliebe aufgesucht werden die Stellen unter Brücken und Stadtbahnbögen, und Verbrecher, die bei einer nächtlichen polizeilichen Razzia nicht ergriffen werden wollen, scheuen auch nicht vor einem Nachtlager auf dem Ast eines Baumes zurück.
Andere gelegentliche Schlupfwinkel bilden die Herbergen zur Heimath und die Asyle für Obdachlose, obgleich hier meist nach Legitimationspapieren geforscht wird – aber wie leicht kann sich ein Verbrecher falsche verschaffen, sei es, daß er sie stiehlt, sei es, daß er sie von guten Bekannten, auf welche die Polizei noch nicht aufmerksam ist, entlehnt. Die Herbergen zur Heimath, von denen es gegenwärtig vier in Berlin giebt, sind ebenso wie die Asyle Wohlthätigkeitsanstalten und wurden von dem „Evangelischen Verein für kirchliche Zwecke“ errichtet, in der Absicht, zuziehenden mittellosen Handwerkern, Kaufleuten, Arbeitern etc. ein billiges, sauberes Quartier zu schaffen und sie durch die Aufnahme vor den sittlichen Gefahren der Großstadt zu bewahren. So edel und anerkennenswerth das Bestreben ist, so ist es doch unmöglich, nur unbescholtenen Leuten Einlaß zu gewähren und mehrere vielgenannte Kriminalprozesse haben bewiesen, daß sich gefährliche Verbrecher gerade in jenen christlichen Herbergen am sichersten wähnten, dort sich durch Tausch und Verkauf verdächtiger Gegenstände entledigten und Gefährten für ihre dunklen Thaten unter den daselbst Wohnenden zu gewinnen suchten und auch fanden.
Diese Thatsache enthält keinen Vorwurf gegen die Verwaltung, die an sich musterhaft ist und die wärmste Unterstützung verdient; sie bildet nur einen neuen Beweis dafür, daß in dem wechselvollen Trubel des Berliner Lebens auch der Unschuldigste in persönliche Berührung mit Angehörigen des Verbrecherthums gerathen kann, sei es in den Herbergen, sei es in einem vielbesuchten Hotel, in einem eleganten Wiener Café, in einem vornehmen Restaurant, in einem Vergnügungslokal oder in einem Volks-Café.
Von Asylen giebt es zwei in Berlin, das aus privaten Mitteln gegründete und erhaltene „Asyl für Obdachlose“ in der Büschingstraße und das auf städtische Kosten erbaute „Städtische Obdach“ an der Prenzlauer Allee. Ersteres macht seinem Namen insofern besondere Ehre, als es von den Einlaßbegehrenden keinerlei Personalausweise verlangt und die Polizei, ohne besondere Erlaubniß der Verwaltung, seine Schwelle nicht übertreten darf. Letzteres fordert für die Aufnahme eine Legitimation und steht auch sonst zur Polizei in näheren Beziehungen, indem man ihr hier solche Personen, die öfter als fünfmal im Monat Unterkunft verlangen, als „arbeitsscheu“ übergiebt. Beide Asyle werden zahlreich besucht; stundenlang vor ihrer Eröffnung drängt sich eine dichtgescharte Menge vor ihren Thüren, und neben den fragwürdigsten Erscheinungen, welchen man die Verworfenheit und eine lange Gefängnißstrafe schon von fern ansieht, trifft man auch solche, deren ganzes Wesen errathen läßt, daß sie durch Unglück, verschuldetes oder unverschuldetes, allmählich tiefer und tiefer gesunken sind und noch voll verzehrender Sehnsucht jener Tage gedenken, wo es ihnen besser ergangen ist, wo sie nicht geahnt, daß sie einst im Verein mit Bettlern und Strolchen hier um Obdach flehen würden. Auch diese Asyle mögen wiederholt schuldbeladene Verbrecher auf kurze Zeit den verfolgenden Blicken der Polizei entziehen, aber wer möchte deshalb gegen sie sprechen und ihnen daraus einen Vorwurf machen! Tausende und Abertausende Bedrängter und Bedrückter haben sie vor der Verzweiflung gerettet, indem sie ihnen, ohne einen Pfennig Entgelt zu nehmen, menschenwürdige Aufnahme gewährten, indem sie dieselben mit Trank und Speise erquickten und den erschlafften Körper durch ein Bad stärkten, indem sie vor allem aber bei diesen Tausenden von Unglücklichen das Bewußtsein erweckten, daß sie in der Millionenstadt nicht ganz verloren seien.[6]
Haben wir in Vorstehendem die nächtlichen, zu Wohnungszwecken dienenden Schlupfwinkel der Verbrecher angeführt, so erübrigt es uns noch, ihre anderen Aufenthalts- und Versammlungsorte zu betrachten. Ueber diese bestehen im Publikum die seltsamsten Vermuthungen, und der Phantasie wird hier der freieste Spielraum gelassen in dem Erdenken und in der Ausmalung der geheimnißvollsten, von allen Schauern des unheimlichen umgebenen Oertlichkeiten, aus denen die übrigen Sterblichen, falls sie auf irgend eine Weise überhaupt hineingelangt sind, nur mit Gefahr ihres Lebens wieder herauskommen. Nichts falscher als das! Das moderne Berlin kennt nichts von unterirdischen Verstecken, von Höhlen und Fallthüren, von nur auf Schleichwegen zu erreichenden Zufluchtsorten, wo die gestohlenen Schätze verborgen liegen und neue verbrecherische Pläne ausgebrütet werden, von Diebsspelunken mit Doppelwänden, zwischen denen sich die Verfolgten verbergen können, und mit räthselhaften Schränken, deren Rückwände auf versteckte Gänge führen, die eine schleunige Flucht ermöglichen, wie es in früheren Kriminalgeschichten so anschaulich beschrieben wurde. Nein, der „moderne“ Verbrecher fühlt sich, wenn er sich nicht selbst aus bestimmten Gründen vor der Polizei verbergen will und seine Kleidung eine anständige ist, nirgends sicherer und ungenierter, als an jenen Orten, wo der harmloseste Verkehr herrscht, und am bezeichnendsten hierfür ist es, daß sich neuerdings ganze Verbrechercliquen zu ihren Zusammenkünften Volks-Cafés erwählt haben und sich dort in den Vormittagsstunden zu ihren „Berathungen“ versammeln.
Aber auch an anderen Orten können wir sie finden, im [367] Café Bauer ebenso gut wie in einem lebhaften Bräu der Friedrichstraße, in einem einfachen Weißbierrestaurant wie in dem stark besuchten Rathhauskeller, in dem lauten Menscheugewirr der Passage wie in den stillen Sälen eines Museums. Daneben bevorzugen allerdings viele von ihnen, sei es aus Gewohnheit, sei es, um ungestörter mit den Gefährten zusammen zu sein, gewisse Nachtcafés in den vom Centrum entfernter gelegenen Stadttheilen; mit einer schäbigen Eleganz eingerichtet, mit Wiener Kellnerbedienung und einem Berliner robusten Hausknecht, der, wenn nöthig – und das ist oft der Fall – persönlich eingreift, um Lärmmacher an die frische Luft zu befördern, zeigen diese Cafés uns zu später nächtlicher Stunde die zweifelhaftesten Besucher und geben oft den Hintergrund ab zu den widerwärtigsten Scenen. Falschspieler, Bauernfänger, Taschen- und Ladendiebe, allerhand andere Gauner und Betrüger trifft man besonders häufig an, und der Polizei ist hier schon mancher gute Fang gelungen.
Noch eine Stufe tiefer stehen die sogenannen „Verbrecherlokale“; wir betonen absichtlich das „sogenannt“, denn eigentliche Verbrecherlokale, mit anderen Worten Gaststätten, wo ausschließlich Verbrecher verkehren, giebt es nur noch wenige in Berlin, und auch jene „sogenannten“ sind mehr und mehr aus den kurz vorher erwähnten Gründen im Abnehmen begriffen, so daß sich ihre Gesammtzahl auf etwa dreißig belaufen wird, während sie noch vor wenigen Jahren das Doppelte und mehr betrug. Fast immer liegen diese Lokale im Keller, hin und wieder auch zu ebener Erde, damit nöthigenfalls die Flucht beim Nahen der Polizeimannschaften nicht mit Schwierigkeiten verbunden ist; aus dem nämlichen Grunde besitzt ein Theil derselben, und zwar gewöhnlich diejenigen, die sich in einem Eckhause befinden, zwei vordere Eingänge von zwei verschiedenen Straßen aus, so daß der Unbetheiligte keine Ahnung von ihrem Zusammenhange hat. Auch sonst lieben diese Lokale es nicht, die besondere Aufmerksamkeit der Vorübergehenden auf sich zu ziehen, selten zeigen sie ein Schild und eine Laterne und selten dringt ein verstohlener Lichtschimmer hinter den dunklen Vorhängen der kaum über den Erdboden hinwegragenden Fenster und aus der auf steiler schmaler Treppe zu erreichenden, tief gelegenen Thür hervor. Ein „Unberufener“ wird sich daher schwerlich in diese Schankstätten verirren und die „Berufenen“ kennen den Weg sehr wohl, ebenso wie sie den Wirthen und Gästen hinlänglich bekannt sind. All diese Lokale ähneln sich untereinander: ein langer, niedriger, dumpfer Raum, trübe beleuchtet durch matt brennende Gasflammen oder Petroleumlampen, an den kahlen Wänden eine schmutzige, vielfach zerrissene Tapete, oft auch nur ein zerbröckelnder, in den räthselhaftesten Farben schimmernder Anstrich, in der Mitte oder in einer Ecke ein fadenscheiniges Billard, dann einige Dutzend wackelige Stühle und kleine Tische – das ist alles. Der Schankraum befindet sich gewöhnlich abgesondert in einem Gemach, in welches man zunächst von der Treppe aus eintritt; hier schaltet hinter dem mit gekochten Eiern, Würsten, Schinken, kalten „Klöpsen“, mit verschiedenen, unter einer Glasglocke aufbewahrten Käsesorten, sowie mit Butter und Brot besetzten „Buffet“ der behäbige, mit blauer Arbeitsschürze versehene Wirth, der je nachdem pfiffig, dumm, grob, freundlich, harmlos, durchtrieben, herrisch, unterthänig aussehen kann, ganz wie es die Sachlage verlangt. Mit seinen Gästen steht er auf vertrautem Fuß, trotzdem er viele nur mit ihren Spitznamen kennt – desto besser weiß er freilich ihre „Beschäftigung“; was sie außerhalb seiner vier Wände thun und treiben, kümmert ihn nichts, falls er nicht, was selten geschieht, mit ihnen unter einer Decke steckt und wohl gar den Hehler für die gestohlenen Waren abgiebt; er ist mit Umsicht und Bereitwilligkeit auf ihre leibliche Pflege bedacht, allerdings auch nur gegen baare Bezahlung, denn vom Borgen ist er kein Freund und kündigt dies deutlich durch allerhand recht verständliche Plakate an.
Die Gesellschaft in diesen Lokalen ist bunt zusammengewürfelt und besteht größtentheils aus vorbestraften Personen; aber selbst ihnen wohnt ein gewisser Corpsgeist inne und sie sondern sich wieder in einzelne engere Kreise ab, die streng zusammenhalten und sich in bestimmten Lokalen treffen, um in mündlichem Austausche von früheren gemeinsamen Thaten zu plaudern und neue zu verabreden. Wie die Mienen der „Stammgäste“ dieser Restaurants, so weisen auch ihre Kleidungen die mannigfachsten Abstufungen auf, von dem mit auffälliger Eleganz gekleideten Falschspieler und Bauernfänger an bis zu dem strolchenhaft ausehenden Bodendieb, dessen Kostüm aus den verschiedensten gestohlenen Sachen zusammengesetzt ist und eine wahre Musterkarte von Geschmacklosigkeit bildet. Die Unterhaltung wird in reinstem „Berlinisch“ geführt, vermischt mit den zahllosen Ausdrücken der Verbrechersprache, so daß ein Uneingeweihter einen vollständig fremden Dialekt zu hören vermeint.
Die Kriminalpolizei kennt natürlich all diese Lokale ganz genau, hat aber keine Veranlassung, sie aufzuheben, da sie ja das Ergreifen gesuchter Verbrecher erleichtern. Je nach Bedarf werden wöchentlich oder monatlich ein oder mehrere Male Razzias durch diese Kneipen unternommen. Eine Anzahl Kriminalbeamter, acht, zehn, fünfzehn, zwanzig, trifft sich zu abendlicher Stunde an einem bestimmten vom regsten Verkehr etwas abgelegenen Punkte Berlins, und der leitende Wachtmeister oder Kommissar ertheilt die erforderlichen Anweisungen, die sich auf Umstellung der zu durchsuchenden Lokale, auf die Persönlichkeiten der zu verhaftenden Verbrecher, auf Signalements zugereister Schwindler etc. beziehen; selbst bei diesen nächtlichen Fahrten verschmähen häufig die Kriminalbeamten die Mitnahme eines Revolvers und verlassen sich ganz auf ihre Körperkraft und den stets mitgeführten, zuweilen bleiausgegossenen Stock. In kleineren Trupps begiebt sich die Schar, der man nicht das geringste Auffällige anmerkt, nach den einzelnen Lokalen, deren Ein- und Ausgänge, auch die nach dem Hofe zugehenden, besetzt werden. Dann erst betreten mehrere Beamte das Innere. Ihr Erscheinen, selbst in den überfülltesten Lokalen, erregt nie größeren Aufruhr; dieser und jener, dessen Gewissen nicht ganz frei ist, erblaßt wohl im ersten Augenblick, faßt sich aber schnell wieder und nimmt ein möglichst gleichgültiges Wesen an, die übrigen lassen sich kaum in ihrer nur etwas gedämpfter als vorher geführten Unterhaltung, in ihrem Trinken und Kartenspielen stören, sie begrüßen in aller Gemüthlichkeit die ihnen persönlich bekannten Beamten, und auch letztere treten diesen „guten Freunden“, denen sie schon manches Jahr stiller Zurückgezogenheit hinter Gefängnißmauern verschafft haben, keineswegs streng dienstlich [368] gegenüber, sondern plaudern mit ihnen in zwangloser Weise und erfahren dabei manches Wissenswerthe.
Um jedoch „Ungewißheiten“ zu vermeiden, erklärt der leitende Beamte mit lauter Stimme: „Wir sind Kriminalpolizisten! Alles hat sich zu legitimieren! Wer keine Legitimation hat, tritt bei Seite und folgt zur Wache!“ Sofort ziehen die Anwesenden ihre Papiere heraus, falls sie im Besitze solcher sind, und weisen sie vor, oft mit spöttischen oder witzigen Bemerkungen; der eine und andere von ihnen wird trotzdem visitiert; trifft man auf einen der gesuchten Verbrecher, so wird er selbstverständlich sogleich verhaftet und mit den Nichtlegitimierten nach der nächsten Revierwache geführt. Zu den größten Seltenheiten gehört es, daß bei diesen Razzias Widerstand geleistet wird; die Anwesenden wissen, daß das Lokal umstellt ist, daß ein Pfiff dreifache Hilfe herbeiruft und daß sie ihre Sache durch Widersetzlichkeit nur bedeutend verschlimmern.
Der gefundene Verbrecher wird mit dem nächsten „Grünen Wagen“ von der Revierwache nach dem Polizeiamt am Alexanderplatz gebracht und dort verhört. Dasselbe Schicksal trifft jene Legitimationslosen, die keine feste Arbeitsstelle nachweisen können und nicht polizeilich angemeldet sind; hierüber und ob ihre Aussagen der Wahrheit entsprechen, giebt der Telegraph binnen kurzem Auskunft. Kommt aus dem Revier, in welchem der Betreffende wohnen will, die Nachricht, daß er dort angemeldet ist und nichts gegen ihn vorliegt, so wird er sogleich entlassen, im entgegengesetzten Fall erhält er wegen Versäumens der polizeilichen Anmeldung beziehungsweise wegen Arbeitsscheu seine Strafe. Da die Kriminalbeamten nicht das Signalement aller gesuchten Verbrecher im Kopf behalten können, so liegt ein alphabetisch geordnetes, genau ins einzelne gehendes Verzeichniß derselben in jeder Polizeiwache auf, und man kann auf diese Weise leicht gleich dort ermitteln, ob sich unter den Verhafteten ein bestimmter Gesuchter befindet. Ist dies der Fall, so kann er der Freiheit auf längere Zeit Lebewohl sagen; alle Schlupfwinkel der Weltstadt helfen ihm nichts mehr, und bald nimmt ihn eine enge Zelle, zunächst die der Untersuchungshaft, dann die des Gefängnisses oder Zuchthauses auf.
Deutsche in Italien.
Fast zwei Jahrtausende sind verflossen, seit die ersten Nordländer, aus eigenem Antriebe oder von unzufriedenen Nachbarn gedrängt, die Alpenpässe überstiegen und beim Anblick der weiten herrlichen Thäler und des azurblauen Meeres entzückt in ihrem Vandalisch, Westgothisch oder sonst einer Mundart ausriefen: „Hier ist es schön. Hier wollen wir bleiben und uns Hütten bauen!“
Noch bis zum heutigen Tage findet eine fast ununterbrochene Strömung aus dem Norden und namentlich auch aus unserem Deutschland nach den lachenden Gefilden Italiens statt. Aber die Fremden kommen nicht mit Feuer und Schwert, um zu vernichten und dann doch, die Ueberlegenheit des unterdrückten Volkes anerkennend, in diesem aufzugehen. Die Besucher von heute bringen ihre eigene Kultur, ihre ausgesprochene Individualität mit und sie kommen zum größten Theil, um staunend die Wunder der Natur und Kunst zu genießen und bereichert mit unvergeßlichen Eindrücken heimzukehren.
Ich sagte: der größte Theil, nicht alle. Es giebt Tausende von Landsleuten, welche in Italien dauernd ihre Zelte aufgeschlagen haben. Unsere Aerzte, welche Lungenleidende nach dem Süden senden, schaffen das größte Kontingent dieser Deutsch-Italiener. Nachdem sie an der Riviera, in Neapel, Palermo Gesundheit gefunden, fühlen sie sich einerseits so dankbar gegen das Land, dessen mildes Klima ihnen das stark gefährdete Leben von neuem festigte, und haben andererseits ein solches Bangen davor, sich wieder dem Schnee und Unwetter ihrer Heimath auszusetzen, daß sie sich jenseit der Alpen in irgendwelcher Stellung dauernd niederlassen – gewöhnlich mit einer Landsmännin ein Haus gründend. Wir finden in allen Theilen Italiens Aerzte, Künstler, Archäologen, Schriftsteller, Buchhändler, Agenten deutscher Häuser, Vertreter von deutschen Blättern, Kaufleute, Kunstgärtner, Apotheker, Hotelbesitzer, Fabrikanten, Konsulatsbeamte, welche sich in der so gewonnenen neuen Heimath Namen und Vermögen erworben haben, in deren Familien weiter deutscher Geist und deutsche Bildung gepflegt wird und deren Haus, in der Regel der Zielpunkt von Empfehlungsbriefen, von den reisenden deutschen Landsleuten gerne, ja oft für den Betreffenden nur allzu ausgiebig aufgesucht wird. Außer diesen giebt es aber auch ein gut Theil Deutscher, welche freie Neigung und Wahl nach Italien führte, und endlich solche, bei denen neben der Liebe zum Lande auch die Liebe zu einer Tochter des Landes ein Wort mitgesprochen hat.
Im großen und ganzen kann man nicht sagen, daß die
[369][370] Schönheit der Italienerinnen ihrem Ruf ganz entspräche. Es giebt Orte, wo dem Fremden reizende Gesichter und liebliche Erscheinungen nicht nur vereinzelt begegnen, wie Capri, Florenz, Siena, und aus der Wagenreihe des römischen Korso grüßt manch stolze Schönheit, die daran erinnert, daß am Ufer des Tiber einst Raphaels Modelle aufwuchsen. Aber es giebt andererseits Orte, wo man auf der Promenade vergebens ein Königreich für ein schönes Mädchen aufbieten würde, darunter in erster Linie Neapel. Selbstverständlich schließt das nicht aus, daß auch in Italien tausend und abertausend Mädchen blühen, welche einen Deutschen entzücken und ihm dauernde Liebe einzuflößen vermögen. Ich habe selbst deren im Hause kennengekernt, welche ebenso durch ihre Schönheit wie durch die Lieblichkeit ihres Wesens und ihre überraschende Bildung – viele Damen werden von deutschen Gouvernanten unterrichtet – in Staunen setzten. Im allgemeinen wird freilich das weibliche Geschlecht in Italien in einer solchen Weltfremdheit erzogen, daß eine italienische Gattin dem deutschen Ehemanne selten als eine Gleichberechtigte entgegen tritt. Die Sitte erlaubt nicht, daß ein Mädchen oder eine Frau allein über die Straße geschweige denn in ein Theater gehe, und diese sklavische, ich möchte sagen haremartige Unselbständigkeit verleiht den Frauen etwas von ihren orientalischen Schwestern. Der Italiener wünscht von seiner Frau im Durchschnitt weiter nichts, als daß sie sich schön zu kleiden und zu putzen wisse und daß sie eine hingebende Frau und Mutter sei. Der Deutsche, welcher eine Theilnehmerin seiner Arbeiten und Pläne, eine Repräsentantin seiner Familie, eine Frau, welche ihn und seine Freunde stets auf der Höhe des Tages zu unterhalten versteht, und vor allem eine gute tüchtige Hausfrau beansprucht, wird diese Anforderungen meist, wenn er eine Tochter des Südens freit, bedeutend herabsetzen müssen, und so sind denn auch die Fälle von Heirathen Deutscher mit Italienerinnen verhältnißmäßig selten. Dagegen trifft man ungleich mehr Heirathen von Italienern mit deutschen Frauen. Wenn der Deutsche als solcher schon drüben als ein Muster von Bildung und Gelahrtheit, sowie als ein umgänglicher Mensch angesehen wird, so kommt den deutschen Frauen noch die Annahme zu gute, daß sie tüchtige Hausfrauen und treue Gattinnen, daß sie besser unterrichtet und von Haus aus an den gesellschaftlichen Umgang mit Männern mehr gewohnt sind als die ängstlich gehüteten Italienerinnen. In jeder Ehe, selbst zwischen sozial gleichstehenden und ähnlich erzogenen Menschen, bedarf es ja längerer Zeit, bis sich ihre Verschiedenheiten in Harmonie ausgeglichen haben; die Dauer dieses Uebergangs wird um so größer sein, wenn die Gatten aus zwei völlig verschiedenen Nationen herstammen. Aber der Italiener hat eine so leichte Umgänglichkeit, eine so im Herzen begründete Liebenswürdigkeit, ist so voll Lebenslust, Anspruchslosigkeit und Dankbarkeit für Schonung seiner Schwächen, daß eine vernünftige Frau, welche ihn nicht mit Pedanterien und Eifersüchteleien quält, auch gut mit ihm auskommen muß.
In einem Punkte begegnen sich beide Theile, in dem Bedürfniß nach weiterer Geselligkeit, und diese kann sich in Italien ein Haus um so eher gestatten, als sie nicht entfernt so kostspielig ist wie in Deutschland. Die schweren Einladungen mit mehrstündigen Sitzungen an der Tafel sind in dem darin idealen Italien so gut wie unbekannt. Man kommt entweder vor Tisch zusammen, das heißt also etwa zwischen 5 und 7 Uhr nachmittags – und dann gilt der Besuch gewöhnlich der Frau, und es setzt nichts weiter als ein Täßchen Thee und einige Süßigkeiten, Cakes oder anderes Backwerk – oder nach Tisch, das ist also etwa um 9 Uhr abends, und dann hat man Aussicht, gegen Mitternacht einige Sandwiches, einige Gläschen Marsala zu genießen, während es für die Damen etwas besseres Konfekt und eine Tasse Thee giebt. Das sind die materiellen Genüsse. Die geistigen beruhen hauptsächlich auf dem Wesen einer internationalen Gesellschaft, wo schon das Sprachengewirr anregend und erquickend wirkt. Englisch, Italienisch, Französisch und Deutsch ist das mindeste, was in fortwährender Plauderei herüber und hinüber tönt. Und ob sich dann die ganze Gesellschaft zu einem Tänzchen zusammenthut – die Italiener und Italienerinnen tanzen mit einem Feuer und einer Leichtigkeit, wie dies bei uns nur in vereinzelten Fällen vorkommt – oder ob sie sich an Dilettantenvorträgen auf dem Klavier, der Mandoline, an einem Streichquartett oder am Gesang einer Künstlerin erfreut – die Musik ist das Volapük, welches alle internationalen Schranken überspringt und alle Herzen aufschließt. Ich muß gestehen, daß wir niemals aus einer dieser Gesellschaften ohne freundliche Anregung nach Hause gegangen sind und daß wir diesen zwanglosen geselligen Abenden die liebenswürdigsten Bekanntschaften verdanken.
Man kann durchaus nicht sagen, daß die in Italien lebenden Deutschen ihr Vaterland verleugnen. Und wenn sie noch so lange im Auslande leben, die Neigung, mit ihren Landsleuten zu verkehren, ihnen gewissermaßen die Honneurs in dem schönen Lande zu machen, die Theilnahme für alles, was daheim vorgeht, ist ihnen mehr oder minder geblieben. Und wenn auch dort nicht ein so abgeschlossener Ring zwischen den Deutschen besteht wie zwischen den Engländern, so kann man doch recht gut in jeder größeren Stadt von einer deutschen Kolonie sprechen. Diese hat zum Mittelpunkt die Botschaften, die deutschen Konsulate, in Florenz und Neapel die deutschen Klubs. In Rom bildet ihn der deutsche Künstlerverein, welcher sich eines bedeutenden Ansehens erfreut, in den künstlerisch ausgestatteten, behaglichen, den ganzen Tag geöffneten Räumen des Palazzo Serlupi ein gastliches Heim besitzt; ihm als Gäste anzugehören, rechnen sich die angesehensten Männer jederzeit zur Ehre an. Durch Vorträge, Herrenabende, Abendgesellschaften mit Damen, durch eine Weihnachtsfeier unter dem Tannenbaum, sowie durch glänzende und mit anmuthiger Künstlerlaune veranstaltete Masken- und Kostümfeste erhält der Verein das Interesse seiner Mitglieder unausgesetzt rege und wahrt sich selbst seinen althergebrachten Ruf.
Uebrigens habe ich bemerkt, daß die Deutschen unter dem sogenannten ewig lachenden Himmel Italiens manches von ihrer nationalen Eigenart abgelegt und manches von den Landessitten angenommen haben. Das Kneipenleben ist ein wesentlich anderes. Es giebt wohl in Rom, Florenz, Neapel „Birrerien“, das sind Verkaufs- und Ausschankstellen bayerischer und österreichischer Biere; aber ob es der ungewöhnlich hohe Preis ist oder das Fehlen der „stilvollen“ deutschen Biertempel: der Gambrinuskultus bleibt in dem Lande der Citronen immer ein Fremdling, dem das rechte eingesessene Stammpublikum fehlt. Immerhin machen einige der „Birrerien“ ganz leidliche Geschäfte, und man kann darauf rechnen, in diesen zum Theil hochfeinen, elektrisch beleuchteten, mit kostbaren Bildern und glänzenden Spiegeln ausgestatteten Sälen Landsleute anzutreffen. Doch hat sich im allgemeinen der Geschmack dem Wein zugewendet, und es giebt in Seitensträßchen Osterien, die sich von außen wie Räuberhöhlen anlassen, in denen sich aber einem guten Tropfen zuliebe unsere Landsleute Kopf an Kopf zusammenfinden und mit Straßenarbeitern und Fuhrleuten um die Wette die dargebotenen beliebten Speisen – heut trippa, Kaldaunen, morgen Maccaroni, übermorgen gnocchi, Knödel, verzehren.
Außerdem findet man die Deutschen natürlich in allen Restaurants und am meisten in denen, welche durch Sauberkeit und Billigkeit im Bädeker einen Stern zu erringen das Glück gehabt haben. Die Engländer, obwohl als Reisende in starker Ueberzahl, sind in den Trattorien viel seltener, weil sie sich zum allergrößten Theil in Pension geben, dort gewissermaßen ein Stück Old-England bildend, welches unversehrt und unvermischt auf dem fremden Meere herumschwimmt. Der Deutsche wahrt sich gern seine Bewegungsfreiheit. Sobald er einigermaßen mit der Sprache fortkann, nimmt er bei längerem Aufenthalt eine Privatwohnung und macht nun, die Abwechslung liebend und dem Studium hold, die Runde in den Lokalen. Man erkennt ihn dort im ersten Augenblick seines Hereintretens. Ich konnte mir noch so viel Mühe geben, italienisch auszusehen, und noch so gleichmüthig unsre „due café latte e paste", zwei Tassen Kaffe mit Milch und Gebäck, bestellen, der Kellner brachte uns doch unaufgefordert die deutschen Zeitungen dazu.
Wenn nicht an seinem hellen Haar und seiner helleren Hautfarbe – es giebt ja unter den Italienern fast so viel Blonde als unter den Germanen Dunkelhaarige – an seiner Kleidung und an seinem weichen Filzhut – der Italiener bevorzugt den Cylinder und trägt, sowie das Wetter nur etwas kühl wird, den Pelz oder wenigstens Pelzkragen – wenn nicht an seiner Brille, durch welche der Deutsche im Auslande überall erkennbar ist, unterscheidet man ihn am Abnehmen des Hutes in einem öffentlichen Lokal. Der Engländer nimmt den Hut überhaupt nur im Salon ab, der Italiener lüftet ihn, wenn er in einen besuchten Ranm tritt und wenn er diesen verläßt, behält ihn aber, eine für unser Gefühl unfein wirkende Sitte, während [371] des ganzen Abends auf dem Kopfe. Der Deutsche allein zieht ehrfurchtsvoll vor den Penaten jedes fremden Hauses seine Kopfbedeckung und setzt sie nicht eher auf, als bis er wieder auf dem Flur ist. Dasselbe gilt von einem Besuch im Geschäftszimmer. Beim Essen unterhalten sich unsere Landsleute für italienisches Anstandsgefühl zu laut. Das Lärmen, das Anstoßen, die deutsche Fidelitas gilt in Italien nicht für fein, und in einem halbwegs guten Restaurant geht es viel geräuschloser zu als bei uns. Bezeichnend ist auch die Stellung zu den Kellnern. Der Italiener ist mit den Speisen viel wählerischer als wir, und oft sendet er einen Theil der Gerichte, welche ihm aufgetischt wurden, als nicht nach seinen Wünschen wieder nach der Küche; aber er streitet niemals laut mit der Bedienung, sondern die Verhandlungen werden ganz leise, ich möchte sagen freundschaftlich geführt. Man erkennt nur an dem eigenthümlichen Spiel der Hände, um was es sich handelt, und mit der lächelndsten Miene der Welt nimmt der Kellner die verschmähte Ware zurück. Das „Anschnauzen“ ist überhaupt eine im Auslande recht auffallende Eigenthümlichkeit vieler Deutscher, welche auch dem Engländer fremd ist. Ein Bettler stellt sich in den Weg. Der Engländer sieht über ihn hinweg, als wenn er Luft wäre: er giebt aus Grundsatz nichts. Der Italiener bewegt den Finger hin und her, was so viel heißt wie „Nein“, oder er sagt einige verbindliche Worte und schreitet weiter. Der Deutsche runzelt die Stirn, fährt den Lästigen mit ein paar groben Redensarten an, die sich um so komischer machen, als sie gewöhnlich nicht richtig sind, und greift dabei doch nach seinem Geldbeutel.
Während der Amerikaner und Engländer sich selten abmüht, der Sprache Herr zu werden, meint es der Deutsche sehr ernst mit seinem Sprachstudium, und er bringt es nach einigen Jahren auch dahin, die Sprache fertig zu sprechen und zu verstehen. Freilich bleibt ihm die besondere Art der Aussprache meist sein Lebtag treu. Im einsamen und romantischen Kloster Trefontane bei Rom wurden wir von einem Mönch empfangen und herumgeführt, dessen Italienisch eine mir ganz sonderbar vorkommende Färbung trug. Ich äußerte meiner Frau gegenüber auf deutsch, wie interessant es doch sei, daß sich die gleiche mundartliche Unregelmäßigkeit, die des Fallenlassens der Endkonsonanten und Endvokale und das eigenthümliche Singen, in jeder Sprache wiederhole, und daß, wenn man nicht genau wüßte, dieser Frate sei hier geboren und erzogen, man glauben könnte, einen Rheinhessen italienisch sprechen zu hören. Da sah uns der Italianissimo groß an und sagte: „Bin ich auch, meine Herrschafte! In Heppeheim hat mei Wiek gestande! Leb’ aber scho dreißig Jahr in Italie!“
Uebrigens hört man in Rom auf Schritt und Tritt deutsch sprechen. Alle Fremden befinden sich ja auf der Straße, in den Museen, in den Kirchen. Die großen, noch immer prunkvollen Feste in St. Peter oder dem Lateran sind ein Stelldichein aller Kolonien, und während derselben hört man fast ausschließlich englisch und deutsch reden; Frankreich reist sehr wenig. Außerdem spricht die schweizer Ehrengarde den unverfälschten schweizer Dialekt. Deutsche Klänge dringen uns ferner vertraulich ins Ohr in der Nähe der deutschen und österreichischen Botschaften, von Schülern des kaiserlich deutschen archäologischen Instituts, welches in neuerer Zeit auch Rundreisen von deutschen Gelehrten durch das antike Italien veranstaltet; von den in langen Trupps, stets zu zwei und zwei, durch die Straßen ziehenden deutschen geistlichen Alumnen im scharlachrothen Gewande; von den zahlreichen deutschen Kunststipendiaten, welche sich in dem Lande der Schönheit mit Anschauungen für ihr Leben vollsaugen, übrigens kein gemeinsames Heim haben wie die auch sonst viel besser gestellten Kunstschüler Spaniens und Frankreichs. Deutsche Predigten hört man in der Kirche Santa Maria dell’ Anima zu Rom, in welcher auch der deutsche Papst Hadrian IV. begraben liegt, und in der deutschen Botschaftskapelle im Palazzo Caffarelli.
Wie wenig man aber beispielsweise in Neapel, trotz seiner deutschen Klubs und deutschen Schulen, trotz des bedeutenden Antheils der Deutschen am Handelsleben der Seestadt, auf den Straßen deutsch reden hört, dafür spricht, daß uns ein junges deutsches Mädchen an der Via di Roma, dem früheren Toledo, ohne weiteres anredete, weil sie nach unserem Sprechen in uns ein landsmännisches Gefühl voraussetzte, nachdem sie stundenlang vorher in heller Verzweiflung nach solcher Hilfe umhergesucht hatte. Sie hatte sich auch nicht geirrt: das arme Ding, welches durch Empfehlung eines Bureaus als Bonne in ein italienisches Haus gekommen war, hatte ihre dortige Stellung infolge von Eifersüchteleien der Frau wieder verlassen müssen, ehe sie Zeit gehabt hatte, einigermaßen die Sprache des Landes zu erlernen; nun wurde sie durch Bemühungen einiger deutschen Freunde, an welche wir sie empfehlen konnten, gut untergebracht.
Man darf aber dieses Vorkommniß nicht über Gebühr verallgemeinern. Für stellungsuchende junge Mädchen ist natürlich alle Vorsicht geboten, sonst genießen indessen unsere Landsleute ein gutes Ansehen. Man bringt ihnen allerseits auch im Volke, welches allerdings die Fremden germanischer Herkunft oft unter dem Gesammtnamen „Inglesi“, Engländer, zusammenfaßt, einen großen Respekt, wenn auch nicht gerade immer Verständniß für ihr innerstes Wesen entgegen. Die deutsche Musik findet z. B. jenseit der Alpen nicht allzu großen Widerhall. Im Salon sind wohl Beethoven, Mozart, Schumann und Schubert heimisch, in der Oper errangen einige Wagnersche Musikdramen Erfolg; aber in den breiten Massen des italienischen Volkes hat die deutsche Musik keinen festen Fuß gefaßt.
Ueber die Schicksale der deutschen Handwerker in Italien machte ein schon zwanzig Jahre dort lebender Deutscher eine auffallende Beobachtung. In der ersten Zeit ihres Daseins überflügeln sie ihre italienischen Kollegen und lassen ihre Mitbewerber schnell hinter sich. Das kommt daher, daß sie von Hause aus an eine größere Strenge des Arbeitens, an mehr Stetigkeit und Ausdauer gewohnt sind. Die Italiener sind, wie unser Gewährsmann sich ausdrückte, mehr „geniale Pfuscher“, welche ohne Schulung mehr nach dem Instinkte drauf los arbeiten und, wenn sie nicht den scharfen Wettbewerb eines Ausländers zu bestehen haben, damit auch vorwärts kommen können. Nach mehreren Jahren aber pflegt sich das Blatt zu wenden. Der größte Theil unserer Landsleute wird dann, sei es durch den Einfluß des Klimas, sei es durch den leichteren Erwerb, nachlässig und schlaff, und da sie von Hause aus gewohnt sind, besser zu leben, auch manchmal einen Tropfen über den Durst zu trinken, so geht es mit ihnen, wenn sie sich nicht mit Aufbietung aller Kräfte obenauf halten, schnell bergab.
Eine Stätte giebt es im Süden Italiens, wo deutscher Geist zweifellos die Führung erhalten hat, die Insel der Maler, Capri. Dieses wonnige Eiland, dessen reizvolles Profil neben dem rauchenden Vesuv das charakteristische Wahrzeichen des Golfes von Neapel bildet, ist wie eine schimmernde Perle, welche die Götter der deutschen Malerzunft in der Schale des blauleuchtenden Weltmeers als Geschenk dargebracht haben. Ein Deutscher, August Kopisch, hat vor Jahren die blaue Grotte, dieses Oceanwunder, und damit einen Hauptanziehungspunkt der Insel entdeckt, und eine ungeheure Palme kündet weithin aus dem steinernen Häusergewirr der Insel die Stelle des Albergo Pagano, der berühmten Künstlerherberge, deren Wandflächen bis in die obersten Stockwerke Fresken und Inschriften tragen, mit denen fröhliche Maler und Dichter sich verewigt haben. Nach alter Ueberlieferung wird hier zu musterhaft billigen Preisen zweimal des Tages gespeist, und etwa achtzig Theilnehmer, fast ausschließlich Landsleute, aber von den verschiedensten Berufsarten, bilden eine so ungezwungene und von der Großartigkeit der Natur immer wieder aufs neue angeregte Tafelrunde, wie sie wohl kaum ein zweites Mal auf der Welt besteht. Im Gegensatz zu Neapel ist auf dieser Felseninsel alles blanksauber. Die armen Bewohner zeigen eine Formenschönheit, wie man sie sonst nirgends in Italien findet, und die schlanken Gestalten der Knaben und die vollbärtigen Köpfe der Männer bilden das Entzücken der Künstler. Kleine Buben, welche den Malern in der Rolle von Farbenreibern oder Trägern bei ihren Jagden auf schöne Veduten als Gefolge dienen, haben gelehrig deutsche Laute aufgeschnappt, und das erste Lied, welches ein vor mir hertänzelnder schwarzlockiger Junge mir lachend vorsang, hieß: „Du bist verrückt, mein Kind“.
In Capri schweigen selbst die Krittler, und die sauertöpfigsten Reisenden gehen zur Partei der Schwärmer über. In diese beiden Feldlager kann man nämlich die Deutschen in Italien scheiden. Die einen fühlen sich fortwährend unglücklich, beleidigt, angewidert. Der Lärm der Räder und Ausrufer macht sie nervös, das Oel der Speisen verdirbt ihnen den Magen, die Bettelei empört sie, das Vordringen moderner Kultur in die alten Heimstätten klassischer [372] Ruinenromantik erregt ihre Entrüstung. Sie ziehen in einem fort Vergleiche mit der Heimath oder mit früheren Zeiten, und nur ein kräftigeres Ausschimpfen kann das Gleichgewicht ihrer Seele wieder herstellen. Die anderen befinden sich in einem dauernden Rausche des Entzückens. Sie glauben, in diesem Zauberlande alles schön finden zu müssen, jedes zerbrochene Säulenkapitäl setzt sie in Ekstase und dem schmutzigsten Ciociarenkinde möchten sie einen Kuß auf das ungewaschene Mäulchen drücken. Eine solche Schwärmerin besuchte uns in Rom. Es war spät am Abend, und obwohl wir im geschlossenen Wagen bei Regenwetter mit ihr vom Bahnhofe nach Hause fuhren, kam sie ganz aufgeregt von all den Herrlichkeiten, Tempeln, Säulen, Kuppeln und Statuen, welche sie im Fluge durch das Fenster gesehen zu haben glaubte, bei uns an. Es that ihrer Schwärmerei auch keinen Abbruch, als wir ihr nachwiesen, daß die Gardinen heruntergezogen gewesen waren: sie hatte die Schönheiten Roms – gefühlt.
Es giebt übrigens auch Schwärmerei auf der anderen Seite. Die Italiener, stolz auf ihr Land und sehr geschmeichelt, wenn man recht viel lobt und anerkennt, zeigen sich gern durch eine Art vielleicht mehr eingeredeter als selbstempfundener Begeisterung für das deutsche Volk und Wesen erkenntlich. Ein junger Mann, Student, welcher unser Entzücken über die Aussicht von dem Palatin auf die Ewige Stadt mit Freuden wahrnahm, erzählte uns in ziemlich gebrochenem Deutsch, daß für ihn und viele seiner Freunde Deutschland das Land der Vollkommenheit und Sehnsucht bilde. Er kenne es ziemlich genau aus seiner Litteratur. Als wir in ihn drangen, was er unter deutscher Litteratur verstehe, beschränkte er seine Angaben auf drei Werke. Das erste war „Go-ethe". Was der junge Mann von unsrem Altmeister eigentlich gelesen hatte, ist nicht ganz klar geworden; er blieb dabei, daß er Go-ethe kenne. Das zweite war die Geschichte Roms von Gregorovius, das dritte – „Buchholzens in Italien“.
Der Kommissionsrath.
(Schluß.)
Wie der denkwürdige Tag der Ernennung, so gingen viele Tage dahin. Die Sorge um seine neue Würde nahm Herrn Stevenhagen dermaßen in Anspruch, daß er darüber alles andere mehr oder weniger vergaß und vernachlässigte. Glücklicherweise litten weder das Geschäft noch der Haushalt darunter, denen Fritz und Frau Mathilde in unveränderter Tüchtigkeit vorstanden; immerhin fing aber Frau Stevenhagen mit der Zeit an, etwas beunruhigt zu werden. – Ihr Mann war nicht mehr der alte, das zeigte sich namentlich darin, daß er mit vielen Dingen, auf die er früher gar nicht geachtet hatte, unzufrieden wurde und sich über eine Anzahl seiner Mitbürger zu beklagen begann. Er ließ einen Theil der Möbel erneuern, das Haus frisch anstreichen, er bestellte sich einen neuen Anzug, obgleich der, den er trug, noch jahrelang gute Dienste hätte leisten können. Er bemerkte, daß der Fleischermeister beim Gruße seine Mütze nur berührt, nicht abgezogen hatte; er fand es nicht in Ordnung, daß Agathe, deren Bäckerladen fünfzig Schritte von der Wohnung ihrer Eltern entfernt war, auf ihrem Hause mit bloßem Kopfe herübergelaufen kam. „Das schickt sich nicht, Agathe, das schickt sich nicht! Thu’ mir den Gefallen und setz’ den Hut auf, wenn Du auf die Straße gehst.“ Auch an den „Borsdorfer Aepfelchen“ entdeckte er plötzlich Unarten, die ihm früher nicht aufgefallen waren. Sie machten keine ordentlichen Diener, wenn sie in das Zimmer traten, und
sie suchten ihre Gesellschaft am liebsten unter der verwildertsten Straßenjugend. Aber das Bedenklichste für Frau Mathilde war, daß Stevenhagen sogar aufhörte, mit dem Benehmen des Doktors zufrieden zu sein. Dieser hatte die Schrullen seines Freundes monatelang geduldig ertragen, obgleich er schon nach den ersten vier Wochen aufgehört hatte, sich darüber zu freuen; aber mit der Zeit konnte er doch nicht mehr umhin, Stevenhagen hier und da auf einige seiner Sonderbarkeiten aufmerksam zu machen. Und darüber kam es eines Tages zu einem kleinen Wortwechsel. Als Stevenhagen sich nämlich im Beisein seines alten Freundes über den unhöflichen Gruß des Fleischermeisters beklagte, sagte der Doktor, der einen Theil der Nacht am Bette eines schwerkranken Mannes verbracht hatte und übler Laune war: „Laß’ das doch! Was macht es aus, wie Kunhart Dich grüßt!“
„Mir ist es auch ganz gleichgültig, wie der ungehobelte Mensch sich benimmt,“ antwortete Stevenhagen, „aber daß es nicht in der Ordnung ist, mir einfach zuzunicken wie einem Tagelöhner oder Gesellen, das wirst Du doch selbst zugeben.“
„Nein, das gebe ich nicht zu,“ erwiderte der Doktor verdrießlich, „ich bin ebensowenig wie Du Tagelöhner oder Fleischergeselle, und mich grüßt Kunhart nicht ehrerbietiger als Dich.“
„Wenn Du Dir das gefallen läßt, so ist das Deine Sache,“ entgegnete Stevenhagen, ich lasse es mir nicht gefallen.“
„Nun dann laß’ es Dir nicht gefallen! Ich bin zu müde, um mich mit Dir über solche Lappalien zu streiten.“
Der Zwischenfall hatte keine unmittelbaren Folgen. Der Doktor fand sich am Abend zur üblichen Stunde zur Partie l’Hombre ein, und die Verstimmung, mit der Stevenhagen und er sich eine Zeitlang gegenüber gesessen hatten, ging bald vorüber. Aber Aehnliches ereignete sich bald öfter, und mit der Zeit bildete sich bei Stevenhagen eine gewisse Erbitterung gegen seinen alten Freund, während der Doktor, der Pastor und der Postmeister sich mehr als einmal darüber aussprachen, daß Stevenhagen seit seiner Ernennung zum Kommissionsrath viel von seiner alten einfachen Liebenswürdigkeit eingebüßt habe. Sie wurden dem Würdenträger gegenüber vorsichtiger und zurückhaltender in ihren Aeußerungen, und damit ging ein großer Theil der harmlosen Heiterkeit verloren, die bis vor kurzem die Zusammenkünfte der vier alten guten Spielkameraden gekennzeichnet hatte. Stevenhagen konnte sich der Erkenntniß dieser Veränderung auf die Dauer nicht verschließen; die Betrachtungen, die er darüber anstellte und auch seiner Frau mitzutheilen pflegte, waren für diese geradezu Besorgniß erregend. Er redete sich mit der Zeit ein, die Unfreundlichkeit seiner Genossen, namentlich des Doktors, beruhe auf Neid.
„Nicht gerade bösartigen scheelen Neid, liebe Mathilde, empfindet der Mann, aber glaube mir nur, er fragt sich, ob er nicht eben so gut, wie ich zum Kommissionsrath ernannt worden bin, den ‚Sanitätsrath‘ verdient hätte. Es ist ja nicht meine Schuld, daß man nicht daran gedacht hat – ich würde ihm jede Auszeichnung von ganzem Herzen gönnen. Aber daß es nicht geschehen ist, ärgert ihn, und er kann es nicht über sich gewinnen, seinen Verdruß nicht an mir auszulassen.“
Frau Mathilde hatte eine Zeitlang versucht, ihrem Konstantin solche Gedanken auszureden, doch als sie sah, daß es nichts fruchte, daß sie sich der Gefahr aussetze, mit ihrem Manne uneins zu werden, mit dem sie bis dahin in ungetrübter glücklicher Ehe gelebt hatte, da gab sie den vergeblichen Versuch auf, Frieden zu stiften, die langsam absterbenden freundschaftlichen Gefühle ihres Mannes für den Doktor wieder zu erwecken. Sie blickte nur traurig und still vor sich hin, wenn Stevenhagen in seiner lieblosen Beurtheilung immer weiter ging und sich langsam aber stetig in Einbildungen hineinredete, die schließlich zu Gefühlen verborgenen Uebelwollens, geheimer Feindschaft ausarteten. Die Folge davon war, daß, nachdem einmal eine gewisse Entfremdung zwischen den beiden einst so befreundeten Menschen eingetreten war, ihre Beziehungen schnell an Annehmlichkeit und Vertraulichkeit verloren und daß bald der eine, bald der andere sich entschuldigen ließ, an den regelmäßigen Kegel- und l’Hombrepartien nicht theilnehmen zu können. Und schließlich kam es zu einem für alle Betheiligten – die vier Mitglieder der Partie und Frau Mathilde – gleich schmerzlichen Bruche.
Der Doktor hatte eines Abends beim Kartenspiel mit einem großen Einsatz auch die Geduld verloren und dem Herrn Kommissionsrath Stevenhagen, der an jenem Abend noch anspruchsvoller erschien als gewöhnlich, kurz und bündig gesagt, er mache sich „lächerlich“; worauf der in seiner Würde tief gekränkte Mann seinen Hut genommen hatte und davongegangen war. Die Versöhnungsversuche, die am nächsten Tage gemacht wurden,
[373][374] blieben erfolglos. Stevenhagen verlangte, der Doktor solle Abbitte thun; dieser, dessen Geduld zu Ende war und der thatsächlich kein Vergnügen mehr empfand am Umgang mit dem „eingebildeten Narren“ – wie er Herrn Stevenhagen hinter dessen Rücken zu nennen wagte – erklärte unumwunden, es falle ihm gar nicht ein, Abbitte zu leisten, ja auch nur eine Silbe von dem zurückzunehmen, was er gesagt habe. Stevenhagen habe sich lächerlich gemacht, und er, der Doktor, beharre auf seiner Behauptung. Ja, er wolle sich mit Stevenhagen übers Schnupftuch schießen, wenn er auf Genugthuung bestehe. Wenn er dagegen versprechen wolle, in Zukunft wieder ein vernünftiger Mensch zu werden, so werde er, Nehring, sich freuen, von neuem mit ihm zusammenzutreffen. Andernfalls möge Herr Konstantin Stevenhagen, Königlicher Kommissionsrath, Inhaber der hundertundeinjährigen Firma „Samuel Stevenhagen Söhne Nachfolger“, ihn ungeschoren lassen.
Damit hatten die schönen Abende des armen Stevenhagen ihr Ende erreicht. Der Pastor und der Postmeister theilten ganz und gar die Meinung des Doktors, und die drei suchten nach einem neuen vierten Manne und fanden ihn in der Person des Rentmeisters. Dieser besaß zwar nicht alle Tugenden, die seinen Vorgänger zu dessen guter Zeit so liebenswürdig gemacht hatten, aber er war frei von den Fehlern, die Stevenhagen seit seiner Ernennung zum Kommissionsrath zu einem schwer umgänglichen Menschen stempelten.
Der Kommissionsrath ertrug die Langeweile, zu der er verdammt war, nur kurze Zeit. Seit Monaten bereits regten sich in seinem tiefsten Innern Gedanken, die er bisher selbst seiner Frau gegenüber verborgen gehalten hatte. Er wollte seine Vaterstadt verlassen, wo er nicht die gebührende Anerkennung fand, wollte nach einer großen Stadt, ja er wollte nach Berlin ziehen, um dort in der Gesellschaft von Standesgenossen den Verkehr und die Achtung zu finden, auf die er berechtigten Anspruch erheben durfte. Es kostete ihn einen Entschluß, dies Frau Mathilde gegenüber auszusprechen, aber nachdem es einmal geschehen war, ging er unbekümmert um die Thränen und den Widerspruch seiner Frau, seiner Tochter und seines Schwiegersohnes dem Ziele zu, das er sich gesteckt hatte. Er berieth nicht mehr mit Frau Mathilde, wie dies früher seine Gewohnheit gewesen war, sondern erklärte einfach, was er zu thun beabsichtige und thun werde. Das Geschäft verkaufen? Nein, das wollte er nicht – er hatte es von Anfang an seinem Enkel Anastasius Mertens bestimmt, und Anastasius sollte es später bekommen. Einstweilen konnte Fritz es weiter verwalten, dessen Gehalt erhöht und dem außerdem ein kleiner Antheil an dem Gewinn des Geschäfts zugesichert werden mußte. Frau Mathilde sollte selbstverständlich mit nach Berlin ziehen. Die Wohnung, die somit leer würde, konnte theilweise unbewohnt bleiben, denn sie zu vermiethen, wäre der Stellung des Herrn Kommissionsrathes unwürdig gewesen. Fritz, mit dem Herr Stevenhagen schon gesprochen, hatte sich dankend damit einverstanden erklärt, seine eigene Wohnung aufzugeben und sich in zwei Zimmern des großen Hauses seines Chefs einzurichten. Mit Hilfe des Comptoirdieners und einer alten Dienstmagd, auf die man sich ganz verlassen durfte, konnte Fritz auf diese Weise Geschäft, Haus und Wohnung gut in Ordnung halten; nöthigenfalls war noch ein Lehrling anzunehmen, der ihm beim Verkauf behilflich sein würde. Von Zeit zu Zeit wollte Stevenhagen nach seiner Vaterstadt zurückkehren, um zu sehen, ob im Geschäft alles in Ordnung sei, und um seine Tochter und die beiden Enkelkinder zu besuchen. Frau Mathilde sollte ihren Mann auf diesen Reisen begleiten.
Eines Abends kündigte Stevenhagen seiner Frau an, er werde Ende der Woche nach Berlin fahren, um dort eine Wohnung zu miethen. Diese Nachricht versetzte die arme Frau in schmerzliche Aufregung; sie verbrachte eine schlaflose Nacht, aber sie wagte nicht, ihrem Manne zu widersprechen, da er sich für ihre Einwendungen gar nicht mehr zugänglich zeigte und bereits verschiedene Male, wenn sie ihm widersprochen hatte, so heftig und böse geworden war, daß die gute, ihr ganzes Leben lang an die beste Behandlung gewöhnte Frau Mathilde sich dadurch vollständig hatte einschüchtern lassen. Sie lief am nächsten Morgen zu ihrer Tochter und später auch zum Doktor und zum Pastor, um diesen ihr Leid zu klagen; sie fand auch allerorten Verständniß und innige Theilnahme, aber zu rathen und zu helfen wußte ihr niemand.
Am bestimmten Tage reiste Herr Stevenhagen nach Berlin ab, und eine Woche später kehrte er stolz und zufrieden zurück und kündigte seiner Frau an, er habe eine passende Wohnung gefunden, die gerade frei sei und die er so bald als möglich zu beziehen wünsche. Darauf gab er umsichtige Anleitung, das Ergebniß reifer Ueberlegungen, auf welche Weise die Uebersiedlung nach Berlin stattzufinden habe; die großen schweren alten Möbel sollten zurückbleiben, der Rest werde mehr als reichlich genügen, die kleinere Berliner Wohnung standesgemäß auszufüllen. Frau Mathilde hörte alles mit an in stummer willenloser Traurigkeit und bat nur, Stevenhagen selbst möge die Oberleitung des Umzuges übernehmen, da sie sich der Aufgabe nicht gewachsen fühle. „Natürlich werde ich das thun,“ sagte der Herr Gemahl. „Frauen verstehen von solchen Sachen nichts.“
Während der nächsten vierzehn Tage war er von früh bis spät beschäftigt, das Einpacken aller Sachen, die mit nach Berlin genommen werden sollten, und das Aufladen der Möbel und Kisten auf die großen Möbelwagen zu überwachen. Er verrichtete das nicht ohne Geschick, denn als kleiner Kaufmann, der sein Geschäft gründlich verstand und sich mit allen Zweigen desselben praktisch beschäftigt hatte, ging ihm die Arbeit, die er übernommen hatte, ordentlich und verhältnißmäßig leicht von der Hand. Frau Mathilde irrte wahrend dieser Zeit wie ein unsteter Geist im Hause umher oder saß bei ihrer Tochter und weinte.
Die Einwohner des Städtchens schüttelten die Köpfe über das thörichte Gebahren ihres Mitbürgers, der Doktor wiederholte jedem, der es hören wollte, der Königliche Herr Kommissionsrath leide an Größenwahn; aber der Doktor sowohl wie der Pastor und Postmeister waren im innersten Herzen tief bekümmert über das, was unter ihren Augen vorging. Nur Fritz bewahrte seinen Gleichmuth, ja das Gefühl der großen Verantwortlichkeit, die jetzt auf ihn geladen wurde, versetzte ihn in eine gehobene Stimmung. Er wollte sich des Vertrauens, das ihm geschenkt wurde, würdig zeigen und war unermüdlich in der Ausübung seiner zahlreichen kleinen Pflichten.
Und so kam der Tag des Umzugs und des thränenreichen Abschieds, bei dem nur Herrn Stevenhagens Augen trocken blieben. Er hatte sich eine kleine Rede erdacht, die ihm wohl sehr gefallen mußte, denn er wiederholte sie viele Male.
„So weint doch nicht, Kinder,“ sagte er, „wir gehen ja nicht nach Amerika – wir ziehen einfach nach Berlin. Ich kann mich telegraphisch von dort aus schneller mit Euch unterhalten, als wenn Ihr auf einem Dorfe eine Stunde Weges von hier wohnen würdet. Ihr seid noch Kleinstädter, aber Ihr sollt uns eines nach dem anderen in Berlin besuchen und das Leben und Treiben der großen Stadt wird Euch von Eurer Kurzsichtigkeit und Schwäche heilen. Und dann – in acht Stunden kann ich von Berlin hier sein, und wir werden Euch häufig besuchen. Also weint nicht, Kinder, und seid vernünftig!“
Etwas wie wahre Rührung kam nur über ihn, als er die „Borsdorfer Aepfelchen“ zum letzten Male vor der Abreise küßte. Allein er überwand diese Aufwallung schnell wie eine seiner Stellung unwürdige Schwäche und setzte sich stocksteif in den Wagen, in dem die schluchzende Mathilde, das thränenfeuchte Taschentuch vor den Augen, bereits Platz genommen hatte.
| * | * | |||
| * |
Es war so gekommen, wie der Doktor es vorhergesagt und Frau Mathilde und Agathe und auch der Bäckermeister es befürchtet hatten. Stevenhagen und seine Frau fühlten sich in Berlin unglücklich. Eine Zeitlang hatte die Einrichtung der Wohnung den beiden zu schaffen gegeben; dann hatten sie die Sehenswürdigkeiten Berlins besucht: das Aquarium, das Panoptikum und den Zoologischen Garten, und hatten sich sehr gut unterhalten; dann die Museen, in denen ihre Aufmerksamkeit schnell ermüdet war, das Zeughaus, die Kirchen, die Brücken, die bemerkenswerthen Gebäude, Denkmäler und so weiter und so weiter. Sie waren des Abends gewöhnlich so müde nach Hause gekommen, daß ihnen nicht einmal das Essen geschmeckt hatte, und dann stets frühzeitig zur Ruhe gegangen.
Nachdem die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt besichtigt waren, hatten unsere Freunde den Theatern, Konzerten und öffentlichen Vergnügungslokalen ihre Zeit zugewandt; aber auch diese Freude hatte bald ihr Ende erreicht, denn Stevenhagen eilte von einem [375] Orte zum anderen, als ob ihm nur knrze Zeit zur Verfügung stehe, um alles in Augenschein zu nehmen. Und nach einigen Wochen waren sie mit der ganzen Arbeit – denn eine Arbeit war es gewesen – fertig, und Berlin, soweit sie in der Lage waren, es jemals kennenzulernen, hatte keine Geheimnisse mehr für sie.
Frau Mathilde, deren Wissensdrang überhaupt ein sehr geringer war, fühlte sich immer in ihren vier Pfählen noch am wohlsten; sie hatte auch in Berlin die Gewohnheit nicht aufgeben können, sich viel um die Wirthschaft zu kümmern, was bei den neuen Dienstboten, die ihr zur Hand gingen, auch viel nothwendiger erschien als zu Hause in N. Sie war ihrem Konstantin immer bereitwillig gefolgt, wenn dieser sie angetrieben hatte, sich zum Ausgehen fertig zu machen, weil es sich darum handelte, dies oder jenes zu sehen und zu hören. Aber nun, da ihr Mann keine neuen Vorschläge mehr zu machen hatte, wandelte sie still waltend von einem Zimmer zum anderen oder saß mit einer Handarbeit auf dem Sofa, nach außen hin genügend beschäftigt, im Geiste „zu Hause“ bei ihrer Tochter und ihren Enkelkindern. Stevenhagen aber wußte sich gar nicht zu helfen. Er erhielt allwöchentlich Berichte über den Geschäftsgang, die er aufmerksam las und auf deren Beantwortung er so viel Zeit wie möglich verwandte; allein bei „Samnel Stevenhagen Söhne Nachfolger“ war alles so schön geordnet, ging alles seit so vielen Jahren so sehr in demselben Geleise, und Fritz wußte so genau, was er zu thun hatte, und stand seinen Obliegenheiten mit solchem Eifer vor, daß das Geschäft, welches früher Herrn Stevenhagen den ganzen Tag in Anspruch genommen hatte, ihn jetzt nicht länger als ein oder zwei Stunden die Woche kostete. Im übrigen war der gute Mann rathlos. Er interessierte sich für nichts, was in der politischen Welt vorging, aus dem einfachen Grunde, weil er davon nichts verstand; er hatte auch nicht gelernt, sich die Zeit mit Bücherlesen zu vertreiben. Sein Leben bis dahin war gewesen: Arbeit im Geschäft, Erholung im kleinen Kreise guter Freunde. Jetzt fehlte ihm die gewohnte Arbeit sowohl wie die Erholung – doch klagte er nicht.
Um seiner Frau die Langeweile zu verbergen, die wie ein schwerer Kummer an seiner Seele nagte, ging er am Tage viel aus, unter dem Vorwand, er wolle dies oder jenes wieder sehen, von dem er behauptete, es habe ihm besonders gefallen. Frau Mathilde theilte seinen Geschmack nicht und sagte dann gewöhnlich: „So geh’ nur lieber allein, ich habe im Hause genug zu thun“ – und er ging allein. Aber weder in das „schöne“ Panoptikum, noch in das „merkwürdige“ Aquarium, noch in den „großartigen“ Zoologischen Garten. Er ging einfach spazieren, „Unter den Linden“, in der Thiergartenstraße, in der Friedrichsstraße, in der Leipzigerstraße – und er fühlte sich in der Menge, die ihn umgab und manchmal geradezu beängstigte, vereinsamt und verlassen. Bekannte hatte er gar nicht in Berlin, nicht einmal sogenannte Geschäftsfreunde; „Samuel Stevenhagen Söhne Nachfolger“ bezogen ihren „Bedarf“ aus Stettin. Auch mit Standesgenossen war es ihm nicht gelungen, zusammenzutreffen. Die Herren Kommissionsräthe bildeten nicht ein Regiment im Staate, in dem er Soldat gewesen wäre und kameradschaftliche Beziehungen hätte anknüpfen können – Die schreckliche Langeweile hatte ihn einmal in einem Bierlokal dazu veranlaßt, sich den Adreßkalender geben zu lassen, und er hatte angefangen, darin zu lesen. Jedesmal, wenn er hinter einem Namen den Titel „Kommissionsrath“ oder „Geheimer Kommissionsrath“ gefunden hatte, war ihm der Gedanke gekommen, den einen oder den anderen dieser Herren Kollegen aufzusuchen. Aber zu wem sollte er gehen? Dieser war Schauspieldirektor, jener Rentier, ein dritter Inhaber eines Geschäfts wie er selber. Unter welchem Vorwand hätte er sich an sie wenden können? Herr Stevenhagen hatte noch niemals in seinem Leben aus eigenem Antrieb und ohne daß er durch die Verhältnisse dazu veranlaßt worden war, eine neue Bekanntschaft angeknüpft. Er hätte nicht gewußt, wie er sich bei Herrn Kommissionsrath A. oder Herrn Geheimen Kommissionsrath B. vorstellen solle, und es überkam ihn die gar nicht unbegründete Befürchtung, der eine oder andere möchte ihn vielleicht gar für einen Hochstapler halten. Denn zu der Erkenntniß war er bereits gelangt, daß der Titel, auf den er so stolz war, ihn nicht ermächtigte, bei anderen, einfach weil sie den gleichen trugen, um kollegialischen Verkehr nachzusuchen. – Einige Wochen gingen dahin, und Herr Stevenhagen wurde immer trauriger, und seine gute Frau Mathilde konnte beim besten Willen nichts thun, ihn aufzuheitern, denn ihr selbst war das Herz auch schwer; nur daß sie dank der Beschäftigung, die sie hatte, die Einsamkeit besser ertragen konnte als ihr Mann.
Die Tage wurden kürzer, die Spaziergänge nach Tische mußten eingestellt werden; Stevenhagen versuchte dem „Kneipen“ Geschmack abzugewinnen, aber es gelang ihm nicht. Er war kein Biertrinker, saß eine halbe Stunde lang über dem Kruge, den man ihm vorgesetzt hatte, beobachtete mit einer Art von Neid die benachbarten Tische, an denen so viele Leute saßen, die sich vortrefflich zu unterhalten schienen, und schlich dann traurig, wie er gekommen war, wieder nach Hause.
Da kam eine Art Rettung in der Noth: ein Brief von Fritz, der ankündigte, er sei krank, er könne im Augenblick beim besten Willen dem Geschäft nicht vorstehen und bitte Herrn Stevenhagen, einen neuen Vertreter zu ernennen oder, was noch unendlich viel besser wäre, selbst auf einige Tage zurückzukommen, denn er hoffe, daß er bald wieder in der Lage sein werde, seinen Verpflichtungen im Geschäft vollständig nachzukommen. – Ein Vertreter konnte natürlicherweise nicht ernannt werden; daran dachte Herr Stevenhagen nicht eine Sekunde. Er und Frau Mathilde packten noch am selben Tage einige Sachen zusammen und reisten nach N. zurück. Sie hatten ihre Ankunft telegraphisch angezeigt und wurden schon auf der Eisenbahnstation, die eine Stunde Weges von N. entfernt war, von Agathe und den beiden „Borsdorfer Aepfelchen“ empfangen. Das war eine Freude! Sie dauerte indessen nicht lange.
Fritz war in der That leidend, unfähig, aufzustehen; aber seine Krankheit war nicht bedenklich – er hatte die Masern und unglücklicherweise ganz gutartige, so daß das Uebel in vierzehn Tagen vollständig gehoben war und Stevenhagen nach dieser Zeit eigentlich keinen Grund mehr hatte, za Hause zu bleiben. Er war dort gelegentlich mit dem Doktor zusammengetroffen, der Fritz regelmäßig besuchte, doch die ehemaligen Freunde hatten es nicht über sich gewinnen können, mehr als einen kühlen Gruß auszutauschen; zu einer Versöhnung war es nicht gekommen.
Als Fritz wieder ganz geheilt war, fand Herr Stevenhagen noch verschiedene Vorwände, um seinen Aufenthalt im Städtchen zu verlängern; lange konnte dies jedoch nicht vorhalten, und eines Abends sagte er mit einem leisen Seufzer: „Ich glaube, liebe Mathilde, wir müssen morgen nach Berlin zurückkehren.“
Frau Mathilde fing sogleich an zu weinen, aber Stevenhagen that, als ob er es nicht sehe, nahm Hut und Stock und ging auf den Wall, wo er einen langen Spaziergang machte. Er wäre ja ebenso gern zu Hause geblieben wie seine Frau, und er hätte ebenso gut weinen können wie diese, wenn er nicht männlich gegen seine Gefühle angekämpft hätte. Aber er durfte nicht zeigen, was in ihm vorging, er durfte dem Doktor, dem Pastor und dem Postmeister nicht dea Triumph bereiten, ihn geschlagen zu sehen. Nein, lieber wollte er weiter dulden! Das war seine Pflicht; er war es sich selbst, war es dem „Kommissionsrath“ schuldig, obgleich dieser in letzter Zeit bei ihm etwas an Ansehen verloren hatte. Er gewährte seiner Frau eine Gnadenfrist von drei Tagen, und dann kehrten sie nach Berlin zurück.
Die große Stadt erschien ihnen öder als je, sie fühlten sich dort vollständig vereinsamt; das kurze Glück, welches ihnen das erneute Zusammensein mit den Kindern und den Nachbarn gewährt hatte, ließ sie ihre traurige Lage doppelt schmerzlich empfinden. Eines Tages, als Herr Stevenhagen nachdenklich am Fenster saß und auf die etwas entlegene Straße hinausblickte, in der er aus Sparsamkeitsgründen seine Wohnung genommen hatte, sah er einen Wagen nahen, der vor der Thüre Halt machte und dem, wie er bemerkte, ein langer, vornehm aussehender Herr entstieg. Gleich darauf hörte er an der Eingangsthür klingeln, und nachdem diese geöffnet worden war, trat das Mädchen in das Zimmer und überreichte ihm eine Karte, die den ihm wohlbekannten Namen seines Landraths trug. Dieser hieß, wie Steveahagen wußte, August mit Vornamen; auf der Karte stand „Harry voa Salwitz.“
„Bitte den Herrn, einzutretea,“ sagte Stevenhagea und erhob sich gleichzeitig, um dem Ankommenden entgegen zu gehen, der sich als der Neffe des befreundeten. Landraths vorstellte.
„Ich bin vorgestern von N. zurückgekommen,“ sagte er, „und soll Ihnen herzliche Grüße von meinem Onkel bringen. Er hat mir aufgetragen, Sie zu besuchen und mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen.“
„Der Herr Landrath ist wirklich zu liebenswürdig! Ich
[376][377] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [378] danke für gütige Nachfrage. Nun, es geht mir den Umständen nach ganz gut ... ganz gut ... Darf ich mich nach der Gesundheit Ihres Herrn Onkels erkundigen?“
Nach dieser Einleitung kam es bald zu einer angenehmen Unterhaltung. Der Neffe des Landraths, der die Gutmüthigkeit und die Artigkeit seines Onkels hatte, mochte wohl den Auftrag erhalten haben, sich nach Stevenhagen umzusehen und sich etwas um ihn zu bekümmern, denn dank den Briefen von Frau Mathilde an Agathe, ihre Tochter, war es in N. kein Geheimniß mehr, daß Herr Stevenhagen sich in Berlin nicht glücklich fühle. Jedenfalls zeigte sich Herr Harry von Salwitz bemüht, den Kommissionsrath zu unterhalten, was ihm auch vorzüglich gelang. Nach einer kleinen Weile sagte er:
„Ich werde Ihnen nächstens ’mal schreiben; wir wollen irgendwo zusammen essen und können dann den Abend miteinander verbringen; Ihre Frau Gemahlin wird sich uns natürlich anschließen. Paßt Ihnen das?“
Es paßte Herrn Stevenhagen ganz vorzüglich, und er nahm die Einladung dankend an. Als die beiden aufgestanden waren und sich langsam der Thür näherten, blieb Harry, noch immer sprechend, an einem Arbeitstisch stehen, auf dem weiter nichts lag als eine Briefmappe, die nothwendigsten Schreibmaterialien und in einer hübschen, alten Porzellanschale einige Visitenkarten – die des Herrn Kommissionsraths selbst. Harry hatte scharfe Augen, die sonderbaren Karten fielen ihm auf, und er entzifferte ohne Mühe, was darauf stand. Ein kaum merkliches Lächeln überflog seine Züge.
„Lieber Herr Stevenhagen,“ sagte er – er war mit seinem Landsmann schnell vertraut geworden – „sind das Ihre Karten?“ Und er nahm eines von den bunten Dingern in die Hand.
„Jawohl,“ antwortete der Kommissionsrath, etwas verlegen, ohne eigentlich selbst zu wissen, warum.
„Hm,“ meinte Harry, „geben Sie die lieber nicht ab. Lassen Sie sich andere Karten machen, wie alle Welt sie hier benutzt.“
„Die Karten sind ein Geschenk meines alten Freundes, des Doktors Nehring, den Sie wohl auch kennen.“
„Jawohl kenne ich ihn, den vortrefflichen alten Herrn! Ich habe ihn vorgestern noch bei meinem Onkel gesehen. Aber wissen Sie, lieber Herr Stevenhagen, der gute Doktor ist auch seit Menschengedenken nicht aus der Provinz herausgekommen und weiß nicht, wie wir hier leben. Zu Hause sind diese Karten wunderschön und ganz in der Ordnung, aber nach Berlin passen sie nicht.“
„Warum denn nicht, wenn ich fragen darf?“
„Ja, was soll ich Ihnen sagen? – Es ist nun einmal ‚Stil‘, daß vornehme Leute solche Titel, die nicht auf eine amtliche Thätigkeit hinweisen, mit ihren Orden zu Hause lassen und nur bei besonderen Gelegenheiten damit hervortreten. Setzen Sie einfach auf Ihre Karten: ‚Konstantin Stevenhagen‘, das genügt für die, die Sie kennen; und diejenigen, die Ihre Bekanntschaft erst später machen, werden auch ohne Ihren Titel auf der Karte bald genug erfahren, mit wem sie es zu thun haben.“
Darauf schüttelten sich beide noch die Hände, und Harry von Salwitz entfernte sich.
Es war gut, daß Frau Mathilde der Unterhaltung nicht beigewohnt hatte; sie würde zwar nichts gesagt haben, was ihren lieben Konstantin hätte kränken können, aber dieser würde auch ohne eine Aeußerung von ihr ihre Gedanken verstanden haben: „Also um dieses traurigen ‚Kommissionsraths‘ willen, den mein Mann, wenn er für vornehm gelten will, nicht einmal auf seine Karte setzen soll, haben wir Haus und Hof, Kind und Enkelkinder, alles, was uns lieb und nahe war, verlassen und sind nach Berlin gezogen? O Thoren, große Thoren, die wir gewesen sind!“ so würde Frau Mathilde gedacht haben, und so dachte auch Herr Konstantin Stevenhagen in seinem Innern. Er fühlte sich beschämt und wahrhaft unglücklich.
Am nächsten Tage erhielt er einen sehr freundlichen Brief von Harry von Salwitz, der ihm anzeigte, er sei in dienstlichen Angelegenheiten plötzlich von Berlin abberufen worden und werde erst in einigen Monaten dorthin zurückkehren. Er bedaure dies lebhaft, da er dadurch verhindert sei, die angenehme Bekanntschaft, die er gestern angeknüpft habe, sogleich so zu pflegen, wie er es gewünscht hätte; er werde nicht unterlassen, Herrn und Frau Stevenhagen nach seiner Rückkehr wieder aufzusuchen, und halte sich den beiden einstweilen bestens empfohlen.
Auf dem Umschlag stand einfach. „Herrn Konstantin Stevenhagen“; der artige, junge Herr hatte es nicht einmal der Mühe für werth gehalten, den kostbaren „Kommissionsrath“ mit darauf zu schreiben. Am Abend konnte Stevenhagen nur wenig essen, die Nacht verlief unruhig, am nächsten Morgen befand er sich unwohl.
„Was fehlt Dir?“ fragte Frau Mathilde besorgt.
Stevenhagen wußte darauf keine bestimmte Antwort zu geben. Es that ihm nichts weh; er fühlte sich nur müde, niedergeschlagen, der Kopf war ihm schwer. „Es wird schon vorübergehen,“ beruhigte er seine Frau.
Aber es ging nicht vorüber; Appetitmangel und Schlaflosigkeit dauerten fort, und nach wenigen Tagen erklärte Stevenhagen eines Morgens, er wolle lieber im Bette liegen bleiben. Nun bestand Frau Mathilde darauf, daß ein Arzt gerufen werde; davon wollte aber Stevenhagen nichts hören.
„Ich will keinen Berliner Arzt,“ sagte er, und nach einer Pause setzte er hinzu: „Ja, wenn wir Nehring hier hätten, das wäre etwas anderes, der kennt mich!“
Das war wie eine Erleuchtung für Frau Mathilde, und sie handelte danach. –
Als Stevenhagen am späten Nachmittag aus einem leichten Schlummer erwachte, in den er gesunken war, sah er seine gute Mathilde neben sich stehen, die ihm freundlich zulächelte und sagte. „Nun sei aber auch gut, Alterchen! Er ist da!“
„Wer?“
„Nun, Nehring natürlich. Ich habe ihn telegraphisch gerufen.“ Und ehe Herr Stevenhagen darauf antworten konnte, trat der treue, alte Freund in das Zimmer. Er näherte sich dem Bette, drückte dem Kranken die Hand und sagte schnell und in sichtbarer Erregung:
„Alles Vergangene sei vergessen, Stevenhagen! Wir sind ein halbes Jahrhundert lang als gute Freunde nebeneinander hergegangen und wollen nicht wegen einer Lappalie in unseren alten Tagen noch Feinde werden.“
„Mein guter Wilhelm,“ murmelte Stevenhagen gerührt.
Darauf begann nun der Doktor den Kranken auszufragen und zu untersuchen. Dann, während Herr Stevenhagen ihn aufmerksam und ängstlich beobachtete, sagte er:
„Die Sache ist ganz einfach: Du brauchst Luftveränderung, und zwar sofort. Die dicke, ozonarme Luft der großen Stadt verträgt sich nicht mit Deiner Konstitution und würde Dich vor der Zeit alt und gebrechlich machen und unter die Erde bringen.“
Stevenhagen hörte mit weit geöffneten Augen an, was sein wiedergefundener Freund sagte.
„Verstehst Du, Alterchen,“ sagte Mathilde, „Luftveränderung ist es, was Du brauchst.“
„Jawohl, jawohl; ich habe sehr gut verstanden!“
„Und wo sollen wir hingehen, lieber Doktor?“ fragte Frau Mathilde, „nach Heringsdorf, Norderney, in den Schwarzwald?“
„Aber liebe, gute Frau Stevenhagen, was fällt Ihnen ein?“ unterbrach sie der Doktor. „Wo, so frage ich Sie, hat sich Ihr Mann fünfundfünfzig Jahre lang wohl und munter wie ein Fisch im Wasser befunden?“
„Zu Hause,“ antwortete Mathilde schüchtern.
„Nun natürlich, zu Hause! Und was beweist das? Daß ‚zu Hause‘ der einzige Ort ist, den ein gut unterrichteter und gewissenhafter Arzt in diesem Falle in Vorschlag bringen und anempfehlen muß; alles andere wäre ein Fehler, möglicherweise ein folgenschwerer Fehler. Konstantin muß wieder nach Hause, und zwar lieber heute als morgen. Er muß um sechs Uhr morgens aufstehen, um eins zu Mittag essen, täglich eine Stunde auf dem Wall spazieren gehen, seine ‚Borsdorfer Aepfelchen‘ wieder zu sehen kriegen, von sechs bis neun Uhr abends kegeln oder l’Hombre spielen, meinetwegen auch arbeiten, und um zehn Uhr zu Bett gehen. Ich stehe dafür ein, daß ihn eine solche Lebensweise in vier Wochen an Geist und Körper wieder so kerngesund macht, wie er es sein Leben lang bis zu seiner Uebersiedlung nach Berlin gewesen ist, und wie er es noch heute sein würde, wenn er ‚zu Hause‘ geblieben wäre.“
Stevenhagen hielt es für seine Pflicht, sich etwas gegen die Ausführung dieser Verordnungen zu sträuben; aber im Herzen hatte er schon nachgegeben, und tags darauf erklärte er sich thatsächlich bereit, nach N. zurückzukehren. Frau Mathilde [379] bestand darauf, er müsse sofort vorausreisen und machte sich anheischig, den Umzug allein zu bewerkstelligen. Und vierundzwanzig Stunden später kehrte Stevenhagen dreiviertel geheilt, mit dem Doktor nach Hause zurück.
| * | * | |||
| * |
Es war wieder Frühling gewordeu, und Herr Konstantin Stevenhagen hatte schon seit beinahe einem halben Jahre seine alte Lebensweise wieder aufgenommen. Er ging zwar nicht mehr so regelmäßig wie früher in den Laden, wo Fritz jetzt in aller Bescheidenheit die Herrschaft führte, aber er bekümmerte sich tagsüber genügend um das Geschäft, um sich die Zeit vertreiben zu können und des Abends hatte er wie in früheren schönen Tagen seine regelmäßige Partie l’Hombre und seine regelmäßige Partie Kegel. Der Rentmeister, der eine Zeitlang seinen Platz eingenommen, hatte sich in der Gesellschaft der drei alten Herren niemals ganz heimisch gefühlt. Er hatte es sich ohne jede Empfindlichkeit gefallen lassen, wieder durch Stevenhagen ersetzt zu werden. Während der ersten zwei Abende herrschte in der Spielgesellschaft eine gewisse frostige Befangenheit, die sich namentlich in gesuchter Höflichkeit und in der Milde äußerte, mit der ein Spieler den anderen auf einen begangenen Fehler aufmerksam machte und mit der sich dieser gegen den an ihn gerichteten Vorwurf vertheidigte. Man machte eben vor dem wiedergefundenen alten Freunde noch „Umstände“ wie vor einem angesehenen Fremden; aber schon in der zweiten Woche begannen die guten Kameraden, sich in hergebrachter Weise nach einem jeden Spiele heftig zu zanken, und sehr bald war der frühere erfreuliche Zustand, der als ein Zustand andauernden Streitens bezeichnet werden konnte, in alter Herrlichkeit wieder hergestellt. Stevenhagen, von Frau und Tochter gepflegt, von den „Borsdorfer Aepfelchen“ regelmäßig besucht und in Anspruch genommen, wuchs von neuem in sein früheres Leben hinein und bekam seine rothen, festen Wangen und den freundlichen Blick seiner hellen ehrlichen Augen wieder. Doch nagte ein geheimer Kummer an ihm, ein Kummer, über den er noch mit niemand zu sprechen gewagt hatte. Allmählich wurde nämlich dem guten Manne klar, daß er sich geraume Zeit lang recht thöricht benommen hatte. Frau, Tochter, Schwiegersohn und Freunde hatten seine Thorheit monatelang geduldig und liebevoll ertragen und selbst als er in seiner Verblendung die Heimath verlassen und auf seine ganze Vergangenheit und seine besten Freunde wie auf etwas Werthloses freiwillig und anscheinend ohne jedes Bedenken verzichtet hatte – selbst da waren sie in ihrer treuen Anhänglichkeit nicht von ihm gewichen. Mathilde war ihm weinend, aber ohne ein Wort des Vorwurfs nach Berlin gefolgt und würde es bis zum Tode dort, in dem freudenlosen Leben, das er ihr geschaffen hatte, ausgehalten haben. Und der Doktor war beim ersten Rufe an Stevenhagens Lager geeilt, um sich mit ihm zu versöhnen, ihn zu heilen und nach N., zu seinem Glücke zurückzuführen. Konstantin empfand jetzt seine Thorheit wie eine Sünde, durch die er alle, die seinem Herzen nahe standen, schmerzlich verletzt habe. Und dieses schwere Vergehen wurde ihm von denen, die darunter gelitten hatten, ganz und rückhaltlos verziehen, ohne daß ein Wort des Vorwurfs über ihre Lippen gekommen wäre! Mathilde begrüßte ihn mit dem zufriedenen Lächeln aus den Tagen ihres ungetrübten Glücks, und das Andenken an die öde und traurige Berliner Zeit schien ganz aus ihrem Gedächtniß verwischt zu sein. Agathe und Mertens traten ihm mit hergebrachter Vertraulichkeit und Ehrerbietung entgegen und seine alten Spielkameraden, der Doktor an der Spitze, hatten niemals auch nur die leiseste Anspielung gemacht auf die große Thorheit im Leben Konstantin Stevenhagens, auf seine Uebersiedlung nach Berlin. Wie leicht wäre es ihnen gewesen, ihn spöttelnd „Herr Kommissionsrath“ zu nennen! Aber nein! Das Wort kam nicht über ihre Lippen, und auch der Landrath hatte aufgehört, ihn „Herr Kollege“ anzureden und wandte sich mit dem alten vertraulichen „lieber Stevenhagen“ an ihn. Es nagte an Konstantins Herzen, daß er soviel zarte Rücksichten, soviel Liebe und Freundschaft empfangen sollte, ohne sich dafür erkenntlich zu zeigen. Sein angeborener gesunder Stolz regte sich in ihm. Er fühlte sich unter einer Schuld – einer Schuld der Dankbarkeit. Er wollte sie bezahlen. Der Inhaber der Firma „Samuel Stevenhagen Söhne Nachfolger“ mußte sich in jeder Beziehung „solvent“ zeigen.
Eines Tages, als die l’Hombrepartie im regelmäßigen Kreislauf im Stevenhagenschen Hause stattfinden sollte, wurde Frau Mathilde von ihrem Manne aufgefordert, das Abendbrot diesmal reichlicher und sorgfältiger zu veranstalten, als es bei ähnlichen Gelegenheiten Brauch war. Er selbst ging in den Keller und holte eine Anzahl Flaschen seines allerbesten Weines herauf, den er seinen Gästen nur bei besonderen Festlichkeiten vorzusetzen pflegte. Auf einen fragenden Blick Mathildens antwortete er, es handle sich um eine Ueberraschung für die Freunde; sie solle ihn nur gewähren lassen; alles werde sich im Laufe des Abends zu ihrer Befriedigung aufklären. – Und die Aufklärung kam.
Als die vier alten Spielgenossen nach beendeter Partie an dem Eßtisch Platz genommen und den aufgesetzten Speisen und Getränken behaglich zugesprochen hatten, klopfte der Wirth plötzlich an sein Glas. Man sah ihn erstaunt an, denn es verstieß gegen die zu fester Regel gewordene Gewohnheit, den gewöhnlichen Spielgesellschaften durch Toaste einen feierlichen Anstrich zu geben; aber Konstantin Stevenhagen ließ sich dadurch nicht beirren. Er hatte sich erhoben und begann mit bewegter Stimme:
„Liebe Freunde“ – und sogleich stockte er wieder. Dann, mit sichtlicher Anstrengung, fuhr er schnell und fließend fort, als sage er etwas auswendig Gelerntes her: „Es werden in den nächsten Tagen drei Jahre, da hattet Ihr Euch mit vielen anderen meiner Freunde und Bekannten in diesem Hause versammelt, um mir zu Ehren die Feier des hundertjährigen Bestehens meines Geschäftes zu begehen. Ihr waret gekommen, mir Freude zu machen, und Ihr machtet mir Freude ... und ... und ... ich habe Euch dafür schlecht gedankt.“
Reden halten war Konstantins starke Seite nicht. Die Beobachtung dieser Thatsache drängte sich ihm in diesem Augenblick zum ersten Male auf, denn er hatte noch niemals in seinem Leben den Versuch gemacht, zu „reden“. Eine große Versammlung fremder Menschen hätte ihn nicht mehr einschüchtern können als die vier Leute, seine besten Freunde und seine Frau, es thaten, sobald er sich in wohlgesetzter Rede an sie gewandt hatte. Es flimmerte ihm vor den Augen, der Schweiß trat ihm auf die Stirn – er sah zum Erbarmen aus. Das konnte keiner der Zuhörer lange Zeit ertragen, und alle empfanden es wie eine Erlösung, als Nehring, wie im Zorne, dem verlegenen Manne zurief:
„Was fällt Dir ein, Stevenhagen? Setz’ Dich, Mann, und sei still! Hast Du aber noch etwas auf dem Herzen, was Du absolut sagen willst, nun so sprich, wie wir gewohnt sind, Dich sprechen zu hören!“
Stevenhagen that sofort, wie der Doktor ihn geheißen hatte, und setzte sich nieder. Er athmete tief und erleichtert auf. „Du hast recht, Nehring,“ sagte er, „aber vergönne mir noch zwei Worte ... zu meiner Befriedigung ... Ihr verlangt kein Schuldbekenntniß von mir ...“
„Sicherlich nicht!“
„Nun ich mache auch keines; sei nur nicht so aufgeregt, Nehring! Sieh’, wie ruhig ich bin – Ihr verlangt kein Schuldbekenntniß ...“
„Nein!“
„Das weiß ich ja. Ich streite gar nicht mit Dir. So unterbrich mich doch nicht ... aber ich muß Euch sagen ... ja, was wollte ich eigeutlich sagen ...“
„Das möchte ich auch wissen!“
„Ich weiß es! Laß mich nur reden ... Ich wollte sagen ... ich wollte sagen ...“
„Du kriegst es ja doch nicht heraus,“ nnterbrach ihn der Doktor wieder, „und deshalb will ich es für Dich thun. Du willst uns sagen, daß wir Deiue guten Freunde sind.“
„Ja, das seid Ihr!“ rief Konstantin aufspringend und mit leuchtenden Augen um sich blickend. „Ihr seid meine guten treuen Freunde, denen ich für alle Beweise der Liebe und Freundschaft, die Ihr mir im Leben, namentlich aber seit einem halben Jahre gegeben habt, von ganzem Herzen dankbar bin. Das und nichts anderes wollte ich Euch sagen, und nun habe ich es endlich gesagt, obschon Nehring gethan hat, was er nur konnte, um mich daran zu verhindern.“ – – –
Seitdem sind fünf Jahre vergangen. Stevenhagen denkt noch keineswegs ans Sterben, aber er hat bereits testamentarisch bestimmt, daß die Firma des alten Hauses, auf das er stolzer als je ist, nach seinem Tode unter der Herrschaft seines Enkels, [380] Anastasius Mertens, noch einen Zusatz erhalten und sodann „Samuel Stevenhagen Söhne Nachfolger Erben“ lauten soll.
„Das ist großartig “ sagte Frau Mathilde.
„Etwas lang,“ meinte Nehring. „Einen kleinen Wechsel kann Anastasius damit gar nicht acceptieren.“
Konstantin zuckte die Achseln. „Dir ist nichts heilig!“ murmelte er.
Den „Königlichen Kommissionsrath“ hat Stevenhagen allem Anschein nach vergessen, wenigstens spricht er nie mehr davon. Die schönen Visitenkarten, die Nehring ihm vor Jahren geschenkt hat und von denen nur wenige benutzt worden sind, liegen vernachlässigt in einer nur selten geöffneten Schublade des großen Schreibtisches, an dem Stevenhagen seit einem Menscheualter Rechnungen schreibt, Bücher fuhrt, auf „ergebenste Letzte“ Bezug nimmt und „geschätzte Jüngste“ beantwortet. Auch seine Freunde und Mitbürger scheinen gar nicht mehr daran zu denken, welch hoher Auszeichnung Herr Konstantin Stevenhagen vor Jahren theilhaftig geworden ist. Sie behandeln ihn wie einen Gleichgestellten, und der „Kommissionsrath“, der vor acht Jahren in so vieler Leute Mund war, ist ohne Sang und Klang wieder aus dem Wortschatz der Einwohner von N. verschwunden. So vergeht der Glanz der Welt!
Moltke in seinen Briefen.
Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit der Feldherr, der Deutschlands Macht und Einheit in glänzenden Siegen mitgeschaffen hat, für immer die Ruhe fand, nach der er sich oft gesehnt. Aber was so äußerlich von uns genommen wurde, ist in anderer Weise schöner wiedererstanden. Eine Reihe von Veröffentlichungen, in denen uns die „Gesammelten Schriften und Denkwürdigkeiten“ des wunderbaren Mannes geboten werden, hat uns sein geistiges Bild näher gebracht als je. Vor allem die Briefe an seine Angehörigen sind es, die sein tiefstes Wesen erschließen – diese einfache edle Größe des Denkens und Handelns, diese innere Freiheit von allem Kleinlichen, diese in sich selbst gegründete Stille mit dem weiten Blick ins Wesentliche und Ewige, dabei diese unbesiegliche Thatkraft. Wie vor etwas Vollendetem stehen wir vor solchem Leben, das, für die Geschichte lange schon unsterblich geworden, ungeschwächt bis an die Grenze menschlicher Tage reichte, um dann mitten aus dem Schaffen heraus mit einmal ein schmerzloses Ende zu finden, als sollte der Welt von diesem Manne nur die Erinnerung bleiben, daß er gehandelt, nicht daß er gelitten habe.
Und doch ist ihm nicht ein fertiges Glück in den Schoß gefallen; durch eine harte Jugend, durch eine Schule der Entbehrung und der eisernen Arbeit hindurch ist er zu der Höhe emporgestiegen, auf der wir ihn zu sehen gewohnt sind. Moltkes Jugend – in eine fernliegende Zeit müssen wir zurückgehen, um sie uns zu vergegenwärtigen: der gewaltige Hintergrund die Thaten des korsischen Eroberers, der wie ein unwiderstehliches Schicksal über die Völker Europas hereinbrach, dann die Jahre der Befreiungskriege mit ihrem Begeisterungssturm, ihrem opferfreudigen siegreichen Ringen, endlich jene große Stille, in welche die „Heilige Allianz“ das wachgewordene Europa einzuwiegen suchte – und auf diesem Hintergrund voller Kämpfe um die höchsten Güter fast überall ein Familienleben in schlichtestem Rahmen, eine bescheidene Häuslichkeit, in ihrem äußeren Zuschnitt bürgerlich einfach als eine kleine und gelegentlich kleinliche Welt für sich, in der die Autorität der Eltern das unumstößliche Gesetz, Gehorsam das Glück der Kinder bildete, in der wenig Raum blieb für anspruchsvolle Wünsche und desto mehr für ernste Arbeit.
Diese Welt war die des jungen Moltke; aus ihr ging der Charakter hervor, dessen Spiegelbild wir in den Briefen bewundern. Den Grund dazu legte die Erziehung der Mutter. Moltkes Eltern lebten früh getrennt. Der Vater, preußischer und später dänischer Offizier, war offenbar eine jener unruhigen Naturen, die in einer Häuslichkeit weder glücklich sind noch beglücken; Vermögensverluste kamen hinzu, so trennte er sich von seiner Gattin. In selbstverleugnender Liebe übernahm diese die Erziehung der Kinder und führte mit der entschlossenen stolzen Kraft ihres Wesens die Aufgabe durch, die bei den knappen Mitteln doppelt schwer fiel. Nach außen hin verschlossen, ernst, fast streng, und doch eine leidenschaftliche Natur mit liebeglühendem, treuem Herzen – so wird sie geschildert.
Es muß trotz aller Schatten eine frohe, kerngesunde Welt gewesen sein, die sich da aufbaute. Mochte vieles darin beengend sein, für eines hatte sie reichlich Platz und in dem Wirken der Mutter das eindrucksvollste Vorbild: für die schlichte Größe der Pflichttreue, die doch in allem, was sie thut, nur etwas Selbstverständliches erblickt. Mit behaglicher Anschaulichkeit führen uns einige Stellen der Moltkeschen Briefe in den Kreis der Seinen. Wir sehen früh morgens „die Kaffeemaschine auf dem Tische sprudeln, die Schwestern mit Stickerei, den Vips – Moltkes Bruder Victor – mit einer Rechentafel und einigen Chininpulvern“, sehen die Mutter, „mit ein paar entsetzlich zerrissenen Strümpfen (nämlich in der Hand) ein wenig kopfschüttelnd die Brille zurechtschieben, um dies Faß der Danaiden dicht zu machen“, und „in dem Eulensalon poltert und ruft etwas, wahrscheinlich einer der Herren Brüder, welcher sein verspätetes lever bemerkbar macht“. Wenn die Arbeit ruhen kann, dann sitzt man wohl „in bequemer Gemüthlichkeit“ auf dem Sofa der „gelben Stube“ und erzählt oder musiciert sich etwas vor. Und besonders anheimelnd ist’s an Weihnachten; da geben sich in den bescheidenen Räumen Zufriedenheit und harmlose Lust ein Fest, kein glänzendes freilich, aber ein wohlthuendes. Die Geschenke sind nahe beieinander: „saubere Handarbeiten“ von den Schwestern, von der Mutter „gute tüchtige Hemden und Strümpfe mit doppelten Fersen, als wären sie für Achill bestimmt“, und nebenbei „eine Bowle Punsch in der Perspektive“ – das genügt, um die Versammlung in muntere Stimmung zu versetzen.
Was solch stille Geborgenheit für das ganze Leben bedeutet, vergißt nur ein Undankbarer. Moltke giebt seinem Defühl für das Glück dieser Jahre noch als Mann einen rührenden Ausdruck in dem Worte, das er an seine Mutter schreibt: „Wie oft ist es mir vor die Seele getreten, daß von allen Wohlthaten der erste mütterliche Unterricht die größte und die bleibendste ist. Auf diese Grundlage baut sich der ganze Charakter und alles Gute in demselben, und wenn Du acht Kinder zu redlichen Leuten herangezogen, so muß ihr Dank und Gottes Segen auf Dir ruhen.“
Noch ein anderes war bestimmend für das Werden dessen, den wir in den Briefen finden – die Zeit in der Kadettenakademie zu Kopenhagen, in welche der elfjährige Knabe eintrat. Das war jene Zeit, über die Moltke noch ein Jahr vor seinem Tode wie eine Ueberschrift die Worte setzt: „Freudlose Jugend, spärliche Ernährung, fern vom Elternhause,“ die dem neunundzwanzigjährigen Lieutenant die bittere Aeußerung entlockt, die einzige derart in den Briefen: „Da ich keine Erziehung, sondern nur Prügel erhalten, so habe ich bei mir keinen Charakter ausbilden können. Das fühle ich oft schmerzlich. Dieser Mangel an Halt in sich selbst, dies beständige Rücksichtnehmen auf die Meinung anderer, selbst die Präponderanz der Vernunft über Neigung verursachen mir oft einen moralischen Katzenjammer, der bei anderen gerade aus dem Gegentheil einzutreten pflegt. – Man hat sich ja beeilt, jeden hervorstechenden Charakterzug zu verwischen, jede Eigenthümlichkeit wie die Schößlinge einer Taxuswand fein bei Zeiten abzukappen – so entstand die unglücklichste Eigenschaft des Charakters, die Charakterschwäche.“ Wohl hat an dieser Aeußerung eine augenblickliche Verstimmung theil, in der Moltke ungerecht wird gegen sich selbst, denn „Mangel an Halt“ und „Charakterschwäche“ waren ebensowenig die Fehler des Lieutenants Moltke, wie sie später die des Heerführers waren, aber das zeigt die Stelle doch wahrheitsgetreu, daß in jenen Jahren „fern vom Elternhause“ seine innere Welt nur aus sich selber werden konnte.
Was die Natur an kraftvollem Willen und überlegener Einsicht in diesen Geist gelegt hatte, das mußte sich unter solchen Verhältnissen doppelt mächtig und rasch entfalten, und so entsteht [381] das Außerordentliche, daß in den Briefen, die von 1823 bis 1890 gehen, von Anfang an dieselbe geschlossene Persönlichkeit uns entgegentritt. Es ist, als ob dieser reiche Baum immer in Blüthen und Früchten zugleich gestanden hätte: wie schon der Jüngling ganz die geistigen Züge des Mannes trägt, so besitzt noch der Neunzigjährige die Unermüdlichkeit der Jugend. Daß eine so einzigartige Stetigkeit des ganzen Wesens nicht ohne Kämpfe erreicht werden konnte, ist selbstverständlich. Aber das ist das Bezeichnende bei Moltke, daß sich die Kämpfe nicht auf die Oberfläche wagen dürfen, daß er es nicht der Mühe werth findet, ihnen in seinen Briefen, die doch auch bei ihm die geheimsten Zeugen der Entwicklung sind, Worte zu leihen. Nur einmal klingt etwas davon an, aber bloß, um sofort wieder als krankhaft zurückgewiesen zu werden; im Jahre 1825 schreibt er der Mutter von aeinem „verwundeten Herzen“, das „durch vereitelte Wünsche, Kränkungen und Feindschaft niedergedrückt“ sei, doch im nächsten Augenblick setzt er hinzu: „Aber in meinen Jahren ist dies Krankheit.“
Allein neben diesem unschätzbaren Ertrag an Klarheit und Energie des Strebens brachte jene entbehrungsvolle Zeit für Moltke anderes, was kein Gewinn zu nennen war. Niemand geht ohne inneren Verlust durch eine freudlose Jugend. Er selbst spricht von seiner „Zurückhaltung, welche die Frucht einer unter lauter feindseligen Verhältnissen verlebten Jugend sei und nothwendig wieder Zurückhaltung bei anderen erzeuge“; er leidet unter einem verschlossenen und spröden Wesen, das ihm unwillkürlich zu eigen geworden ist, und giebt diese Züge einem der Helden in seiner Novelle „Die beiden Freunde“, in der er zugleich seiner Jugendliebe ein wehmüthiges Denkmal setzt, jener Liebe, über die er in einem Briefe an seine Mutter mit dem stillen Wort der Entsagung weggehen muß. „Hier ist ein Mädchen, das recht verdient, Deine Schwiegertochter zu sein. Es ist eine Gräfin Reichenbach. Sie ist bildschön und erzogen – Du würdest sie auf Händen tragen. Aber leider ist sie unvermögend.“
Auch diese Neigung, die offenbar tief gegangen ist, sollte wie so vieles Schöne in seinem Dasein seiner Armuth zum Opfer fallen. Und daß ihn bei alledem die harte Jugend nicht selbst hart gemacht hat, das ist das Wohlthuende. Obgleich aus diesem Leben frühe die Illusionen schwinden müssen, die bei anderen die rauhe Wirklichkeit mit weichem Schimmer umkleiden und im Lande der Zukunft tausend reifende Hoffnungen zeigen, so wird es doch nicht nüchtern und selbstsüchtig. Die Vernunft giebt bei ihm den Dingen das Maß, aber er wahrt sich die Wärme des Gemüths. Wie herzlich ist das Verhältniß zu seiner Mutter, und wie anspruchslos und innig zugleich offenbart er sein Gefühl! Eine Blume von der höchsten Spitze der Schneekoppe, ein Oelzweig vom Grabe des Patroklus im fernen Troja, dem Briefe beigelegt, sagt der Mutter mehr als alle Worte, daß er in der Fremde ihrer gedacht. Ein Sternbild, das sie oft bewundert hat, nennt er „ihren Stern“. „Dein schöner Stern hat mir alle Morgen früh geleuchtet, wenn ich vor Sonnenaufgang ausritt,“ schreibt er aus Konstantinopel. Mit jedem Guten, das auf seinem Weg erblüht, verknüpft er dies Sternbild. Als er, schon ein gereifter Mann, in der jugendlich anmuthigen Marie Burt „ein Herz gefunden hat, welches ihn liebt“, da sagt er der Braut in einem der ersten Briefe: „Wenn Du abends nach neun Uhr gegen Süden blickst, so wirst Du einen prachtvollen Stern am Horizont aufsteigen sehen. Es ist derselbe. den meine selige Mutter so oft bewunderte. Ich sah ihn nie, ohne an sie dabei zu denken, und habe den Glauben, daß es mein guter Stern ist. Denke dann an mich! ... Oft wenn ich in fernen asiatischen Steppen den langen heißen Tag geritten und die Nacht herabsank, ehe die müden Pferde ihr Nachtquartier erreicht, oder wenn ich auf dem flachen Dache der Wohnung meine Teppiche zum Lager breiten ließ, trat er mit südlicher Klarheit aus dem Abendroth hervor und leuchtete so milde, als wollte er sagen. Reite nur getrost und vergiß alle Sorgen, du wirst doch noch ein Herz finden, welches dich liebt. Und so habe ich Dich gefunden, theure Marie.“ –
Moltke hat als spärlich besoldeter Lieutenant einen schweren Weg. Der Stand seiner Finanzen „ist oft so niedrig wie der des Wetterglases“, einen Brief aus Schlesien an seine Mutter muß er sich versagen, denn das Porto ist „so ungeheuer groß“, er frühstückt nie und ißt oft auch abends nichts, weil angeblich [382] „die sehr guten Speisen vom Mittag noch vorhalten“ – und doch zögert er keinen Augenblick, „eine Remuneration von sechzig bis achtzig Thalern“, die er erhält, dem Vater anzubieten und sich von einer kleinen Zulage monatlich fünf Thaler abziehen zu lassen um sie seiner Mutter zur Verfügung zu stellen. Der große Traum seines Lebens ist, „am liebsten auf dem lieben deutschen Boden“ „eine Scholle Land“ sein nennen zu können, aber nicht um es da bequem zu haben, sondern um dort den ganzen Kreis seiner Angehörigen zu versammeln. Er, dem „auf dorniger Rennbahn“ der Wunsch zuvörderst nach eigenem Glück so mensch!ich nahe gelegen wäre, kann von Glück für sich nicht sprechen, ohne der Mutter zu sagen: „Möchte ich es für Euch alle gewinnen!“
Halbe Naturen verzehren sich unter dem Druck widriger Verhältnisse in Mißmuth und Mitleid mit sich selbst. Moltke besaß zu viel sittliche Kraft, zu viel geistige Beweglichkeit, um sich verbittert abzuschließen. Was freundlicher Zufall und eine schmale Börse ihm an bescheidenen Vergnügungen gestatten, nutzt er dankbar; er schätzt Geselligkeit und weiß, daß zu Tanz und Wein ein fröhliches Herz gehört. Aber wie er über der täglichen Noth steht, mit der er zu kämpfen hat, so auch über dem Genießen. Er ist sich bewußt, daß alle Genüsse nur Arabesken sind am ernsten Bau des Lebens, und so verliert er sich nicht im Beiwerk, sondern hält sich stets das Wesentliche gegenwärtig, das, um dessen willen ein Menschenleben allein werth ist, gelebt zu werden: die Pflichttreue zielbewußte Arbeit. Dieses Streben, immer wieder von der Oberfläche zu der Tiefe zurückzukehren, aus der die sittliche That kommt, giebt seinem Wesen die charakteristische Färbung. Zufriedenheit ist es, was er dabei erreicht, denn „am Ende sind Arbeit, Hoffnung und Gesundheit alles, was zur Zufriedenheit gehört“, und Ruhe findet er so für das stille Lächeln des Humors, mit dem er das Widrige uberwindet. Er scherzt gelassen über „das halbe Pferd“, das er sich durch seine Aufsätze „zusammengeschrieben“ hat, und doch braucht er noch weitere zweieinhalb, die trotz der Zerlegung in ökonomisch leichter beschaffbare Hälften nicht in naher Aussicht stehen; und in einer Zeit, wo er seine „schreckliche Herzkrankheit“ noch nicht überwunden hat, entwirft er in einem Brief an seine Schwester Lene das drollige Krankheitsbild: „Mit meiner Gesundheit geht’s sonderbar. Oft liege ich acht bis zehn Stunden bewußtlos, d. h. des Nachts, nicht den mindesten Appetit nach Tisch, gegelt Abend solche krampfhafte Bewegungen und Dehnen ... Reißen in allen Gliedern – wenn es Dir nur nicht ebenso geht.“
Eines würde man in dem Bilde auch des jungen Moltke vergeblich suchen: jene träumerische Lust und Schwermuth, die aus Kleinem erschütternde Empfindungen schöpft und die Dinge mit Gefühlen, statt mit Wirklichkeiten mißt. Ueberall leuchtet aus den Briefen eine überlegene ernste Ruhe, jene Sachlichkeit, die keine sprunghaften Ueberraschungen aber auch keine Enttäuschungen bereitet. Es sind die tiefsten Quellen, aus denen dieser Charakter seine Kraft zieht, aber sie kommen nicht aus dem geheimnißvollen Dunkel leidenschaftlicher Erregung, in das kein Blick hinunterreicht, sondern aus der klaren und durchsichtigen Welt eines nie gebeugten, nie verwirrten Willens. So entrotlt sich dies Leben vor uns wie etwas Naturnothwendiges und dennoch in höchstem Grade Freigeschaffenes, und die Pflicht ist der Leitstern, dem es folgt. Aus unscheinbaren Anfängen erhebt es sich zu weltgeschichtlicher Bedeutung, aber nirgends zeigt sich ein ehrgeiziges Verlangen nach solcher Größe, nirgends ein anderer Beweggrund als eben der des Pflichtgefühls. Ein Mann, der sagen kann: „Je weiter man in diesem Leben vorschreitet, je weniger lernt man von demselben erwarten“, der geizt nicht nach dem Lorbeer und findet nicht in der Meinung anderer, sondern in sich selbst das Gefühl seiner Würde.
Von nichts ist denn auch in den Briefen Moltkes weniger die Rede als von dem Großen, das er erreicht, von der Mühe, die es ihn kostet; kaum daß das alles einmal eine kühle Erwähnung findet. Es ist fast lustig, zu sehen wie er so gelegentlich merken läßt, daß „so ein Feldzug doch die Kräfte sehr angreift, wenn man seine siebzig Jahre auf dem Rücken hat“, wie er auf die Schlacht bei Sedan nur deshalb zu sprechen kommt, weil eines seiner Pferde erkrankt ist „Eines der jungen Pferde steht stark im Kropf,“ schreibt er, „ich habe aber ein mir zugefallenes Beutepferd (bei Sedan über zehntausend) eingespannt.“ Das ist der ganze Bericht über die Schlacht, den er seinem Bruder Adolf schickt. In diesen trivialen Beispielen spiegelt sich ein tiefer Zug: der größte Feldherr des Jahrhunderts ging still hinweg über seine Erfolge ohnegleichen, weil er ein noch größerer Charakter war. Der Werth einer That bemißt sich für ihn nur nach der Gesinnung, aus der sie fließt, und an diesen Maßstab gehalten, dünkt ihm die eigene Leistung nicht höher als die anderer. „Es scheint wirklich ein gelungenes Fest gewesen zu sein,“ so schreibt er über die Enthüllung seines Denkmals in Parchim an seinen Bruder Ludwig, „aber es war mir doch angenehm, dasselbe aus sicherem Hinterhalt in Kreisau ansehen zu können. Denn wie mancher, der unter dem grünen Rasen Frankreichs schlummert, hat mehr gethan als wir Lebenden.“
Ein Geist von solcher Bescheidenheit und so überzeugtem Gefühl für den echten Werth mußte ein Feind alles Wortgeklingels und aller Vorurtheile sein. Die tönende Phrase und der theatralische Faltenwurf, mit denen die Mittelmäßigkeit zu wirken sucht, sind ihm ebenso herzlich zuwider wie eine klägliche Einbildung, die sich auf Vorzüge des Standes und Vermögens steift und dabei „so göttlich dumm“ sein kann. Was er achtet, das ist die tüchtige Kraft. Ihn freut darum die Schaffenslust des deutschen Wesens, „eine Nation in Pantoffeln“ ist ihm ein Greuel; mit Stolz begrüßt er auf einer Reise durch das öde Spanien die blühenden Kolonien jener Deutschen, die sich im 18. Jahrhundert dort angesiedelt hatten, und „die lieben treuen viereckigen deutschen Gesichter“. Ihn freut die aufstrebende Gegenwart, die an die Stelle verwitterter Wartthürme aus „alter unruhiger Zeit“ die geschäftigen Stätten der Industrie setzt; ohne Bedauern spricht er es aus: „Die Burgen zerfallen“ – denn dafür ist „die Hütte des geringen Mannes zum stattlichen Wohnhaus geworden.“
Inmitten dieses ernsten Lebens, das der Arbeit gehört, läßt die Liebe einer edlen Frau ein freundliches Glück erblühen, das nur mit ihrem Tode endet. Moltke hat sich in seinen Briefen wiederholt für die Verstandesehe ausgesprochen, aber seine eigene Ehe schließt er doch auf Grund eines innigen, wenn auch keines leidenschaftlichen Gefühls. Warmherzig klingt es wieder in den Worten des ersten Briefes, den er von Berlin aus an die Verlobte richtet: „Möchte ich Dich doch für alles entschädigen können, was Du um meinetwillen aufgeben mußt. Ja, liebe Marie, ich bitte Gott aufrichtig, daß, wenn ich Dich nicht glücklich machen kann, er mich lieber vorher abberufe.“ „Ich will Dich pflegen wie meinen Augapfel, Du zarte, kleine Pflanze,“ heißt es an anderer Stelle. Mit Offenheit und sicherem Takte erleichtert er der Sechzehnjährigen die Aufgabe, sich in den so viel älteren Mann einzuleben; er ist fern davon, „die Jugend aus ihrem Leben wegstreichen“ und ihre frische Beweglichkeit hemmen zu wollen; nur das möchte er, daß sie „bei so vielen glänzenderen Erscheinungen“, als er ist, sich stets das Gefühl bewahre, niemand meine es treuer denn ihr „alter Bär“. Humor und Ernst mischen sich wohlthuend in den Briefen des Bräutigams, so, wenn er als vorausschauender Stratege für die künftige Ehe die Parole ausgiebt: „Laß uns nur immer recht aufrichtig miteinander sein und ja niemals schmollen. Lieber wollen wir uns zanken und noch lieber ganz einig sein ... Jemand hat gesagt, es giebt nur zweierlei Ehen: solche, wo der Mann unter dem Pantoffel steht, und unglückliche. Ich verlange nichts Besseres, als unter Deinem Pantoffel zu stehen, und es wird Deine Aufgabe sein, mich durch Sanftmuth, Nachgiebigkeit und Güte auch dahin zu bringen.“ Ob wirklich der große Heerführer, der im Felde durchs Schwert nicht zu besiegen war, zu Hause gegen den so leichtsinnig heraufbeschworenen Pantoffel unterlag, muß wohl eine offene Frage der Geschichte bleiben, für deren Lösung nur der eine Anhaltspunkt vorliegt, daß seine Ehe eine glückliche war.
In seiner ganzen Selbstlosigkeit zeigt sich Moltkes Wesen, als ihm der Tod die theure Frau entreißt. Er klagt nicht über seinen Verlust und möchte die Verstorbene nicht „aus besserem Dasein“ zurückrufen. „Ich hätte nicht gemocht, daß sie wieder erwache,“ lauten seine schlichten Worte, „sie hat ein selten glückliches Leben genossen und ist des traurigen Alters überhoben.“ Völlig hat er aber diesen Verlust nie verwunden; die „Sehnsucht nach der Ruhe des Kapellenberges“ in Creisau, wo er die sterbliche Hülle der Gattin beigesetzt, hat ihn im Innersten nie mehr verlassen. In den Briefen thut er ihrer nur noch einmal ausführlicher Erwähnung, mitten in den großen Ereignissen von 1870. „Ja, hätte Marie diese Zeitläufe noch erlebt!“ ruft er aus. „Aber ich [383] denke, die hingeschiedenen Menschen verlieren nicht die Kenntniß irdischer Dinge und ihr patriotisches Herz nimmt an allem theil.“
Die letzten Briefe, die wir von seiner Hand haben, beschäftigen sich immer weniger mit dem wechselnden Treiben des Tages, mit menschlichem Schicksal und Kampf. Fremde Personen hereinzuziehen, war nie seine Sache. Selten findet sich über Dritte ein Urtheil und nie ein mißgünstiges. Mit vornehmem Schweigen geht er über das weg, was er nicht sagen könnte, ohne anzuklagen. Die Erscheinungen der Natur sind es, die nun immer gesteigerter seine Aufmerksamkeit fesseln. Wer Schlachten lenken will, der muß stets die großen Linien wie die Kleinigkeiten einer Landschaft festhalten können und wird so von Anfang an die Natur gewiesen. Und ist er kein leidenschaftlicher Geist, sondern von jener machtvollen Ruhe, die hervorgeht aus der unbegrenzten Stetigkeit des eigenen Wirkens, so muß ihn je länger je mehr statt der Eintagsdauer menschlicher Dinge die Natur anziehen in ihrer Gesetzmäßigkeit, ihren ewig waltenden Kräften. So sehen wir den Feldmarschall in seinem geliebten Creisau „das Naturleben belauschen in der Stille der herabsinkenden Dunkelheit“. Und so oft der Frühling ins Land kommt, ist’s ihm „eine besondere Gnade“, noch einmal das Erwachen der Erde beobachten zu dürfen, und gerne hält er dann still auf dem Kapellenberg. „Der Rothdorn steht in voller Pracht und tausend Knospen des Rosenstocks an der Kapelle sind im Aufblühen“. Sinnend schaut er in die Ebene hinaus – seine Aufgabe ist gethan; zwar ist auch ihm nicht „der Tod ein ganz willkommener Gast“, aber doch drängt sich ihm schon geraume Zeit vor seinem Scheiden der Wunsch auf die Lippen: „Däs nächste Jahr möchte ich nicht mehr erleben.“
So klingen die Briefe leise aus wie Glockenton, der nach dem Kampf den Frieden kündet. Es ist verwunderlich, wie tief der Eindruck ist, den sie im Lesen hinterlassen, denn sie sind weder besonders geistreich noch tragisch bewegt, und Kleinigkeiten, wie sie der Tag bringt, sind genug darin. Aber „aus vielen kleinen Tagesgeschichten setzt sich am Ende eine Lebensgeschichte zusammen“, und hier eine, die durch ihre ungesuchte Schmucklosigkeit und Wahrhaftigkeit alles menschlich Echte, alle innere Größe um so reiner zum Ausdruck bringt. Frei von der nervösen Unruhe und dem blendenden Schein einer modernen Entwicklung, geht dieses Leben hin in tiefer Achtung vor dem Segen der Arbeit, im Dienst für die Majestät der Pflicht, im hoffenden Ausblick auf eine überirdische neue Welt des Geistes. Den Charakter, der hier vor uns steht, hat man „antik“ genannt. Aber warum zum Vergleich nach Fremdem greifen? Soll es doch für unser Gefühl das Höchste sein, wenn wir sagen dürfen: er war ein deutscher Mann, groß durch seine Thaten, größer durch die Selbstlosigkeit, aus der sie flossen, am größten durch den stillen und doch jedes ewige Interesse des Menschengeistes in sich befassenden Sinn, mit dem er beispiellose Erfolge trug. Die Geschichte kann ihm keinen schöneren Lorbeer reichen, als den er selbst sich gab im Sieg über alles Kleinliche und Häßliche.
Ueber Entziehungsdiät.
Wie das Ueberfüttern der Kinder in wohlhabenden Familien eine der häufigsten diätetischen Sünden ist, so nimmt auch ein sehr großer Theil der Erwachsenen weitaus mehr Nahrungsmittel zu sich, als die Verdauungsorgane bewältigen können und als zur Erhaltung des Körperbestandes nothwendig ist. Diese Ueberfüllung mit Nährstoffen, diese Ueberlastung des Magens und Darmes dauert so lange fort, bis endlich der Organismus sich den zu hoch gespannten Anforderungen nicht mehr gewachsen erweist. Es entstehen Störungen der Verdauung, der Magen empört sich, die Darmthätigkeit wird träge, das Blut stockt in seinem Kreislaufe, die Leber schwillt, die Nerven werden verstimmt, der Stoffwandel zeigt sich mannigfach verändert – kurz, man muß den Arzt holen lassen, und dieser verordnet in richtiger Erkenntniß, daß hier die Nahrungsaufnahme den Stoffverbrauch übertraf, eine Entziehungsdiät. Er entlastet die Verdauungsmaschine, er behebt die Blutüberfüllung, welche wichtige innere Organe gefährden kann, indem er dafür sorgt, daß die Menge aller zur Erhaltung des Stoffgleichgewichtes nothwendigen Nahrungsstoffe herabgemindert, also weniger Eiweiß, Fett, Zucker und Stärkemehl zugeführt wird, als bisher die Lebensgewohnheiten des Kranken mit sich brachten, ja, sogar weniger, als die Erhaltung des Stoffgleichgewichtes fordert.
Die einfachste allgemeine Entziehungsdiät besteht also darin, daß der Körper eine zur vollständigen Sättigung nicht genügende Menge leicht verdaulicher Nahrungsmittel erhält, und einer solchen Diät sollte sich jeder unterziehen, der in Speise und Trank zuviel des Guten geleistet hat und nun empfindet, daß Magen und Darm den Dienst versagen. In früherer Zeit hat man aus solcher Entziehungsdiät eine wahre Hungerkur gemacht, und die alten Aerzte ließen blutreiche, vollsaftige Lebemänner, Gichtbrüchige und Fettsüchtige ohne Erbarmen hungern. Die neueren physiologischen Untersuchungen haben aber das Schädliche solchen Vorgehens erwiesen und dargethan, daß bei der Entziehungsdiät alle Vorsicht geboten ist. Wenn die dem Körper zugeführten Nährstoffe längere Zeit hindurch auf das Nothwendigste beschränkt werden, so wird der Nachwuchs der rothen Blutkörperchen behindert und der Organismus in seinem Aufbaue gestört. Die Entziehungsdiät darf darum weder zu strenge genommen, noch zu lange ausgedehnt werden.
Weitaus häufiger, als der Arzt eine allgemeine Entziehungsdiät vorschreibt, sieht er sich veranlaßt, einen oder mehrere bestimmte, zur Ernährung nothwendige Stoffe in ihrer Zufuhr zu beschränken oder dem Organismus gänzlich zu versagen. Auf solche Weise können von den Nährstoffen das Wasser oder das Fett oder Zucker und Stärkemehl oder endlich die Eiweißstoffe entzogen werden.
Die Wasserentziehungsdiät besteht in der möglichsten Enthaltung vom Wassergenusse. Dadurch wird dem Organismus zunächst Wasser, mittelbar aber auch eine Reihe von festen Bestandtheilen genommen, so daß eine günstige Beeinflussung des Stoffwechsels bei Fettsucht, Gicht, Rheumatismus und anderen Erkrankungen erzielt werden kann. Schon aus sehr alter Zeit, bereits von Plinius dem Jüngeren, der um das Jahr 100 n. Chr. lebte, rührt die Verordnung her, daß fette Personen, welche mager werden wollen, während des Essens dürsten und nachher wenig trinken sollen. Und bekanntlich ist dieser Grundsatz, die Aufnahme von Flüssigkeiten, besonders von Wasser, auf ein möglichst geringes Maß herabzusetzen, in jüngster Zeit als modernstes Entfettungsmittel lebhaft verfochten, aber auch nicht minder lebhaft bekämpft worden.[7]
Als festgestellt kann man ansehen, daß eine möglichste Beschränkung des Wassergenusses in den Fällen nutzbringend ist, wo infolge der fettigen Veränderungen des Herzmuskels hochgradige Kreislaufsstörungen vorhanden sind und es für die Erhaltung des Lebens von Wichtigkeit erscheint, die in den Geweben aufgestauten Flüssigkeitsmegen zu vermindern. In der Regel wird hierbei die Menge der gestatteten Getränke in folgender Weise angesetzt: morgens und abends eine Tasse (150 Gramm) Kaffee, Thee, Milch oder dergl., mittags 3/8 Liter Wein und vielleicht noch, in kleinen Portionen über den ganzen Tag vertheilt, 1/4 bis 2/3 Liter Wasser.
Die strengste Form der Wasserentziehung bietet die sogenannte Schrothsche Diät. Diese Durstkur, welche sich einer großen Beliebtheit erfreut, wobei wir aber gleich bemerken wollen, daß oft genug die von ihr drohende Gefahr in keinem richtigen Verhältnisse zu dem zu erhoffenden Nutzen steht, hat folgenden Gang: der Patient genießt nach Bedürfniß und Appetit in den Morgenstunden wie im Laufe des Tages trockene, gut ausgebackene Semmel, mittags einen Brei aus Reis, Gries, Hirse. Zum Getränk dient in den ersten acht Tagen mit Zucker und etwas Citronensaft versetzter, nicht ganz dünner Haferschleim, nicht zuviel auf einmal und nur bei entschiedenem Durste. In der zweiten Woche trinkt man täglich nur einmal ein Weinglas voll Wein, den man mit einem halben [384] Glase Wasser und etwas Zucker gemischt und heiß gemacht hat. In der dritten Woche trinkt man täglich nur ein Glas reinen Weines, dann geht es noch einen Schritt weiter: man versucht einen Tag gar nichts zu trinken, genießt am folgenden Tage ein Glas warmen Wein und macht am dritten Tage einen sogenannten Trinktag, d. h. man trinkt zwei Stunden nach dem Mittagstisch mehrmals. Und in dieser Weise wird einige Wochen fortgefahren, so daß nach jedem Trinktage sofort wieder die trockene Diät beginnt.
Die geschilderte Trockenkost hat einen günstigen Einfluß auf manche Stoffwechselerkrankungen, allein die Untersuchungen über die Wirkung einer so weit gehenden Wasserentziehung beim Menschen haben gezeigt, daß hierdurch wesentliche Veränderungen im Blute sowie in der Zusammensetzung der Gewebe zustandekommen, welche lebenbedrohende Erscheinungen zur Folge haben.
Eine häufige Form von entziehender Diät ist ferner jene, bei welcher die Fette aus den Nahrungsmitteln mehr oder minder vollständig verbannt werden. Durch die verläßlichsten physiologischen Versuche der Gegenwart ist nachgewiesen, daß die häufigste und wichtigste Quelle des im Körper abgelagerten Fettes das mit der Nahrung aufgenommene Fett thierischen oder pflanzlichen Ursprunges ist und daß darum jeder zur Korpulenz Veranlagte wohlweislich vom Küchenzettel jegliches Fett streichen, kein fettes Fleisch, keine Butter, kein Schmalz, keine fetten Saucen etc. genießen soll. Eine auf diesem Grundsatze aufgebaute Kur ist seit nahezu dreißig Jahren unter dem Namen „Bantingkur“ bekannt, seitdem sie der englische Arzt Harvey dem dicken Banting empfahl, welcher nicht verfehlte, die hierdurch an seinem Fettpolster erzielten glänzenden Erfolge in einem drastisch geschriebenen „offenen Briefe“ der gesammten abmagerungsbedürftigen Menschheit zu verkünden.
Bei der Fettentziehungsdiät sind Butter, Rahm, Schmalz gänzlich zu meiden, ferner alle fetten Fleischsorten, so Schweinefleisch (mit Ansnahme mageren Schinkens), Gans, Ente, von Fischen der Lachs, die Lachsforelle, der Steinbutt; endlich müssen vom Speisezettel alle Pasteten und alles fette Backwerk verschwinden, unter den Früchten sind Kastanien, Nüsse, Mandeln verboten, unter den Getränken Chokolade und Kakao. So wirksam eine solche Fettentziehungsdiät ist, so darf sie doch nur auf kurze Zeit angewendet werden, weil sonst wesentliche Ernährungsstorungen eintreten können; das Fett ist eben zum Aufbau des Organismus mit von nöthen. Gewöhnlich wird die Fettentziehungsdiät mit der Entziehung noch anderer Nährstoffe verbunden, nämlich der Kohlenhydrate, d. h. des Stärkemehles und Zuckers, weil diese Stoffe zwar nicht selbst in Fett übergehen, wie früher angenommeu wurde, aber doch die Eigenschaft besitzen, das im Körper gebildete und abgelagerte Fett vor Zerstörung zu schützen. Darum wird fetten Personen verboten, Mehlspeisen zu genießen und Süßigkeiten zu naschen; ja diese Maßregel erscheint zuweilen für Fettsüchtige noch wichtiger und dringender als die Fettentziehung.
Wenn man der Nahrung die Kohlenhydrate entzieht, so verfolgt man vorzugsweise auch die Absicht, den Zuckergehalt des Blutes herabzusetzen. Diese Diät wird deshalb auch bei der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) angewendet, in der Form jedoch, daß es gestattet ist, Fette in größeren Mengen zu genießen. Der Zuckerkranke wird darum, wie wir dies in dem Aufsatz in Nr. 18 des Jahrgangs 1889 dargelegt haben, vorzugsweise auf Fleischkost gesetzt, weil die Wurzeln, Früchte und Körner der Pflanzen die zu vermeidenden Stärkemehlarten enthalten und mehr oder minder zuckerreich sind. Solchen Kranken wird selbst das dem Aermsten nothwendige tägliche Brot ganz entzogen oder sehr knapp zugemessen. Aber auch hier ist eine vollständige Verbannung sämmtlicher Zuckerbildner aus den Nahrungsmitteln nicht gut durchführbar, weil eben der Organismus dies nicht verträgt und einer bloßen animalischen Ernährung widerstrebt.
Den geraden Gegensatz zu dieser Diätform bietet die Vegetarianerdiät, welche alle Speisen thierischen Ursprunges meidet und nur die pflanzlichen Nahrungsmittel gestattet. Es läßt sich nicht leugnen, daß der Mensch auch als Vegetarianer leben kann, besonders wenn er sich nicht streng orthodox an ausschließliche Pflanzenkost hält, sondern von den thierischen Nährmitteln die nicht so verpönten Eier, die Milch, die Butter und den Käse sich gestattet. Aber um Vegetarianer zu sein, muß man vor allem einen guten Magen und leistungsfähigen Darm haben, denn eine ausschließlich pflanzliche Kost stellt an die Verdauungsorgane weit höhere Anforderungen als eine gemischte. Der für den Körperbestand wichtigste Nährstoff, das Eiweiß, ist zwar auch in den pflanzlichen Speisen enthalten, allein nicht in so leicht verdaulicher, den Säften rasch zugänglicher Form wie in der Nahrung thierischen Ursprunges.
Der menschliche Körper kann sein Eiweiß von einer Erbsenkost wie von einer Fleischkost beziehen, aber bei der ersteren ist die Ausnutzung des Nahrungsmittels durch den Darm eine weitaus unvollständigere und schwierigere; es wird eine ungleich größere Menge zugeführt werden müssen, ein gewaltiger Ballast wird mit herbeigeschafft, der viel Unnützes enthält. Um die für den Stoffwechsel nöthigen Substanzen, namentlich die Eiweißstoffe, aus einer Pflanzenkost, einer Ernährung durch Brot, Kartoffeln, Reis, Mais etc. zu gewinnen, bedarf es einer sehr großen Masse dieser Speisen und einer langen Zeit zur Bearbeitung. Die Pflanzenfresser unter den Thieren haben einen viel komplizierteren und längeren Darm als der Mensch und haben Muße zu ihrer Eßarbeit.
Wenn die Vegetarianer behaupten, daß ihre Ernährungsart vollständig genüge, um ihr Körpergewicht auf einer beträchtlichen Höhe zu erhalten, ja daß sie dadei sogar recht kräftig und schwer werden, so muß dem gegenüber betont werden, daß die Gewichtszunahme, welche bei ausschließlich pflanzlicher Kost stattfindet, auf Vermehrung des Wassergehaltes des Körpers, nicht aber auf Ansatz von Fleisch oder Fett beruht.
Allerdings ist zuweilen auch diese Fleischentziehungsdiät für einige Zeit angezeigt, und es kann manchem von Nutzen sein, auf ein paar Wochen Vegetarianer zu werden. Namentlich Personen, welche einen üppigen Tisch lieben und dabei eine sitzende Lebensweise führen, welche gewohnt sind, sehr nahrhafte und dabei leicht verdauliche Fleischspeisen zu genießen, können hierdurch ihre Verdauungsorgane [385] derart erschlaffen, daß für diese ein ungewohnter kräftiger Reiz nur nützlich ist. Der vegetarianische Küchenzettel mit der geringen Auswahl von Gängen, mit den einfach zubereiteten Mehlspeisen, Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Gemüsen und Obst thut hier sehr wohl, und nach einiger Zeit kehrt dann der so auf Fastenkost gesetzte Feinschmecker wieder gebessert zu seinen gewohnten Fleischtöpfen zurück. Jener Küchenzettel hat zwar nicht viel Verlockendes für sich, aber immerhin läßt sich mit ihm einige Wochen, wohlgemerkt nicht allzulange, auskommen, und das aus reinem ungebeutelten Weizenmehl bereitete Schrotbrot (Grahambrot), das eine große Rolle unter diesen Tafelgenüssen spielt, wird oft in die frühere Speiseordnung hinübergenommen.
Ein Vegetarianer genießt zum Frühstück Schrotmehlsuppe oder Kakao oder auch Milch, dann Weizenschrotbrot mit Obst, Obstmus, auch mit Butter oder Honig. Das Mittagessen bietet Obstsuppe, Gemüse, Hülsenfrüchte, Rüben, Spargel, Kohl, Kartoffeln, Reis, Graupen, Milch- und Mehlspeisen, Obst und Schrotbrot. Zur Abendmahlzeit kommt wieder Brot mit Obst auf die Tafel und, wenn es nicht gar zu strenge hergeht, Käse, Butter, Eierspeise. Entsprechend dem Zwecke einfacher, naturgemäßer Lebensweise ist Wein und Bier verboten und als Getränk nur reines Wasser, Himbeerwasser oder Milch gestattet. Auf solche Weise erzielen vollsaftige, an Trägheit des Blutumlaufes und Schwäche der Darmthätigkeit leidende Personen oft recht günstige Erfolge, nur darf man nicht mit der übertriebenen und ungerechtfertigten Behauptung kommen, die Vegetarianerdiät sei für den Menschen die einzig richtige und in der Enthaltung von Fleischkost beruhe das Heil der gesammten Menschheit.
Schließlich sei noch der Eiweißentziehungsdiät gedacht. Denn auch das Eiweiß, so bedeutungsvoll die Rolle desselben für den Haushalt des Körpers ist, kann unter Umständen dem Organismus mit Vortheil entzogen werden. Bis zu einem gewissen Maße findet dies bei Fiebernden statt. Von der früheren Anschauung, daß man dem Fieberkranken jegliche Nahrung verweigern müsse, um nicht Oel ins Feuer zu gießen und durch Zufuhr von Nahrungsstoffen die erhöhte Körpertemperatur noch mehr zu steigern, von dieser Anschauung ist man gegenwärtig abgekommen; aber aus mehreren, der genaueren Erkenntniß vom Wesen des Fiebers entnommenen Gründeu ist man bestrebt, dem Fiebernden das Eiweiß nur in geringer Menge und in sehr leicht verdaulicher Form zu reichen und die Kost so einzurichten, daß in derselben die stickstofflosen Nahrungsstoffe die stickstoffhaltigen überwiegen. Neben dem Wasser, dem für Fieberkranke unentbehrlichsten Nahrungsmittel, zu dessen Genusse ja schon der vermehrte Durst treibt, bilden Abkochungen, welche vorzugsweise Stärkemehl, Zucker und Leimstoffe enthalten, die zweckmäßigsten Bestandtheile in der Ernährung Fiebernder. Mehlsuppen aus Weizenmehl, Gerstenmehl, Hafermehl, Gries, Reismehl, mit Kochsalz oder Zucker versetzt, Fleischbrühen, namentlich die leimreiche aus Kalbsfüßen und etwas Kalbfleisch bereitete Brühe, leimhaltige Gelées, Milch mit Wasser verdünnt, Bouillon mit Ei sind solche Gerichte, die, mit der nöthigen Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Verdauungsorgane und des Standes der allgemeinen Körperkräfte, dem Fiebernden gereicht werden und den Zweck erfüllen, eine Diät zu bieten, in welcher das Eiweiß nicht zu reichlich enthalten ist.
In der jüngsten Zeit hat man die Eiweißentziehungsdiät auch bei solchen Stoffwechselerkrankungen empfohlen, bei denen man eine übermäßige Ansammlung von Eiweißstoffen in den Säften annehmen zu müssen glaubte, so bei der Krebskrankheit. Man giebt solchen Kranken eine an Stickstoff und phosphorsauren Salzen arme Kost. Bei der Eiweißentziehungsdiät werden alle Fleischspeisen gemieden, ebenso Fische, Krebse, Austern und Muscheln, Eier, Käse und Hülsenfrüchte, ferner Bier und schwere Weine, [386] Hingegen werden für den Tisch solcher Kranken vorwiegend folgende Speisen in verschiedenster Zubereitung verwerthet: frische Gemüse, namentlich Spinat, Kohl, gelbe Wurzeln, ferner Kartoffeln, Reis, Mais, Sago, Buchweizen, Obst, Zucker, Butter, Fett. Bei einigem Kochverständniß läßt sich aus diesen Dingen ein gar nicht übler Küchenzettel zusammenstellen, umsomehr, als zum Getränk Thee, Milch, Chokolade, leichter Rhein- und Moselwein, Limonade und Champagner gestattet sind.
Ein Forscher auf diesem Gebiet, Professor Beneke, hat für Krebskranke die Eiweißentziehungsdiät durch folgende Speiseordnung empfohlen: als Frühstück ein kräftiger Aufguß schwarzen Thees mit Zucker und Milchrahm oder auch eine Tasse Kakao oder Chokolade, wenig Brot mit sehr viel Butter, dazu einige Kartoffeln in der Schale gequellt mit Butter; als zweites Frühstück frisches oder gekochtes Obst, einige englische Biskuits oder wenig Brot mit Butter, ein Glas Wein. Zur Mittagsmahlzeit Fruchtsuppe, Weinsuppe mit Sago, Kartoffelsuppe, nicht mehr als 50 Gramm Fleisch (in frischem Zustand gewogen), Kartoffeln, einfach abgekocht oder in Form von Brei oder Klößen, alle Arten von Wurzelgemüsen, gekochtes Obst, Aepfel oder Pflaumen mit Reis, Reis mit Rum. Salate, Fruchteis, leichte Mosel- und Rheinweine. Nachmittags schwarzen Theeaufguß mit Zucker und Milchrahm, wenig Brot mit Butter, oder frische Früchte und einige Biskuits. Abends eine Suppe wie mittags, Reis mit Obst, Quellkartoffeln mit Butter, Kartoffelsalat. Geringe Menge Sardinen, Anchovis, frische Häringe, Buchweizengrütze mit Wein und Zucker. Leichter Wein.
Gar mannigfaltig gestaltet sich demnach, wie wir eben erörterten, die Entziehungsdiät. Sie muß, dem Einzelfalle entsprechend, mit sorgfältiger Erwägung der Lebensweise und Ernährungsverhältnisse geregelt werden und bietet dann, wenn wissenschaftliche Erkenntniß des Arztes mit vernünftiger Selbstbeherrschung des Kranken Hand in Hand geht. ein machtvolles Mittel zur Verhütung und Bekämpfung krankhafter Zustände, einen Triumph der Küche über die Apotheke.
BLÄTTER UND BLÜTHEN.
Rheinische Passionsspiele. (Mit Abbildung S. 384.) Auch außerhalb
Oberammergaus giebt es Stätten in Deutschland, wo die Leidensgeschichte
Christi in der Form des Volksschauspiels zur Darstellung gelangt. So
werden in diesem Jahre wieder die Passionsspiele zu Stieldorf im
Rheinland aufgeführt.
Diese Spiele sind neueren Ursprungs, und die Anregung zu ihnen ist nicht etwa von geistlicher Seite ausgegangen. Ein einfacher Landmann, Michael Weyler vom Scheurer Hof bei Stieldorf, hat sie, angeregt durch das Oberammergauer Vorbild, ins Leben gerufen. Von ihm rührt die Bearbeitung des Textes und die Einrichtung des Schauspiels her, auch die Komposition der Musikstücke – soweit letztere nicht dem kirchlichen Melodienschatz entnommen sind – und er leitet auch jetzt noch das Ganze. Die Mitwirkenden sind gleichfalls Landleute, Männer, Frauen und Kinder, sämmtlich aus der Gemeinde Stieldorf, im ganzen jetzt etwa 170. Erwähnt sei dabei, daß sie persönlich keinen Gewinn aus ihrer Thätigkeit ziehen; was nach Abzug der Unkosten übrig bleibt – recht beträchtliche Summen dürften es sein – wird zu wohlthätigen und frommen Zwecken gespendet.
Die erste Aufführung – nach vieljährigen Vorbereitungen – fand im Jahre 1889 während der Fastenzeit statt; die zweite im folgenden Jahre, zur selben Zeit. Inzwischen haben sich die Leute ein eigenes Haus für die Spiele gebaut, welches 1200 Zuschauersitze faßt und wiederum nur von Einheimischen entworfen und trefflich eingerichtet ist. In diesem Jahre findet dort die dritte Wiederholung statt, und zwar wird an allen Sonn- und Festtagen der Monate Mai und Juni gespielt; also in der schönsten Jahreszeit dort zu Lande, in der „Blüthenzeit“. Dies soll sich von nun alle fünf Jahre wiederholen.
In Westdeutschland, bis nach Holland hinüber, haben die Stieldorfer Spiele bereits einen gewissen Ruf erlangt; ohne Zweifel wird die heurige Wiederholung auch die Augen weiterer Kreise auf sie lenken. Erfreulich ist es, daß neuerdings auch die Musik eine reichere Vertretung in ihnen gefunden hat. Der Komponist Wiltberger hat für die diesjährigen Spiele einige schöne Beiträge geliefert.
Fast hätten wir vergessen zu sagen, wo denn Stieldorf liegt. Es
ist ein kleines, ungemein anmuthiges Dorf, mit einem Kranze von anderen,
dorthin eingepfarrten Dörfchen, Weilern und Höfen umgeben, unweit des
Siebengebirges, von der Station Obercassel am Rhein erreicht man es
auf genußreicher Bergwanderung in stark dreiviertel Stunden. Die Gegend
zeigt einen überaus lieblichen Wechsel von kleinen Thalsenkungen und
Hügeln, und von einem dieser grünen, sanftgerundeten Hügel blickt die
Spielhalle dem Kommenden entgegen. Ernst Lenbach.
Die Schloßfreiheit in Berlin. (Zu dem Bilde S. 357.) Wenn man vom Denkmal des Großen Friedrich her den weiten glatten Platz überschreitet, an dem rechts und links die geschichtlich bedeutsamsten Gebäude Berlins sich aufreihen, das Palais Kaiser Wilhelms I., die königliche Bibliothek, das Opernhaus, das Prinzessinnenpalais, das Palais Kaiser Friedrichs III., die Kommandantur, das Zeughaus, die neue Wache, die Universität, so gelangt man auf die Schloßbrücke, die architektonisch bedeutsamste Brücke Berlins – ein Werk Schinkels – die hier den Hauptarm der Spree überspannt und mit acht wunderschönen Darstellungen einer Heldenlaufbahn geschmückt ist. Auf diesem Punkte genießt man den eindrucksvollsten Rundblick, welchen das in dieser Hinsicht nicht eben reiche Berlin darzubieten hat. Hinter sich die eben beschriebene gewaltige Flucht von Gebäuden mit den Denkmälern von Kriegs- und Geisteshelden, schaut man vor sich den Lustgarten, den schönsten Laubplatz Berlins, mit A. Wolffs bronzenem Friedrich Wilhelm III. als Mittelpfeiler und dem alten, Schlüters mächtiger Phantasie entsprossenen Königsschloß, der alten Börse, dem Dome, dem Campo Santo, dem Museum und der Nationalgalerie als Seitencoulissen. Wahrlich, ein gewaltiges Bild! In engem Umkreis eine Stadt steinerner Symbole, eine Sammlung von Denkmälern gleich denen auf der Schloßbrücke, für die Laufbahn auch eines Helden, genannt der preußische Staat! Alles Größe – zwar Größe ohne reiche Phantasie und berückende Farben, Größe in starren, flachen Linien, aber darum den Anschein um so größerer Festigkeit erweckend, das Gefühl einflößend einer sicher auf breiten Riesenfüßen ruhenden Macht!
Wenn man aber den Blick von diesem strengen heroischen Bilde fortwendet und rechts den Lauf der Spree hinauf schweifen läßt, gewahrt man ein Häusergewimmel, mit bunt wechselnden Wasserfronten auf moosgrünen Pfahlrosten, die ins Wasser getrieben sind, Pflöcke davor, die den schiffbaren Lauf des Flusses bezeichnen und Kähnen und Holztriften zu Haltepfeilern dienen. Das ist die „Schloßfreiheit“ von Berlin.
Ein veralteter Name für eine veraltete Sache. Der Platz zwischen Schloß und Fluß war von den ersten Königen Preußens für abgabenfreie Wohnhäuser der Schloßbeamten bestimmt worden. Die alten Privilegien sind längst vermodert wie die alten niedrigen Barockhäuser, an deren Stelle heute moderne, charakterlose Miethshäuser stehen, der Quai selbst aber behielt den alten Namen der „Schloßfreiheit“. Diese Häuser, nun gleichfalls dem Untergang geweiht, zeigt unser Bild. Links in der Ecke sehen wir noch den äußersten Abschnitt der Schloßbrücke: auf drei mächtigen Granitblöcken das zweite, dritte und vierte Bild der Marmorgruppen „Siegeslaufbahn eines Helden“. Das lange Rechteck im Hintergrund mit den lichten Fensterflecken und den Figuren auf durchbrochener Attika ist das königliche Schloß mit seiner Lustgartenfront. Die rechts davon scheinbar über dem breiten Massiv des Hauses Schloßfreiheit Nr. 3 gelagerte Kuppel gehört gleichfalls dem Königsschloß an. Unter ihrer mit goldenem Kreuze gezierten kupfernen Wölbung befindet sich die Kapelle der Hohenzollern und darunter das gewaltige Hauptportal des Schlosses, der Schloßfreiheit zugekehrt. Am rechten Rande des Bildes gewahren wir einen niedrigen Bau im Wasser, es ist eine Badeanstalt, darüber einen gleichfalls niedrigen, lang sich hinziehenden, mit flacher Dachwölbung versehenen Bau, aussehend fast wie eine gedeckte Wandelbahn oder eine kleine Eisenbahnhalle. Dieser tritt auf unserem Bilde etwas in den Schatten; in Wirklichkeit ist er ein hübscher, in orientalischer Buntheit blitzender Pavillon mit einer reizenden Wasserveranda versehen; darin befindet sich das Restaurant Helms.
Die Häuserflucht der Schloßfreiheit wird niedergerissen in erster Linie, weil dieser Platz für das Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. in Aussicht genommen ist. Daß die Mittel dazu durch eine Lotterie aufgebracht wurden, hat seinerzeit und auch neuerdings wieder viel Staub aufgewirbelt, und von Männern aller Parteien wurde es bedauert, daß man das Andenken an den unvergeßlichen Kaiser mit einem auf die Spielsucht weiter Volkskreise berechneten Unternehmen verquickte. Am 15. Juni dieses Jahres soll mit der Niederlegung der Häuser Nr. 1 und 2 zunächst der Schloßbrücke begonnen werden, von denen das erste bis daher noch die Geschäftsräume der Photographischen Gesellschaft barg. Im Oktober dieses Jahres folgen die Grundstücke Nr. 7, 8 und 9. Der Mitteltheil mit dem riesigen Neubau, der auf dem Bilde unter der Schloßkuppel zu stehen scheint, folgt erst im Herbst 1893, während Nr. 10 und 11, das Helmssche Restaurant umfassend, dessen Grund und Boden fiskalisches Eigenthum ist, von dem Projekt überhaupt nicht betroffen werden.
Mit der Schloßfreiheit sinkt ein weiteres Stück Alt-Berlin dahin.
Kaum steht noch hier und da ein Rest davon, und man sieht einen nach
dem anderen ohne allzuviel Bedauern fallen; indem man die schwindenden
Zeugen alter Tage photographiert und so in höchst moderner Nachbildung
dem märkischen Museum einverleibt, glaubt man genug gethan zu haben.
Auch der Schloßfreiheit wird keine Thräne nachgeweint werden – sah man
doch selbst ohne Gemüthsbewegung, wie der ehrwürdige Mühlendamm
starb, „und war mehr als sie!“ O. N. H.
Edelweißsucher. (Zu dem Bilde S. 361.) Schon manchem sind jene weißschimmernden Blumensterne verderblich geworden, die im Hochgebirge aus der Einsamkeit schwer zugänglicher Abhänge und schmaler Grasbänder am
[387] schönsten leuchten und Erfahrene und Unerfahrene immer wieder in die Gefahr locken. Für die beiden Edelweißsucher auf unserem Bilde freilich ist wohl nichts zu fürchten – so schwindelerregend jäh auch der Berghang abfällt, sie drücken sich mit ihren Steigeisen fest in den Grund ein, und das Seil schützt den Pflückenden vor dem Absturz, wenn er ausgleiten sollte. Nur darf sein Kamerad den Halt nicht auch verlieren und deshalb seine Aufmerksamkeit keinen Augenblick von dem Knienden verwenden – sonst könnten sie beide die Blumen mit ihrem Leben bezahlen müssen.
Die sechshundertjährige Jubelfeier der Stadt Celle. (Zu dem Bilde S. 385.) Es war an Pfingsten des Jahres 1292, am 25. Mai, als Herzog Otto der Strenge von Braunschweig und Lüneburg eine Urkunde ausstellte, in welcher er verschiedene Freiheiten bestimmte für die, so in seine „Neue Stadt Celle“ einziehen wollten, und in welcher er dieser das Recht von Lüneburg ertheilte. Mit dieser Urkunde beginnt die Stadtgeschichte von Celle, und seine Bürger schicken sich an, die sechshundertjährige Wiederkehr jenes Tages feierlich zu begehen mit Festspiel, Festzug und fröhlichem Kommers. Derselbe Herzog Otto hatte auch den Anstoß zur Entstehung der Stadt gegeben. Am Ende des 13. Jahrhunderts nämlich bestand bereits ein nicht unbedeutendes Gemeinwesen auf der Stelle des einen Kilometer entfernten Altencelle. Die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg hatten dort ein Schloß, auch befand sich daselbst eine große Kirche, die St. Petrikirche. Nun geschah es, daß im Jahre 1290 jenes herzogliche Schloß abbrannte, und Herzog Otto wollte es nicht wieder auf dem alten Platze aufbauen, sondern wählte dazu die Stelle, wo auch das heutige, in seinen Anfängen auf das Jahr 1485 zurückgehende Schloß steht. Zugleich gestattete er durch einen öffentlichen Erlaß, daß in der Nähe des gewählten Bauplatzes sich jedermann anbauen dürfe, gab den Ansiedlern gleiche Rechte mit den Bürgern von Altencelle und wies Bauholz und Bauplätze an. Die neu entstehende Stadt hieß erst Nyenzell, Neuencelle – heute hat sie, eine übermächtig gewordene Tochter, die Mutter ganz in den Hintergrund gedrängt und führt allein den ursprünglichen einfachen Namen Celle.
Bis zum Jahre 1705 blieb Celle die Residenz der Herzöge von Braunschweig- Lüneburg Cellescher Linie. Der letzte in ihrer Reihe war jener Herzog Georg Wilhelm, welcher um der schönen Eleonore d’Esmiers willen für seine Nachkommen auf alle Thronerbrechte verzichtete und diese sammt der ihm zugedachten hochfürstlichen Braut an seinen Bruder Ernst August abtrat. Seine Tochter ist die unglückliche Sophia Dorothea, deren trauriges Schicksal in dem Namen begriffen liegt, unter dem sie in der Geschichte berühmt geworden ist – die „Prinzessin von Ahlden“. Von ihrem Gemahl Georg Ludwig, dem späteren Georg I. von England, mit eisiger Kälte behandelt, vertraut sie sich dem Grafen Königsmark, damit er ihr zur Flucht nach dem verwandten Hofe Anton Ulrichs von Braunschweig-Wolfenbüttel behilflich sei. Das Komplott wird entdeckt, und die schwer verdächtigte, aber unschuldige Prinzessin muß in einsamer Haft auf Schloß Ahlden den Rest ihres Lebens – fast dreiunddreißig Jahre – vertrauern. Am 26. November 1726 starb sie, zweiundsechzig Jahre alt.
Das Schicksal dieser unglücklichen Prinzessin wird auch in dem Festspiel bei der Jubelfeier seine Rolle spielen. Unser Zeichner führt uns rechts unten auf seinem Bilde den Herzog Georg Wilhelm mit seiner schönen Gemahlin und seiner ebenso schönen Tochter in den historisch getreuen Kostümen, wie sie bei der Aufführung zur Verwendung kommen, vor.
Celle ist heute eine betriebsame Stadt von gegen 19000 Einwohnern, Sitz eines Oberlandesgerichts, in dessen Eigenthum sich eine namhafte Bibliothek mit werthvollen alten Handschriften des „Sachsenspiegels“ befindet. Sie weist zwei Gymnasien, ein Waisenhaus und eine Reihe weiterer gemeinnütziger Anstalten auf, endlich eine nicht unbeträchtliche Garnison. Möge das alte Gemeinwesen, das nunmehr auf eine Geschichte von sechs Jahrhunderten zurückblickt, auch fernerhin blühen und gedeihen!
Friedrich der Große und der schlafende Zieten. (Zu dem Bilde S. 376 und 377.) Es ist ein edler Zug im Charakter des preußischen Heldenkönigs, jene unwandelbare Dankbarkeit, die er den Mitarbeitern an seinem Lebenswerk bewahrte. Zu denjenigen, welche sich der treuen Anhänglichkeit Friedrichs des Großen bis ins hohe Alter erfreuten, gehörte auch der General Zieten, der geniale Reorganisator der preußischen Reiterei und ihr schneidiger Führer in zahllosen Schlachten und Gefechten. Wer sollte sie nicht kennen, die hübsche Anekdote, in der sich die rührende Sorgfalt des Königs für seinen greisen Waffengefährten so schön aussprach: wie einst der alte Zieten an der königlichen Tafel sanft einschlummerte und der König seine Umgebung, die ihn wecken wollte, mit den Worten zurückhielt: „Man lasse ihn ruhen, er hat in den Tagen der Gefahr oft genug für uns alle gewacht!“ Diese Erzählung hat auch unserem Künstler die Anregung zu seinem Bilde gegeben.
Fischotterjagd. (Zu dem Bilde S. 373.) Das Jagen der Biber und Otter mit Hunden war eine uralte deutsche Jagdart, und in der Jägerei vieler Fürsten wurden Jäger gehalten, welche mit ihren Hunden im Lande umherzogen, um die Gewässer von dem der Fischerei so schädlichen Otter zu säubern. Aber das Jagen des Fischotters mit eigens hierzu abgerichteten Hunden war in Deutschland nach und nach in Vergessenheit gerathen; der wieselartige Fischräuber wurde fast ausschließlich auf Eisen gefangen und nur gelegentlich vor einem scharfen Hühnerhund oder auf dem Anstand erlegt, bis in den siebziger Jahren die Gebrüder Schmidt zu Schalksmühle im Westfälischen die alte Jagdart wieder zu Ehren brachten. Ihre aus wenigen Köpfen bestehende Meute nicht reinrassiger, aber sehr scharfer Wasserhunde stöberte den Otter aus seinem unterirdischen Versteck oder im Weidendickicht am Rande der Flüsse und Bäche auf, jagte, laut „Hals gebend“, ihren mit fischartiger Behendigkeit unter dem Wasserspiegel hingleitenden Feind, bis an einer geeigneten Stelle einer der Jäger demselben eine dreizinkige, mit Widerhaken versehene Wurfgabel oder aus kurzer Büchse eine Kugel zusandte. Die Berufsjäger Gebrüder Schmidt haben wohl in allen Gauen Deutschlands mit ihren ausgezeichneten, nie fehljagenden Hunden die Flußläufe nach Fischottern abgesucht, und ihr Ruf ging so weit, daß selbst Kronprinz Rudolf von Oesterreich sie kommen ließ, um ihre Jagdart kennenzulernen.
Als aber in Deutschland die auf Hebung der Hundezucht abzielende Bewegung, welche Ende der siebziger Jahre sich zu regen begann, feste Wurzeln geschlagen hatte, kamen über den Kanal auf unsere Ausstellungen auch englische „Otterhounds“, reinrassige, harschhaarige, rauhbärtige, mittelgroße, schneidige Gesellen mit langen gedrehten Behängen, mit denen in vielköpfiger Meute drüben der Otter oft stundenlang gehetzt wird, bis er erliegt. Mit diesen Otterhounds und einer Griffonhündin (rauhhaarigen Hühnerhündin) züchtete einer der bekanntesten Sportfischer Deutschlands, dem selbst die Engländer die Ueberlegenheit im Fischen mit der Fliegenangel einräumten, der verstorbene Gutsbesitzer Sperber-Weimar, eine Meute, mit der er seine ausgedehnten Forellengewässer und die seiner Freunde von dem gefährlichen Räuber befreite. Clemens Freiherr von Fürstenberg-Niedermarsberg in Westfalen, der eifrigste und bekannteste Jäger seines Heimathlandes, züchtete sich ebenfalls aus verschiedenen Hunderassen – aus welchen, ist sein Geheimniß geblieben – eine Meute rauhhaariger, vorzüglicher Otterhunde in zwei verschiedenen Größen, von denen die kleinen, etwas über dachshundgroßen Hunde dazu bestimmt sind, den Otter aus dem Baue zu hetzen, und die größeren ihn jagen, bis er zu Schuß kommt. Bis heute ist aber in Deutschland die Meutenjagd auf den Fischotter, wohl der großen Unkosten wegen, in den Händen einzelner weniger geblieben, so aufregend sie auch sein mag.
Der bekannte Jagdmaler und bedeutendste deutsche Hundekenner
Ludwig Beckmann in Düsseldorf, ein Freund des Freiherrn von Fürstenberg,
versetzt uns auf seinem Bilde an ein Flüßchen Westfalens mitten
in ein solch stürmisch wildes Jagdgewoge. Die Hunde haben den Otter
gefunden, und mit hellem Halse jauchzend, verbellend, „hourlierend“,[8]
leutet die Meute ihm schwimmend und plantschend nach – kein Wasser ist ihr zu tief, kein „Klang“ (Stromschnelle in kiesigem Bach) zu schnell, kein Gestrüpp zu dicht – da hilft kein Tauchen, kein Verkriechen, kein Versteck – immer sind ihm die Hunde auf der Jacke – allen voran der deutsch Langhaarige edelster Baron Kalksteinscher Zucht, der sogar in tiefem klaren Wasser den Otter tauchend verfolgt, bis dieser endlich, von der langen Flucht ermüdet, vergeblich unter einem Felsvorsprung Deckung suchend, sich seinen Feinden stellt. Karl Brandt.
- ↑ Die im Bartholomäersee gefangenen Saiblinge wurden im Kloster zu Berchtesgaden auf folgende Art geräuchert: An langen hölzernen Stäben wurden 10–20 Querstäbchen befestigt und an die Enden dieser Stäbchen die Fische durch den Rachen aufgespießt; der geöffnete Leib der Fische wurde durch kleine Hölzchen auseinandergespreizt. So kam die ganze Spindel (spiez) in den Kamin.
- ↑ ein wenig, mühsam.
- ↑ In den Predigten des Bruder Berchtold von Regensburg (13. Jahrhundert) heißt es: „Wilt du zuo dem tanze unde zuo dem haymgartten unde wilt da vil gerüemen unde gelachen unde geweterblitzen unde gezwieren mit den ougen, so mahtu wol bestruchen in den stric des tiuvels.“
- ↑ Elternhaus.
- ↑ Vergl. „Gartenlaube“ 1891, Halbheft 8, 15, 22 und 26.
- ↑ Lassen wir Zahlen sprechen: das private Asyl für Obdachlose wurde allein im Jahre 1890 in 123519 Fällen in Anspruch genommen, darunter in 108072 von Männern und in 15447 von Frauen, Mädchen und Kindern; der nächtliche Durchschnittsbesuch bezifferte sich auf etwa 340. Seit seinem Bestehen, 1870, hat dieses private Asyl in 2209714 Fällen Obdach gewährt. Die musterhafte Verwaltung plant eine bedeutende Vergrößerung, damit die doppelte Zahl Obdachloser Aufnahme finden kann. Möchten hierzu die Mittel recht reichlich fließen! Zuwendungen nimmt der Vorsitzende des Verwaltungsrathes, Herr Gustav Thölde in Berlin, Zimmerstraße 95, entgegen.
- ↑ Siehe darüber meinen Aufsatz „Die Fettleibigkeit und ihre Folgen“, „Gartenlaube“ 1885, Seite 262.
- ↑ Bei jagenden Hunden finden sich hin und wieder solche, die mitten in der Hatz plötzlich stehen bleiben, den Kopf hoch heben und ein eigenthümlich langgezogenes Heulen ausstoßen, was „Hourlieren“ genannt wird. Es giebt sogar eine Rasse, bei der das Hourlieren stehend ist, die „Hourleur-Bracke“.
Von K. Buhle.
Vorhand hat gD (=p As) tourniert, e7 u. e8 (tr. 7 u. 8) gedrückt und besitzt nach den ersten 4 Stichen:
noch folgende Karten:
Der Spieler verliert aber das Spiel und bekommt nur 58 Augen, weil er einen Fehler gemacht hat. Ohne diesen Fehler hätte er mit 66 Augen gewonnen. Worin bestand der Fehler? Wie waren die übrigen Karten vertheilt und wie in beiden Fällen der Gang des Spiels?
Dechiffrieraufgabe.
Ludegafadegu’ fefula’ga gadesilegafa, gusegafa feda ludesudegusifa,
Sudolu’ gifugegufa, lodegigi Defugigafugegufa duseli,
Godali susesigagegudegi Lodelu, gedegi geda ludelogusifa,
Sedagegu gifigegu fefude susesigagegude Gageguseli
Sulasegigo Lulafusisidiselagodela.
Logogriphaufgabe.
Dahn, Beet, Ems, Bote, Hela, Ritter, Seine, Band, Welle, Enkel, Ahr, Ali, Falle, Haff, Kante, Alk, Schale, Meile, Kinn, Erbe, Gabe, Eder, Eile, Liter, Halm, Eis.
In jedem der Wörter ist ein Buchstabe zu streichen und durch einen andern zu ersetzen, so daß dadurch ein neues Wort entsteht. Zwei Wörter, welche Homonyme sind, bleiben ungeändert, weil der hinzugefügte Buchstabe gleich dem gestrichenen ist. Wird die Aenderung richtig ausgeführt, so ergeben sowohl die gestrichenen, als auch die hinzugefügten Buchstaben (letztere rückwärts gelesen) ein Sprüchwort. Wie lauten die Sprüchwörter?
Quadraträthsel mit Rösselsprung.
Mit Hilfe eines geschlossenen Rösselsprungs sind aus den Buchstaben dieses Quadrats achtlautige Wörter von folgender Bedeutung zu bilden: 1. Ein mythischer König von Sparta, 2. ein berühmter Kirchenvater, 3. ein römischer Staatsmann, Mitglied eines Triumvirats, 4. ein Zierstrauch, 5. ein Farbholz, 6. ein französisches Seebad, 7. eine Fabrikstadt im Königreich Sachsen, 8. ein athenischer Feldherr.
Werden die gefundenen Wörter buchstabenweise in die wagerechten Reihen des Quadrats eingetragen, so nennen die beiden Diagonalen einen deutschen Dichter.
Die neue Reihe unserer „Bibliothek der Weltlitteratur“, von welcher der erste Baud soeben erschienen ist, wird enthalten
Grillparzers sämtliche Werke. In 20 Leinenbänden à 1 Mark.
Uhlands gesammelte Werke. In 6 Leinenbänden à 1 Mark.
Alte hoch- und niederdeutsche Lieder, herausgegeben von Ludwig Uhland. In 4 Leinenbänden à 1 Mark.
A. v. Droste-Hülshoffs sämtliche Werke. In 3 Leinenbänden à 1 Mark.
Jean Pauls ausgewählte Werke. In 8 Leinenbänden à 1 Mark.
E. T. A. Hoffmanns ausgewählte Werke. In 4 Leinenbänden à 1 Mark.
Immermanns ausgewählte Werke. In 6 Leinenbänden à 1 Mark.
Hölderlins sämtliche Werke. In 2 Leinenbänden à 1 Mark.
Schopenhauers sämtliche Werke. In 12 Leinenbänden à 1 Mark.
Grimmelshausens Simplicius Simplicissimus. In 2 Leinenbd. à 1 Mark.
Briefwechsel zwischen Lessing u. Eva König. In 2 Leinenbdn. à 1 Mark.
Goethes Briefe an Frau von Stein. In 4 Leinenbänden à 1 Mark.
Briefwechsel zwischen Schiller u. Goethe. In 4 Leinenbdn. à 1 Mark.
Briefwechsel zwischen Schiller u. W. v. Humboldt. 1 Leinenbd. 1 Mark.
Briefwechsel zwischen Schiller u. Körner. In 4 Leinenbänden à 1 Mark.
Schiller und Lotte. Briefwechsel zwischen Schiller und Charlotte von Lengefeld. In 3 Leinenbänden à 1 Mark.
Goethes Gespräche mit Eckermann. In 3 Leinenbänden à 1 Mark.
Das Liederbuch vom Cid. In 2 Leinenbänden à 1 Mark.
Rousseaus ausgewählte Werke. In 6 Leinenbänden à 1 Mark.
Bojardo, der verliebte Roland. In 2 Leinenbänden à 1 Mark.
Manzoni, die Verlobten. In 2 Leinenbänden à 1 Mark.
Firdusis Heldensagen. In 3 Leinenbänden à 1 Mark.
Slavische Anthologie. 1 Leinenband 1 Mark.
Aeschylus’ ausgewählte Dramen. 1 Leinenband 1 Mark.
Die neue Reihe der „Cotta’schen Bibliothek der Weltlitteratur“ kann in dreifacher Weise durch die meisten Buchhandlungen bezogen werden: 1. Durch Subskription auf die ganze Reihe von 105 Bänden (alle 2–3 Wochen ein fertig gebundener Band à 1 Mark). 2. Durch Subskription auf beliebige, in der Reihe enthaltene Werke. 3. Durch Kauf einzelner Bände (ohne Subskription, nach Wahl).
Die meisten Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen und senden auf Verlangen den ersten Band: Grillparzer Bd. I. zur Ansicht.