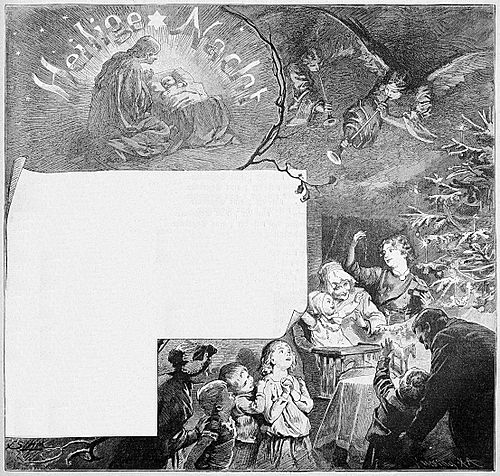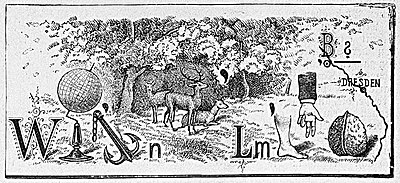Die Gartenlaube (1887)/Heft 50
[821]
| No. 50. | 1887. | |
Illustrirtes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Wöchentlich 2 bis 2½ Bogen. – In Wochennummern vierteljährlich 1 Mark 60 Pfennig oder jährlich in 14 Heften à 50 Pf. oder 28 Halbheften à 25 Pf.
Heilige Nacht.
Von
Otto Sievers.
Ahnungsfrohe Stille waltet,
Und herauf in hehrer Schöne
Zieht die Nacht: andächtig grüßen
Sie vom Thurm der Glocken Töne,
Fegte schneebehang’ne Hügel –
Solche Klänge sanft zu tragen,
Senkt sie friedlich ihre Flügel.
Sieh’, der Himmel ließ erschimmern
Und in Hütten und Palästen
Lichter ohne Zahl entbrannten,
Und die Nacht, sie ward zum Tage:
Heller noch als tausend Kerzen,
Kinderaugen, Kinderherzen.
Denn in dieser Nacht alljährlich
Wird die Kindheit neu geboren.
Wenn ihr nicht zu Kindern werdet,
Drum, was alt und kalt, laßt draußen,
Frost beim Frost im Winterschein:
Heute sollen jung die Greise,
Alle sollen Kinder sein.
Wird die Liebe neu geboren,
Und enterbter Brüder denket,
Wen das Glück zum Sohn erkoren,
Und was abgedarbt der Arme
Wandelt er in kleine Gabe,
Bringt’s zum Opfer seiner Liebe.
Ja, in dieser Nacht alljährlich
Wird die Liebe neu geboren,
Frohe Botschaft, unverloren!
Leuchtet heller auf, ihr Kerzen,
Heller flamme, Sternenpracht,
Voller tönet, Glockenklänge:
Die Geheimräthin.
Mit dem Instinkt des Verwundeten, der wie der angeschossene Hirsch von selbst zur lindernden Quelle getrieben wird, trat
Malköhne in die Wohnung der Geheimräthin, so mechanisch, daß er ohne Zweifel wieder umgekehrt wäre, wäre er zu deutlichem
Bewußtsein gekommen, wo er sich befand. Es war bereits Abend geworden; Brigitta schrieb eifrig an einem Briefe, den
sie der Gräfin Surville im Falle eines unglücklichen Endes zurücklassen wollte. Sie hatte sich an diesem Tage mit der Gräfin
innig befreundet und bei ihrer Verlassenheit und Entfremdung den Gesellschaftskreisen der Hauptstadt gegenüber fand Brigitta für
das Bedürfniß, ihr bis zum Tode verletztes Frauenherz ganz zu offenbaren, keine bessere Befriedigung als den Brief an die Gräfin.
Malköhne war beim Eintritt an der Thür stehen geblieben; Brigitta fuhr bei seinem Erscheinen erschreckt in die Höhe. Als sie den Wortlosen todtenblaß vor sich sah, war ihr Alles klar. Edith hatte ihn zurückgewiesen. Ein tiefer, erlösender Seufzer stieg aus dem Herzen der bisher so gequälten Frau. Zugleich füllten sich ihre Augen mit Thränen, denn niemals hatte sie tief empfundenes Unglück in so sichtbarer Gestalt vor Augen gehabt, als beim Anblick des jungen Mannes. Sanft nahm sie ihn bei der Hand und wollte ihn zum Sofa geleiten; er sank aber auf einem niederen Tabouret in sich selbst zusammen.
Brigitta ehrte sein Schweigen, im dunklen Gefühle, daß es ihn laben müsse, in ihrer Nähe zu sein, ohne zu sprechen. Nie hätte sie das erste Wort laut werden lassen, aber Malköhne selbst unterbrach das Schweigen. Er sah sich zuerst wie verwundert um, die zwei Kerzen, die auf dem Schreibtisch brannten, erhellten das Zimmer nicht genug, daß er Brigitta’s Züge mit voller Deutlichkeit hätte sehen können. So entging es ihm, ob sie Freude oder Mitgefühl ausdrückten; er wußte nur, daß er sich in unmittelbarer Nähe des einzigen Wesens befand, welchem er bisher alle seine Erfahrungen bekannt hatte. Freilich war auch unter den schmerzlichsten derselben keine gewesen, die sich mit dem verzehrenden Weh hätte messen können, das ihm jetzt die Seele durchwühlte.
Er begann langsam die Geschichte dieses Tages zu erzählen, nicht als ob er sie dem Ohre eines Anderen beichtete, sondern als ob er sie aus eigenem Bedürfniß in ein Tagebuch schriebe. Minute nach Minute schilderte er das Zusammensein mit der Tochter Glowerstone’s. Einen Moment strahlte überwältigende Freudigkeit aus seinen Augen, als er von der stummen Handreichung am Fuße der Treppe berichtete. Dann kehrte er mit einer Wuth, als ob er sich selbst zerfleischen wollte, sein Innerstes heraus, die Zweifel, die ihn nicht früher losgelassen hatten, als bis sie sein Glück zertreten. Jedes Wort wiederholte er, das er gesprochen und vernommen; es war, als ob er niemals hätte enden können, als ob er mit diesen Bekenntnissen noch einen Rest des sonst spurlos Untergegangenen festhielte und ihn niemals mehr aufgeben wollte.
Brigitta hörte ihn an, zuerst wie man von dem Leid eines Unglücklichen, das man nicht selbst nachempfinden kann, sich erzählen läßt. Man bleibt eigentlich kalt gegenüber dem Geschehenen selbst, aber man hat das Vertrauen, einen Trost für den Unglücklichen ausfindig zu machen. Allmählich indeß nahmen die Bekenntnisse ihres Geliebten die Gestalt an, als ob sich ihr eigenes Schicksal darin ankündigte. Ihr erster Gedanke bei seinem Anblick war gewesen: ich habe ihn wieder! Die Freude darüber spurlos zu unterdrücken, war als die nächste Regung eines edlen Herzens ihr nur natürlich gewesen.
Während er aber sprach, die Gefühle, die ihn angetrieben hatten und ihn jetzt einem so namenlosen Elend preisgaben, mit den glühenden Tönen der Leidenschaft verkündete, mußte sich Brigitta endlich fragen, ob sie den Verlorenen auch wirklich wiedergewonnen hatte. Immer unumwundener, immer deutlicher mußte sie sich die Antwort ertheilen, daß ein anderer Mann ihr zu Füßen saß, als derjenige, mit dem sich zu vereinen den Traum vieler Jahre für sie gebildet hatte. Vielleicht saß er auch in Zukunft wie seit Jahren täglich an ihrer Seite, vielleicht verband er sich sogar zuletzt mit ihr. Aber war damit auch der Zauber gebrochen, der ihn im Innern festhielt und ihn nach einer ganz andern Richtung zog?
Mit einem unwillkürlichen Schrei fuhr sie empor. Laut sagte sie sich:
„Er hat eine Jugend, die ich nicht an ihm gekannt habe, und nicht ich bin es, die diese Jugend geweckt hat; ich habe ihn wiedergewonnen – aber ich habe ihn für ewig verloren.“
Brigitta war eine jener großen Schönheiten, deren Alter man nicht zu enträthseln vermag, von denen man sogar glaubt, daß sie nicht jünger sein könnten, ohne minder vollendet zu sein. Allein Brigitta zählte beinahe um zehn Jahre mehr als der Mann, den sie liebte: eine Wahrheit, die ihr in diesem Augenblicke grell vor Augen trat. Aus dem Schmerz, dessen Tiefen Siegfried nach allen Seiten vor ihr aufgedeckt hatte, stieg seine bisher nicht geahnte, seine bisher künstlich verborgen gehaltene Jugendlichkeit empor. Die Maske dieser Jugend war es gewesen, was ihn mit ihr verbunden hatte; dies fühlte Brigitta. Die angenommene Blasirtheit, der Anschein, Alles hinter sich zu haben und durch Nichts mehr getäuscht werden zu können, der scharfe, durchschauende Blick und das schonungslose Urtheil: das waren die willkürlich aufgebauten Stufen gewesen, auf denen er sich bis zu ihrer eigenen Erfahrung und Denkungsweise zu erheben und mit ihr auf gleichem Niveau zu sein schien. Die Natur aber fordert allmächtig und unbeugsam ihr Recht. Sie wollte sich seine Jugend nicht entgehen lassen – und er stand plötzlich vor ihr, voll Schwärmerei und Illusion, durchklungen von den gewaltigen Lebenstönen des zum ersten Male erwachten Herzens, in weiter, weiter Entfernung von Brigitta.
Er konnte ihr nichts mehr geben; sie konnte ihm nichts mehr sein; ihre Hände reichten durch so große innere Trennung hindurch nicht mehr zu einander hin, selbst wenn sie sich äußerlich in einander gelegt hätten. Sie sah mit einer Art Bewunderung auf den noch immer in sich versunkenen, noch immer auf dem Tabouret kauernden Mann herab, daß er so plötzlich zum Jüngling hatte werden können. Bald aber erfüllte sie sein Anblick mit tiefem Mitgefühl, so daß sie fast freudig sich bewußt wurde, ihm noch etwas sein zu können, eine Schützerin, eine Pflegerin, eine Schwester.
„Ich lasse Sie nicht allein nach Wiesbaden zurückkehren,“ sagte sie, „und hier ist Ihres Bleibens auch nicht. Ich habe an diesem Orte nichts mehr zu thun. Warten Sie hier auf mich! Ich nehme Abschied von der Gräfin und von Glowerstone’s und lasse den Wagen kommen. In Wiesbaden kann ich Sie getrost dem Lord und Ihren diplomatischen Geschäften überlassen. Thätigkeit ist jetzt das Einzige, was Ihnen Heil bringt.“
Er antwortete nicht und sie nahm Hut und Mantel. Die Gräfin befand sich bereits bei Glowerstone’s, so daß Brigitta ohne Aufenthalt hinübereilte. Sir Albert und seine „Muhme“ waren wie gewöhnlich in einem sanften Streit begriffen, der nur von seiner Seite immer lautern Schall annahm. Es handelte sich darum, ob es nicht gut wäre, Edith der Gräfin, wie sie es wünschte, nach Italien mitzugeben, während Sir Albert Nahrung für seine Welt- und Menschenverachtung darin fand, daß man ihn so herzlos allein lassen wollte.
„Da kommt ein Schiedsrichter,“ rief Sir Albert beim Anblicke der Geheimräthin; „aber ich hoffe nicht viel; ich habe die Frauen niemals auf meiner Seite.“
Die Gräfin erzählte, daß Edith angegriffen und traurig in ihrem Kämmerchen sitze, sich nicht zu Bette legen, aber auch keine Gesellschaft um sich sehen wolle. Der Grund der Verstimmung sei nicht ausfindig zu machen.
„Ich weiß ihn sehr gut,“ erklärte Glowerstone, „aber Ihnen, Muhme Isabel, wollte ich nichts davon sagen. Sie sind gleich mit dem Vorwurf bei der Hand, daß ich mir sanguinisch in der Einbildung einen Palast baue, der beim ersten Fußtritt, den ich hineinsetzen will, zusammenbricht. Diesmal aber bin ich gewiß, daß der Palast in voller Wirklichkeit vorhanden war und daß ihn Edith muthwillig zerstört hat.“
[823] Er setzte weitläufig aus einander, weßhalb es ihm wahrscheinlich sei, daß Siegfried Malköhne eine Zuneigung für Edith geäußert habe und das „verwetterte Mädel“ ihn aus angeborener Sprödigkeit, Weiberlaune, Eitelkeit vor den Kopf gestoßen haben müsse, und jetzt sei ihr nicht wohl dabei.
„Ach, es wäre so schön gewesen,“ rief er, schwärmerisch zum Himmel blickend. „Ich würde ein großes Haus gemacht haben, einen Koch aus Paris haben kommen lassen – und mein Keller!“
„Mit Ihren Principien, Sir Albert!“ konnte sich die Geheimräthin nicht enthalten zu äußern; „Sie verachten so sehr alle diese Dinge!“
„Ach was!“ platzte Glowerstone ärgerlich heraus; „ich will Ihnen etwas sagen, Frau Geheimräthin, und das ist der Schlüssel des ganzen Weltgeheimnisses und aller Weisheit. Also der Satz steht fest: Alles ist eitel. Genüsse, Ehren, Ruhm und Wonnen aller Art, das ist Alles nur eitel Nichtigkeit. Aber Eins ist nicht zu vergessen: diese Wahrheit ist auch eitel! Denn sonst – Sie verstehen –“
Die Geheimräthin war keineswegs in der Verfassung, sich in einen philosophischen Streit einzulassen; sie sagte, daß sie nur gekommen, um Abschied zu nehmen, sie wolle noch in dieser Nacht die Rückreise nach der Hauptstadt antreten. Glowerstone war darüber sehr bestürzt und fragte, was nun aus dem Gutsankauf werden solle, er hätte sich seit dem frühesten Morgen den ganzen Tag bemüht, ihr aus den Tabellen und Registern des Pächters verständliche Auszüge zu machen. Brigitta überwand ihre Verlegenheit, indem sie bemerkte, daß ja die Person des Käufers Sir Albert gleichgültig sein könne; sie werde aber durch ihre Konnexionen auf den Legationsrath einwirken können, daß das Geschäft von Seite der Regierung zu Stande komme.
Nachdem sich Glowerstone einigermaßen damit zufriedengegeben hatte, wünschte Brigitta, auch von Edith Abschied zu nehmen, und bat die Gräfin, sie in das Kämmerchen des Mädchens zu geleiten.
In dem engen Raume hätten drei Personen kaum Platz gefunden. Die Gräfin blieb an der Schwelle stehen und verabschiedete sich, um in ihre Wohnung im Hôtel zurückzukehren, mit der Bitte, daß die Geheimräthin sie dort noch einmal aufsuche, was diese versprach.
Sehr überrascht stand Edith der ihr halbfremden Frau gegenüber.
„Ich habe unmöglich von Ihnen scheiden können,“ sagte Brigitta, „ohne mir Ihre Züge noch einmal einzuprägen. Der Plan, Sie während meines Aufenthaltes hier zu zeichnen, ist freilich gescheitert; ich muß in die Hauptstadt zurück. Aber in meiner Galerie schöner Gesichter, die ich seit Jahren sorgsam mit Kreide festhalte, dürfen Sie um keinen Preis fehlen. Ich muß also mein Gedächtniß recht zu Hilfe nehmen.“
Sie setzte sich und rückte die kleine Lampe zurecht, damit die Strahlen derselben voll auf das Antlitz des Mädchens fielen.
„Nein,“ rief sie sodann, „nicht diesen Ausdruck, nicht diesen Kummer will ich mir im Gedächtniß wiederholen. Ihre Züge haben sich seit gestern verändert, und Sie sind bleicher, als ich mir vorgestellt.“
Diese letzte Aeußerung wurde sogleich zur Unwahrheit; denn hohe Röthe stieg in das Antlitz Edith’s, als sie den Zustand ihres Gemüthes beobachtet wußte.
„Ich bin Ihnen fremd,“ fuhr Brigitta in einschmeichelndem Tone fort, „aber ich bin eine Frau. Sie sind an diesem Orte so einsam, so verlassen; nehmen Sie mit meinem antheilsvollen Herzen vorlieb, weil eben kein anderes in Ihrer Nähe ist.“
Die welterfahrene Brigitta brauchte wenig Kunst, um ihre Absicht zu erreichen, die vorläufig nur dahin ging, das in seinem Gram und in der natürlichen Scheu, ihn zu enthüllen, gleichsam eingefrorene Herz zu bewegen, zu erschüttern. Sie sprach von dem Lose so vieler Frauen, was in ihrer Seele aufgekeimt war, sprachlos ersticken zu müssen, und sobald sie sich selbst als leidend, als tiefgekränkt vom Leben darstellte, war das richtige Mittel gefunden, Edith zu rühren, sie über ihr eigenes Geschick in Thränen ausbrechen zu lassen. Mit den Thränen kommt das Vertrauen zu Demjenigen, der sie hervorgelockt hat, und bald vernahm Brigitta mehr und mehr im Zusammenhang, was das Herz des Mädchens belastete.
Das war derselbe Schmerz, das waren dieselben Gefühle, von denen soeben Siegfried Malköhne zu ihren Füßen überströmt war. „Was trennt diese beiden gleich jungen und gleich liebeerfüllten Geschöpfe?“ fragte sich Brigitta und versank in ein stummes Nachsinnen.
Ein Kampf, ein letzter schwerer Kampf ging in der Seele der tiefgekränkten Frau vor. Ein fast unbewußter Trieb mahnte sie, die Brücke zur Vereinigung der Getrennten mit eigener Hand zu bauen, und doch war sie selbst es gewesen, welche noch vor so kurzer Zeit eine solche um den Preis ihres Lebens verhindert hätte, ja um den Preis, den Geliebten todt zu ihren Füßen zu sehen. Was aber hoffte sie noch, was wollte sie noch? Sie dachte an die Regung, mit der sie soeben den Tiefbekümmerten verlassen hatte, die Regung, die ihr gebot, eine Schützerin, eine Pflegerin, eine Schwester für ihn zu sein – und nichts weiter.
Ein letzter tiefer Seufzer entrang sich ihrer Brust, und dann war die Schwäche, die Selbstsucht, die Eifersucht für immer überwunden. Mit dem Tone, wie ihn nur eine Mutter anschlägt, redete sie zum Gemüthe Edith’s, die staunend und zitternd zu ihr aufsah, weil sie solchen Ton noch nicht vernommen hatte. Allein immer wieder entrang sich ihr die herzzerreißende Klage, daß er sie einer niederen Berechnung fähig gehalten und daß er sie folglich nicht lieben könne.
„Er sollte Sie nicht lieben?“ rief Brigitta, selbst schmerzlich bewegt, und schilderte die Stunde, die Siegfried soeben bei ihr verbracht hatte. Das Weh, das ihr sein Anblick verursacht hatte, bot ihr die glühendsten Farben, um dem Mädchen die Liebe zu malen, die einen Mann von so stolzer und hoher Gesinnung und von sonst so übermüthiger Verachtung alles schwächlichen Gefühlslebens so tief hatte beugen können. Edith war in der That erschüttert und zugleich beseligt, aber wie ein Wehruf entrang es sich ihr:
„Seine Zweifel würden kein Ende nehmen; lebenslang, Tag für Tag würden sie wiederkehren. Sagen Sie selbst, theure Frau, giebt es auf der ganzen weiten Erde einen Beweis – nicht in Worten, die immer nur erfolglos verklingen – einen thatsächlichen Beweis, daß ein Mißtrauen falsch und grundlos ist?“
„Sie haben ihn ja gegeben, diesen Beweis,“ rief Brigitta fast leidenschaftlich. „Sie haben ihn ja mit einem einzigen Wort gegeben, mit dem Nein, das ihn zurückstieß. Sie haben freiwillig, in einem Moment, als Sie Alles ergreifen konnten, Alles von sich gewiesen, den ganzen erbärmlichen Reichthum für Nichts geachtet, nicht werth, ein Atom Ihrer reinen Seele durch einen noch so leisen Verdacht zu schwärzen. Sie haben auf die Güter der Welt so thatsächlich verzichtet, daß für Siegfried nichts mehr übrig bleibt, als sich ewig und ewig zu wiederholen, er hätte das einzige Wesen gefunden, das unbestochen von weltlichen Vortheilen ihm die Hand gereicht, und er müsse nun an dem Beweise, daß er ein solches Wesen gefunden, elend zu Grunde gehen. Der Preis, um welchen er den entzückenden Gewinn erzielte, von der Existenz eines solchen Wesens zu wissen, war aber zu furchtbar; der Preis war der Verlust dieses Wesens selbst. So kann es, so darf es nicht bleiben; Sie dürfen nicht Denjenigen morden, den Sie erst zu seinem wahren Leben erweckt haben.“
So geschah es denn, daß in Edith gleichsam die untergegangene Sonne wieder aufging. Bald lag sie am Herzen der neuen Freundin, und wenn sie weinte, so waren es die Thränen des wiedergewonnenen Glückes. Brigitta beeilte sich, das Erreichte festzuhalten.
„Kommen Sie zu einem letzten Abschied von mir in meine Wohnung,“ rief sie, und sich zu einer heitern Wendung des Gespräches zwingend, fuhr sie fort: „Ich habe Ihnen ja nicht einmal Zeit gelassen, mir einen Gegenbesuch zu machen. Ich will aber nicht von hier scheiden, ohne das Bewußtsein, Sie einmal bei mir willkommen geheißen zu haben.“
Sie ließ nicht nach, bis Edith mit ihr auf der Straße war, und erst als sie an der Thür standen, die im ersten Stockwerke zur Gräfin führte, erhob sich in Brigitta ein neuer Widerstand.
Einen Augenblick dachte sie daran, Edith, die keine Ahnung haben konnte, was sie oben erwartete, allein die zweite Treppe hinaufgehen und vor Malköhne erscheinen zu lassen. Allein Brigitta war zu fein- und zu zartfühlend, um nicht zu fürchten, daß der Schreck des Mädchens über eine so uerwartete und fast unschickliche Begegnung Alles wieder vereiteln könnte. So mußte
[824][825] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [826] sich denn Brigitta auch das letzte Opfer noch auferlegen und Zeuge einer Versöhnung werden, durch welche das beste Glück, das sie auf Erden besessen hatte, zu den Todten geworfen werden sollte. Einen Augenblick preßte Brigitta ihr Tuch an die Augen; ein einziges krampfhaftes Schluchzen, rasch unterdrückt, entwand sich ihrer Brust. Dann war das Opfer vollendet und kein Klagelaut sollte sie selbst jemals glauben machen können, daß sie es bereute.
Sie traten in die Wohnung Brigitta’s; Malköhne, der eine Annäherung gehört hatte, stand aufrecht und todtenbleich mitten im Zimmer. Beim unerwarteten Anblick des Geliebten wollte Edith entfliehen. Brigitta umschlang sie mit beiden Armen und sagte mit zitternder Stimme:
„Hier hat er gewartet, sinnlos, gedankenlos, daß ihm irgend woher die erwünschte Vernichtung komme; bringen Sie selbst ihm das neue Dasein, führen Sie ihn an das höchste Ziel seines Lebens!“
Brigitta verschwand im Nebenzimmer. Malköhne, der weniger aus ihren Reden als aus der veränderten Miene Edith’s und ihren auf ihm ruhenden Blicken die glückselige Wendung erkannte, war von freudigem Schreck im Tiefsten erschüttert. Allein den Zusammenhang ahnend, fühlte er wohl, daß er nicht in unmittelbarer Nähe Brigitta’s die ihn beglückende Versöhnung zum Abschluß bringen durfte. Nur wenige leidenschaftliche Worte sprach er mit gedämpfter Stimme zu Edith und verließ das Zimmer, geräuschvoll genug, daß Brigitta seine Entfernung vernehmen und sich wieder zu Edith verfügen konnte.
Am nächsten Tage erfuhr Brigitta durch die Gräfin, daß Vetter Albert einmal in seinem Leben keinen zu sanguinischen Palast aufgebaut hatte, daß Edith sich wirklich mit dem Legationsrath Siegfried Malköhne verlobt hatte. Dieser war von einem richtigen Gefühle geleitet, indem er es vermied, Brigitta wiederzusehen. Er wußte, daß sie es ihm danken würde. Ihr Aussehen aber war von der Art, daß die Gräfin sie nicht verlassen wollte. Nach und nach kam der Bericht von Allem, was vorgefallen, über die Lippen Brigitta’s; die Gräfin war ihr zu theuer geworden, um ihr verschweigen zu können, was sie ihr ohnehin schriftlich hatte mittheilen wollen.
„Jetzt aber fürchten Sie nicht,“ schloß Brigitta, „daß mich die Welt elend sehen und jammern hören würde. Uns Frauen ist das laute Klagen verwehrt. Heiße Thränen in der Nacht geweint, die solchen Kummer verhüllt und verschweigt: das ist es allein, was uns bleibt, wenn uns das Leben enttäuscht hat und wir in unserm innersten Fühlen tödlich gekränkt sind.“
Die Gräfin fragte nach der nächsten Gestaltung der Lebenslage Brigitta’s.
„Ich habe ein kleines Gut in Ostpreußen,“ erwiederte diese, „seit undenklichen Zeiten ein Besitzthum meiner Familie, des Hauses Tartarow. Die Gegend ist sehr häßlich, aber was liegt daran? Ich werde mich dahin zurückziehen; dadurch erspare ich mir’s auch, mich mit der Verwaltung schriftlich zu beschäftigen. Bisher hat mir der Legationsrath das Bezügliche geordnet oder ordnen lassen.“
Die Gräfin warnte sie davor, sich der Einsamkeit zu überlassen.
„Immerwährende Veränderung,“ sagte sie, „täglich ein neues Ziel vor Augen, sei es noch so unbedeutend: das rettet noch allein Frauen vor dem Untergang, die ein Schicksal haben wie Sie und ich.“
Daran knüpfte die Gräfin den Namen des Freiherrn Ludwig von Perser. Er wäre eine passende Gesellschaft für Brigitta und könnte zugleich die schriftliche Verwaltung des Gutes führen. Brigitta hatte keine bestimmte Antwort darauf.
Die Frauen schieden. Die Gräfin begab sich nach Wiesbaden, um von dort aus nach Italien abzureisen, und Brigitta kehrte in die Hauptstadt zurück. Es währte nicht lange, so fand sich Perser mit einem Briefe der Gräfin bei ihr ein. In der That wurde es für Brigitta eine unentbehrliche Unterstützung, dem durchaus rechtlichen Manne ihre Geschäfte übertragen zu können und an dem Baron einen würdigen Repräsentanten zu haben, wenn sie nicht selbst auf dem fernen Gute mit dem Gewicht ihrer Persönlichkeit auftreten wollte. Perser bezog die Wohnung neben ihr, die er einst hatte miethen sollen. Wohl versuchte er nach und nach eine immer dringendere Bewerbung um ihre Hand; allein für eine edle Frau bleibt, wenn sich die Treue für ein geliebtes Wesen nicht gelohnt hat, nur noch ein letzter Trost: die Treue für den Schmerz, den ihr der Verlust verursacht hat.
Fast sechs Monate des Jahres brachte Perser getrennt von Brigitta auf ihrem Gute zu. In der Thätigkeit für sie lernte er allmählich gleich ihr selbst jene Entsagung lieben, die, während jeder Besitz von Unruhe begleitet ist, bei aller Wehmuth doch wenigstens einen dauernden Frieden in sich schließt.
Ein Hochverrathsproceß in Kanada.
Riel eröffnete den Feldzug nach einem Plan, der ganz den Verhältnissen und seinen geringen Streitkräften angepaßt war. Er versuchte, mit Schrecken und Gewalt zum Ziel zu gelangen. Er legte sich auf den Geiselfang, um den Feind durch die dann und wann ausgestoßene Drohung der Niedermetzelung der Geiseln zur Annahme seiner Bedingungen zu bewegen. Die größeren Unternehmungen dieser Art, die er plante, wie die Gefangennehmung der ganzen Besatzung der Forts Carlton, wohl gar die Gefangennehmung des englisch-kanadischen Heerführers, Generals Middleton, mißlangen ihm freilich.
Die von Dumont und Riel aufgebotenen Indianer vervollständigten den Schrecken, der Riel’s Truppen voranging. Wie eine flüchtige, aber verheerende Wolke jagten sie über die reichen Lande, raubend, plündernd, brennend, einmal auch, am 2. April am Froschsee (Frog-lake), grausam mordend unter wehrlosen Ansiedlern. Die Mestizen, die sich Riel anschlossen, verfuhren zwar etwas höflicher und glimpflicher in der persönlichen Behandlung der Bevölkerung, aber nicht minder gründlich in der Wegnahme alles ihnen Dienlichen, namentlich in der Ausleerung aller Magazine und Läger ihres Bereiches, in denen sich Waffen, Kriegsvorräthe, Nahrungsmittel, Decken etc. vorfanden. Sehr wohlhabende Leute sind dadurch vollständig verarmt. Gleich mit Beginn der Bewegung, am 18. März 1885 wurden auch die Telegraphendrähte durchschnitten, um eine Ansammlung feindlicher Streitkräfte zu verzögern. Die Indianer, mit ihrem scharfsinnigen und vortrefflichen Späher- und Vorpostendienst, verhüllten die Bewegungen der kleinen Heeresmacht Riel’s und hinderten jeden unerwarteten Angriff.
Die Verblüffung der gegnerischen Bevölkerung und der kanadischen Regierung war bei dem plötzlichen Ausbruch der Empörung fast eine vollständige. Deßhalb erfocht auch Riel anfangs, am 26. März am Entensee, gegen die wegen Mangels an Lebensmitteln ausgerückte Besatzung des Fort Carlton einen unbedeutenden Sieg und nahm am folgenden Tag das verlassene Fort ein. Er lagerte sich aber dann bis zum Mai ziemlich unthätig in Batoche und machte dem königlichen Oberbefehlshaber General Middleton erst den Uebergang über den Fluß an der Coulée des Tourond streitig, anfangs mit Erfolg.
Dagegen vermochte Riel’s ungeschulte Truppenmacht dem von Middleton gut geleiteten kleinen Heer der Kanadier nicht zu widerstehen. Nach dreitägigen heftigen Kämpfen wurde am 12. Mai Batoche, Riel’s Hauptquartier, erstürmt und den in bedrohlichster Lage befindlichen Geiseln die Freiheit wiedergegeben.
Riel war aus dem eroberten Ort in die Wälder geflohen. Seine Genossen retteten sich zum größten Theil über die Grenze der Vereinigten Staaten, namentlich Dumont. Ich glaube, Riel hätte sich gleichfalls retten können; einen Verräther hätte er unter dem treuen Volk nicht gefunden. Aber General Middleton hatte ihm nach der Einnahme von Batoche geschrieben: wenn Riel sich ergebe, werde er ihn schützen, bis die Regierung Riel’s Schicksal bestimme. Middleton’s Heerhaufe war inzwischen zur Verfolgung der letzten Streitkräfte Riel’s aufgebrochen. Riel wollte die Verfolgung und weiteres Blutvergießen vermeiden. So schrieb er am 15. Mai an Middleton, er wolle nach Batoche gehen, um sich dem Willen Gottes zu unterwerfen. Es war der edelste, aber verhängnißvollste Schritt seines Lebens. Wie er vorausgesehen und beabsichtigte, kehrte Middleton sofort um. Am nämlichen Tage wurde Riel gefangen in das englische Lager gebracht. Am Montag den 18. Mai wurde er, auf telegraphische [827] Weisung der kanadischen Regierung, unter starker Bedeckung zunächst zu Wasser, dann zu Lande der Stadt Regina zugeführt, wo er am 23. Mai anlangte. Er sollte das Gefängniß dieser Stadt nicht mehr verlassen.
Da das englische Strafproceßrecht die zeitraubende Voruntersuchung (in unserem Sinne des Wortes) nicht kennt, so konnte die Hauptverhandlung gegen Riel vor dem Schwurgericht zu Regina schon am 20. Juli beginnen. Die Geschworenenbank bestand nur aus sechs Geschworenen. Diese Abweichung von der uralten englischen Regel (der Zwölferzahl) beruht aber für Manitoba auf besonderem unangreifbaren Gesetz. Die deßhalb von der Vertheidigung Riel’s und der nordamerikanischen und irischen Presse erhobenen zum Theil recht leidenschaftlichen Vorwürfe sind daher unbegründet. Eben so wenig sind die Angriffe gegen die Unparteilichkeit des Richters Richardson und der Geschworenen irgendwie begründet. Vertheidigt wurde Riel von vier der besten Anwälte des Landes, die bis 700 Miles weit nach Regina gereist waren. Ihr Honorar war durch öffentliche Sammlungen aufgebracht. Die Verhandlung dauerte elf Tage.
Und dennoch erklärten am 1. August die Geschworenen Riel einstimmig der ihm beigemessenen Strafthaten schuldig, empfahlen ihn jedoch der Gnade der Königin, und Richardson verurtheilte ihn demgemäß pflichtschuldig zum Tode durch den Strang, vorbehältlich der königlichen Gnade.
Die Verurtheilung konnte nur geschehen, wenn die Geschworenen zugleich annahmen, Riel sei geistig gesund.
Die Frage des geistigen Zustandes Riel’s ist die interessanteste des ganzen Processes und hat während desselben und später die eingehendste Erörterung gefunden. In einer Unzahl englischer und französischer Strafprocesse wird ja von Seiten der Vertheidigung der Einwand der Unzurechnungsfähigkeit des Angeklagten erhoben, so daß man häufig geneigt sein mag, diesen Einwand nicht ernst zu nehmen. Aber hier stand es anders. Die Vertheidigung hatte von Quebec den Dr. Roy kommen lassen, um zu beweisen, daß Riel von 1876 bis zum 21. Januar 1878 19 Monate lang im Irrenhause zu Beauport gewesen war, wegen Größenwahns. Acht Tage lang mußte deßhalb die Verhandlung ausgesetzt werden, bis der Irrenarzt eintraf. Dr. Roy bestätigte diese Thatsache vollkommen und versicherte, Riel sei noch jetzt unzurechnungsfähig, er habe zur Zeit seiner Empörung Gutes und Böses nicht unterscheiden können.
So günstig stand dieser wichtigste Theil der Beweisaufnahme für Riel’s Vertheidigung, als Dr. Roy durch den schneidigen Staatsanwalt Osler ins Kreuzverhör genommen wurde – und als dieses geendet war, hatte der Doktor wohl bei Allen im Saale, jedenfalls bei den Geschworenen, jeden Glauben verloren. Dieses Kreuzverhör war die glänzendste Leistung des ganzen Processes. Mit unbarmherziger, planvollster Folgerichtigkeit trieb der Kronanwalt den Arzt fortwährend aus einer seiner vermeintlich sicheren und gedeckten Stellungen in eine neue thatsächlich eben so unhaltbare. Zuerst mußte Dr. Roy zugestehen, daß jährlich 800 bis 900 Irre in Beauport behandelt würden, darunter „leider nur“ 25 bis 30 Größenwahnsinnige im Jahr. Dr. Roy mußte einräumen, daß ohne besondere Hilfsmittel des Gedächtnisses oder des Falles die Erinnerung an Name und Krankheitsart des einzelnen Patienten nach Jahren nicht möglich sei. Zudem hatte der angebliche Riel in Beauport gar nicht Riel, sondern Larochelle geheißen. Gleichwohl hatte Dr. Roy, der doch schon vor Beginn des Processes wußte, daß er vernommen werden sollte, nach Regina gar keine – der angeblich reichlich vorhandenen – urkundlichen Beweise mitgenommen, um sein Gedächtniß zu unterstützen und um die Identität der Person des Angeklagten mit Larochelle zu beweisen, außer einer Strazze. „Da sehen Sie, von welchem Werthe schriftliche Beweise wären!“ muß er sich von Osler vorhalten lassen. Der Vertheidiger Fitzpatrick springt dem Arzt bei mit der Aufforderung, nur Französisch, mit Hilfe eines Dolmetschers, zu antworten. „Wenn der Zeuge sich hinter das Französische verstecken will, so kann er es thun!“ ruft Osler scharf.
Das war aber nur der Anfang von Dr. Roy’s fluchtartigem Rückzug. Denn nun nagelte ihn Osler an der Begriffsbestimmung fest, die Dr. Roy von der Geisteskrankheit „Größenwahn“ im Allgemeinen geben mußte. Dr. Roy meinte: „Die specielle fixe Idee des Kranken, der Wahn seiner Größe, sein Weltverbesserungsplan etc. sei unerschütterlich, und so weit diese Manie in Frage komme, vermöge der Kranke auch Gutes und Böses nicht zu unterscheiden.“
Da thut Osler die glänzende Frage: „Ob ein der Vernunft beraubter Mann, dessen fixe Idee unerschütterlich ist, sich dazu verstehen könne, diese Idee gegen Zahlung von 35 000 Dollars fallen zu lassen?“
Schließlich entläßt der Kronanwalt den Zeugen mit den schneidenden Worten: „Wenn Sie weder Englisch noch Französisch antworten können, werde ich viel besser thun, Sie gehen zu lassen – Sie können sich zurückziehen.“
Wir haben bei dieser Scene länger verweilt, weil sie jedenfalls die Hauptfrage des ganzen Processes entschied, die Geschworenen von der Geistesgesundheit Riel’s überzeugte. Die Vernehmung der übrigen Aerzte vervollständigte nur diese Ueberzeugung. Sie hielten Riel für geistig klar und zurechnungsfähig. Ebenso urtheilten die Officiere, welche Riel nach seiner Gefangennahme bewacht und begleitet hatten, der Gefängnißarzt und Wärter. Auch die Rede, welche Riel zum Schlusse der Verhandlung hielt, ehe die Geschworenen ihren Wahrspruch abgaben, muß bei den Geschworenen die Ueberzeugung von seiner geistigen Gesundheit bestärkt haben – nämlich wegen der sichtlichen Tendenz des Redners, unzusammenhängend und verwirrt zu sprechen und seltsame Gebete und Offenbarungen plötzlich in nüchterne Betrachtungen einzuflechten – mit einem Worte für verrückt zu gelten. Diesen Eindruck hatte aber Riel’s ganzes Handeln auf die Geschworenen bisher durchaus nicht gemacht.
Wie richtig die Geschworenen hierbei urtheilten, zeigte sich erst später. Die stärksten Beweise für Riel’s geistige Gesundheit brachten Riel und seine Freunde erst bei, als das Schuldig gesprochen war: er selbst, indem er in einer Rede unmittelbar nach Verkündung des Wahrspruchs eben so vernünftig, planvoll, scharfsinnig sprach, als kurz zuvor verwirrt – diesmal zu dem Zwecke, um seine Begnadigung wirklich zu erlangen, welcher die Geschworenen ihn anempfohlen hatten; seine Freunde, indem sie ein Schreiben bekannt machten, das Riel am 6. Mai – also in der größten Erregung des Kampfes, unmittelbar vor der Entscheidung um Batoche – an die Zeitung „Irish World“ gerichtet hatte. Und dieses Schreiben aus den Tagen der größten Erregung war zwar furchtbar bitter gegen England und alles englische Wesen, aber durchaus planvoll, klar, ja man kann sagen: mit durchtrieben scharfsinniger Berechnung abgefaßt. Wenn damals Louis Riel geistig gesund war, so war er es immer!
Auch die weisen, gründlichen und vorurtheilslosen Richter der zweiten Instanz (des Appellhofes von Winnipeg) haben dieses Urtheil über Riel’s Geisteszustand in eigenen ausführlichen Gutachten bestätigt.
Endlich wird der letzte denkbare Zweifel beseitigt durch Riel’s Verhalten in den letzten Tagen vor seinem Ende. Sein Testament vom 6. November ist eben so klar und einsichtsvoll – bis auf die Erkenntniß eigener Schuld, zu welcher er sich nie verstand und nie gelangt ist – als sein letzter Brief an seine Mutter, den er Nachts um 2 Uhr am 16. November 1885, sechs Stunden vor seiner Hinrichtung niederschrieb. Auch bis zu seinem letzten Augenblick war er ruhig, klar und gefaßt, und er starb muthig, wenn er auch noch auf dem Schaffot die Worte stammelte: „J’espère encore!“ – „Ich hoffe noch immer!“
Tausende hatten bis zu seinem Ende mit ihm gehofft, daß die Regierung ihm Gnade schenken werde. An Bittschriften, an Agitationen, an leidenschaftlichen Angriffen der Presse ist zu diesem Zwecke Alles aufgeboten worden; aber die kanadische Regierung blieb fest, und der geheime Londoner Kabinetsrath widerrieth der Königin die Gnade. Daß Riel kein Nationalheld, keines jener reinen selbstlosen Opfer der Hingebung an hohe Ideen war, deren Stirne für ewige Zeiten der goldene Schein des Märtyrers oder Apostels umfließt, ist klar. Daß er, unter dessen Befehl Hunderte ihr Leben geendet hatten und eine Provinz in Asche und Verwüstung sank, Maß für Maß und Leben für Leben den Tod verdiente, ist zweifellos; daß sein Proceß gerecht geführt und entschieden wurde, gleichfalls. Aber dennoch hätte höchste Weisheit ihm vielleicht trotz alledem ein milderes Schicksal und Ende gewähren können, als das nach dem Gesetz verdiente – freilich nicht immer ist höchste Weisheit auch höchste Klugheit, nicht immer ist sie angebracht! Hans Blum.
Weihnachten eines Seekadetten.
Eine lustige Nacht! Eine tolle Nacht! Seiner Majestät Schiff „Jason“ tanzt im Wogengetümmel mit dicht gerefften Segeln nach der Musik, welche der Meister Sturm aus allen Tonarten pfeift. Bald fiedelt er in den höchsten Regionen der Tonleiter und sämmtliches Tauwerk vibrirt in dem Triller; bald rauscht und brummt er im tiefsten Baß und giebt dabei der Fregatte einen Stoß, daß sie eine Verbeugung nach der Seite macht, die befürchten läßt, das Schiff werde kopfüber auf den Meeresgrund gehen. Aus nachtschwarzem Himmel gießen Wasserfluthen herab und von unten schäumen die übermüthigen Wellen über die Reeling des Schiffs. Auf dem Schiff selbst stehen achterwärts vier Mann am Steuer; mit aller Kraft haben sie das Steuerruder in dem vorgeschriebenen Kurse zu erhalten; die ungebärdigen Wogen möchten es ihnen entreißen, aber keinen Strich Ost oder West lassen sie sich rauben. Eine hohe Mannesgestalt, dicht in einen Regenrock eingeknöpft, dessen Kapuze das Haupt umgiebt, steht auf dem Hinterdeck in Luv, und mittels eines Nachtglases späht sie hinaus in die dunkeln Meeresweiten: das ist der „wachthabende Officier“. Vorn, im Bereich des Fockmastes stehen ebenfalls mehrere Gestalten wie angenagelt, der „Ausguck“ und ein Theil der Backbordswache. Und weiter: mittschiffs, so in der Nähe des Großmastes, kauern an gedeckten Stellen mehrere menschliche Körper, denen in dieser Nacht das süße, wenn auch unerlaubte „Nickerchen“ von selbst vergeht: es sind die Kadetten der Wache. Diese letztere junge Schar vielleicht ausgenommen, empfinden aber die Männer, welche zur Zeit auf dem Oberdeck der „Jason“ sich befinden, von dem Pfeifen und Orgeln, Brausen und Zischen rings in Luft und Wasser keinen stärkeren Eindruck, als hörten sie einige Knaben ihre neuen Jahrmarktspfeifen probiren oder als sei ein Weinglas an fröhlicher Tafel ins Schwanken gerathen. Das macht die strenge Zucht, welche „von oben“ kommt und den Menschen zur heilsamen Disciplin erzieht, daß er selbst in Noth und Tod nicht den Kopf verliert und allzeit den alten friesischen Seemannsspruch: „Rum Hart, klar Kimming“, „Weites Herz, klarer Horizont“, vor Augen hat.
In dieser Zucht sollen auch die blühenden Jünglinge, die Seekadetten, erstarken, um derentwillen die „Jason^ auf jener Hälfte des Erdballs sich befindet. Vor Allem ist die Zucht Einem nöthig, den die Kameraden in der Kadettenmesse den „Durchgänger“ nennen; in der Liste der „Jason“ steht er als Bruno Stein, Seekadett, verzeichnet: er, der Jüngling-Mann, welcher, von einer Kanone gegen den Sturm geschützt, seine vier Stunden Wache durch einige höchst unstatthafte Gedanken zu verkürzen strebt. Die schaurige Nacht ist dem langen Burschen schon recht. Solchen energischen Beweisen einer „höheren Macht“ kann er einigen Respekt nicht versagen. Aber die Menschen? Besonders diejenigen auf Seiner Majestät Korvette „Jason“? – Ach, nicht so viel giebt er drum, wenn er sich auch freilich wohl hütet, dem „Wachthabenden“, oder gar dem Bootsmann, dem Gestrengen des Vorderdecks, auch nur die leiseste Ahnung eines solchen Gedankens zu erwecken.
Da kauert er nun im Nachtdunkel und lehnt sich im Herzen gegen alle Ordnung und alle Pflichten auf; am meisten gegen die nächsten Vorgesetzten. Da ist der „Wachthabende“, der ein so gemüthlich Fahrzeug war, so lange er, selber Kadett, mit den Kadetten auf einer Bank saß; seit er aber den Officier herausgebissen hat, ist er der schlimmste Chikaneur von allen; und der Bootsmann gar? Na, der kennt ja ohnedies keine grimmigere Freude, als wenn er dem ersten Officier eine recht lange „schwarze Liste“ vorlegen kann und dieser die darauf stehenden Schuldigen den Strafarbeiten des Bootsmannes überweist. Außerdem ist Bruno Stein sich bewußt, bei dem ersten Officier ebenfalls nicht gut angeschrieben zu stehen. Mit geheimem Zähneknirschen gedenkt er des häufigen Bordarrestes, während die Kameraden mit Sang und Klang an Land gehen durften. Na, wartet nur, wenn ich erst Officier bin – nein, so lange wird nicht gewartet. Ihr sollt noch mit mir zu thun haben, ihr Disciplinhelden, ihr Ordnungsphilister, ihr Reinlichkeitsnarren, ihr – ihr –! Weiter kommt der junge Mensch nicht mit seinem geheimen Raisonnement, denn der wachthabende Officier ruft ihn an und schickt ihn mit einem Auftrag an den Bootsmann.
Das paßt ihm wieder nicht. Ihm paßt überhaupt nichts an Bord der „Jason“. Gehorchen und wachen – wachen und gehorchen! Das wird dem neunzehnjährigen Kopfe blutsauer. Er hatte sich die Wirthschaft auf solchem Kriegsschiff ganz anders vorgestellt, und nun ist sie schlimmer als „daheim“ der Schulzwang und die unerträgliche väterliche Autorität. Die letzten Beiden sind vollständig abgeschüttelt worden, so vollständig, daß nicht mal der Zwang eines Briefes auf ihm liegt. Er ließ alle elterlichen Briefe unbeantwortet; mögen sie daheim doch warten, bis es ihm beliebt zu schreiben. Eben so wird auch die Kette, welche das Vaterland ihm durch die Admiralität anlegen ließ, bei erster Gelegenheit abgestreift werden. In irgend einem Schlupfwinkel der vielbuchtigen Küste Ostasiens wird der kühne Plan ausgeführt werden. Freiheit! Freiheit! Das Wort erregt in der Brust des jungen Menschen ein merkliches Zittern. Das Schimpfliche seines Vorhabens empfindet er nicht, weil die Stimme der Ehre schweigt vor der begehrlichen Sprache der Lust.
Gährend umbraust ihn die Finsterniß; unten in der Tiefe blitzen grünliche Funken auf. Der Wind wächst von Minute zu Minute. „Großsegel weg!“ tönt das Kommando, welches alsbald durch die schrillen Pfiffe des Bootsmanns der ganzen Mannschaft zur Kenntniß gebracht wird und hundert Hände zugleich in Bewegung setzt, a tempo das mächtige Stück Tuch dicht an die Raa zu bringen.
Sicher, als hätten sie den Boden eines Tanzsaales unter ihren Füßen, laufen die Leute an den Wanten empor; als leuchte ihnen das strahlende Tagesgestirn, so genau wissen sie ihren Weg in der schwankenden, vom Sturme gepeitschten Takelage zu finden. Auch der Kadett der Wache hat mit hinauf müssen in den Großmars, um die Ausführung des Kommandos zu überwachen. Jetzt ist es ausgeführt; wie die Katzen gleiten die Matrosen hernieder. Bruno Stein als der Letzte setzt eben den Fuß in das Großwant, [829] als eine brüllende See das Schiff hebt und, plötzlich in sich zusammenstürzend, auch diese Bewegung dem Fahrzeug mittheilt. Der heftige Stoß wird von dem Kadetten hoch oben in dunkler Luft nicht genügend parirt. Ein furchtbarer Schrei und durch die Finsterniß fliegt ein Körper hinab in den Ocean. „Mann über Bord,“ schreit es auf Deck und – es geschieht, was in solcher Zeit in solchem Falle gethan werden kann.
Bruno Stein fühlt beim Stürzen einen entsetzlichen Druck, unter dem er zu ersticken meint, purpurne Lichter zucken vor seinen Augen; an sein Ohr dringen Stimmen, halb höhnisches Gelächter, halb donnerndes Strafgericht. Ihm vergehen die Sinne. Nur für einen Moment, dann rieselt es glühend durch seine Adern. Instinktiv macht sein Körper die Bewegung des Schwimmens. Der entsetzliche Druck auf Haupt und Brust mindert sich. Schneidende Kühle umgiebt sein Haupt. Er kann Athem schöpfen. Er öffnet die Augen. Er ist emporgekommen aus der grausigen Tiefe und wird von den Wellen hin und her geschleudert.
Da, dort, einem schwarzen Phantom gleich, schaukelt die „Jason“ – auf den nachtschwarzen Wassern. Jetzt schwebt sie auf der Spitze eines Berges, nun stürzt sie in ein Wellenthal. Ha, jetzt saust das Schiff in einem großen Bogen herum, ein Sternlein fliegt vom Schiff auf die tobende See herab.[1] Zu ihm! Zu ihm! Mit verzweifelter Anstrengung sucht der Schwimmende das auf dem Wasser glimmende Lichtlein zu erreichen. Jetzt hat er es erreicht; er streckt den Arm aus, sinkt aber kraftlos in die Tiefe zurück, und aberwals umfassen ihn die Schauer des Todes. Jähe Blitze zucken hin und her, tiefe Orgeltöne in zermalmender Fülle dringen in sein Ohr. Dazwischen unterscheidet der Ertrinkende deutlich eine weinende Menschenstimme; er sieht dicht über sich das liebe Antlitz seiner Mutter, welche schluchzend sagt:. „Mein Sohn, warum hast Du mir das gethan?“
Und so ermuthigend dringt ihr Weinen in seine dahinschwindende Seele, daß er mit letzter Kraft wieder die Arme bewegt, und als bohrten sich glühende Nadeln in sein Hirn, denen er entfliehen müßte, schnellt er abermals empor zur Oberfläche. Nur nicht das Weinen hören! Und welche Vorstellungen, welche Gedanken drängen sich blitzschnell in seiner Seele!
Leben! Leben! Gehorsam! Subordination! Briefe schreiben! Gleich, sofort will er schreiben, daß nur die Mutter wieder lächle! „Wir wollen den Burschen schon ’rumkriegen,“ hört er den Bootsmann sagen. Keine Ermahnungen mehr, liebe Mutter! Nicht sterben! „Der störrische Sinn muß gebrochen werden!“ Nein, nein, nicht mehr störrisch! Mutter, Mutter! –
Das Sternlein erlischt, er hat es nicht erreicht.
„Kamerad! Bruno Stein! Wir sind da! Muth, Muth!“ Aus weiter Ferne hört er den Ruf, kann aber nicht mehr antworten, nur ein dumpfes Stöhnen dringt aus der Brust. „Mutter, liebe Mutter,“ seufzt er matt und weiß ferner nicht, was in Nacht und Graus mit ihm vorgeht; er fühlt nicht, daß kraftvolle Arme ihn packen und den Wellen entziehen. Bruno Stein ist besinnungslos: aber er lebt. – –
Um einige hundert Meilen ist die Korvette nordwärts gesegelt, und seit ihn der Ocean in seinen todbringenden Armen wiegte, ist mit dem Kadetten Bruno Stein eine große Veränderung vorgegangen. Der störrische Bursch ist ein pflichttreuer Mensch geworden, der sich weder vor dem ersten Officier, noch vor dem alten grauen Bären, dem Bootsmann, zu fürchten hat. „Der wird! Er hat den Wind von vorn gekriegt!“ sagt der „Gewalthaber vor dem Maste“ und schiebt ein neues Stück Tabak in seine ausgeweitete Mundhöhle. Einen Haken hat die Sache aber doch. Der sonst so überkecke Kadett leidet seit jener Nacht an Schwermuth; je näher die „Jason“ ihrem nächsten Hafen kommt, je mehr das Datum dem 24. December entgegenrückt, um so düsterer wird seine Stimmung.
Weihnacht! Trotz fester Disciplin und strammen Dienstes schlagen zwanzig Kadettenherzen schneller, wenn das Wort im leise geführten Gespräch auftaucht. Weihnacht! Wo auch Seiner Majestät Schiff sich befinden möge, es wird den jungen Menschenkindern eine fröhliche Feier bereitet werden, freilich nicht von Eltern und Geschwistern, sondern von der „großen Mutter“, der Marineverwaltung. Nur für den unglücklichen Bruno Stein wird es kein Christfest geben. Er glaubt durch seine trotzige Nichtachtang der elterlichen Liebe das Anrecht auf dieses Fest der Liebe verscherzt zu haben; kaum darf er hoffen, daß die Eltern seiner gedenken.
Die Korvette ist nach Amoy beordert. Hier findet sie Befehl, die „Ariadne“ zu erwarten, die zur Ablösung unterwegs ist. Also in Amoy muß Weihnacht gefeiert werden. Nicht gerade zur Erbauung für Officiere und Mannschaften, die lieber in einem großen Welthafen, etwa Hongkong, binnengelaufen wären , aber das Kadettenvölkchen ist ganz aus Rand und Band; der Platz ist einerlei, Weihnacht ist eben Weihnacht.
O Welt, wie bist du weit! Wo Amoy liegt? An der Ostküste des chinesischen Reichs. Genauer: unter 24 Grad nördlicher Breite und 118 östlicher Länge, auf einer dem Festlande [830] nahe liegenden Insel. Bis vor wenigen Jahren war der Ort verrufen als Schlupfwinkel für Seeräuber. Es konnte geschehen, daß ein segelfertiges Schiff den Hafen nicht verlassen durfte, weil eine Piratenflotte sich vor der Ausfahrt festgelegt hatte und darauf lauerte, das gute deutsche Schiff sammt seiner kostbaren Theeladung so mir nichts dir nichts herunterzuschlucken und die dabei etwa unbequem werdenden Seefahrer einfach ins Jenseits zu expediren. Volle vierzehn Tage dauerte die unerhörte Blokade. Erst als ein englisches Kriegsschiff, das Amoy anlaufen wollte, um dort frisches Wasser einzunehmen, einige Kanonenschüsse unter die freche Bande schickte, machte diese sich eiligst mit allen Segeln davon und das deutsche Schiff konnte unter dem Schutze des Engländers auslaufen.
Heute ist Amoy ein durchaus sicherer Platz; heute hat auch Deutschland selbst seine herrlichen Kriegsschiffe in jenen Gewässern, und die deutsche Flagge wird nicht nur von den Wasserbanditen mit banger Scheu gemieden, sie erfreut sich des höchsten Ansehens unter der einheimischen Bevölkerung, vom braunen oder gelben Eingeborenen an, der ohne Schuhe läuft, bis zum reichen Handelsherrn, welcher von Gold und Silber speist.
Sobald die Anker gefallen sind, schwebt Weihnachtsstimmung über Schiff und Mannschaft. Zwar muß der Dienst versehen werden; aber die Zügel werden nicht so straff gehalten, daß nicht Jugendlust ihre fröhlichsten Purzelbäume schlagen könnte. Die gestrengen Herren hoch oben wissen ganz genau, wie es zur gesegneten Weihnachtszeit in jungen Menschenseelen zu rumoren pflegt, und da unsere Marineverwaltung ihren Zöglingen nicht nur eine ernste Lebenserziehung angedeihen läßt, sondern ihnen auch – sobald Ort und Zeit angemessen sind – ein sorgliches und herzliches Eingehen auf ihre jugendlichen Gefühle und geistigen Bedürfnisse gewährt, so haben die jungen Leute unter der Kriegsflagge des Deutschen Reichs das Bewußtsein, ein großes gütiges Mutterauge wache über ihnen.
Des Putzens, Scheuerns, Spülens ist kein Ende; die „Jason“ will am Feste sich selbst übertreffen. Die Küchenmeister haben unendlich zu schaffen und ihr Hilfspersonal weiß nicht aus noch ein vor lauter Festzurüstungen. Schon kommen einzelne Sanpans, von schlitzäugigen, gelben Weibern gerudert, langseits der „Jason“. Sie sind hochbeladen mit Tannengrün, Stechpalmen und allerlei exotischem Gebüsch. Um diese kostbaren Dinge entspinnt sich alsbald eifriger Handel, der damit endigt, daß die deutschen Matrosen den Grünkram eiligst unter Deck schaffen.
Unter den Kadetten wird großer Rath gehalten: es soll etwas Außerordentliches geschaffen werden, und um es in Scene zu setzen, wird aus ihrer Mitte ein Weihnachtsvorstand gewählt. Bruno Stein, als der Aelteste der Schar, soll Vorsitzender sein; der aber sagt: „Laßt mich mit Euren Kindereien in Ruhe,“ und geht abseits, damit er das dünne Stäubchen wegwischen kann, das ihm ins Auge flog.
Es hilft nichts! Die mageren wie die runden Börsen müssen ihr Innerstes ausschütten und das artige Häuflein wird feierlichst dem Vorstand anvertraut, daß er für Geschenke und Ausschmückung der „Messe“ sorge.
Amoy ist eine echt chinesische Stadt; nur wenige Europäer wohnen dort, und diese stehen meist in chinesischen Diensten. Während nun die fröhlichen Kameraden sich in der Stadt umhertreiben, kaufen und feilschen, bei den verwickelten Münzverhältnissen großartige Proben ihrer Rechenkunst ablegen und sich schließlich doch anführen lassen, schreitet der schwermüthige Bruno die Küste entlang. Er will allein sein; jedes heitere Wort verletzt ihn; er kann gar nicht lachen hören. Außerhalb der Stadt ersteigt er einen der im Mittelgrunde der Insel sich erhebenden, konisch gerundeten Berge. Zu seinen Füßen liegt das Dächergewirr der chinesischen Häuser; hier und dort hebt sich ein phantastisch geschweifter Tempel heraus. Aber so seltsam die Gegend, sie ist reizlos, weil das Waldesgrün fehlt. Und leuchtete nicht drüben das Meer in farbensattem Spiel – der junge Seemann würde die Empfindung der Heimathlosigkeit haben. Er hat sie auch so.
Vier Briefe, echt mütterliche Briefe voll heißer Sorge um den geliebten Sohn, sind auf den verschiedenen Stationen der Reise in seine Hände gekommen. Er weiß, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit alle diese Briefe bedurften, ehe sie ihn erreichen konnten – aber keinen einzigen hat er beantwortet, weil ihm die ewigen Ermahnungen zuwider waren, weil er nicht Zwang dulden wollte.
Nun steht seit jener Sturmnacht das gramvolle Gesicht der vergeblich hoffenden Mutter vor ihm. Er darf nicht glauben, daß die Liebe unerschöpflich – und dazu ist Weihnacht vor der Thür.
Wohin ist der junge Mann gerathen? Er schaut sich um. Er schreitet über ein wüstes Steinfeld, dem nur mageres Gebüsch an einigen Stellen entsproßt. Aus dem Trümmerfelde erheben sich einige regelrecht geschichtete Steine zu einer Art Hütte; aber kein lebendes Wesen ist zu schauen, nicht einmal ein Käfer oder surrendes Bienlein unterbricht die Ruhe des Todes. Bruno befindet sich auf der Todtenstätte von Amoy. Das ist ein trauriger Ort, der zu seiner Seelenstimmung paßt.
Er setzt sich auf einen Felsenklotz und – weint.
Doch auch die Stunde geht zu Ende. Bei der Rückkehr findet er die lustigen Kameraden im Begriff, mit dem Boote abzustoßen. Mit Halloh wird der „Durchgänger“ empfangen. Die hübschen Gesichter glühen; eifrig sprechen Alle zu gleicher Zeit, und tausend kleine Abenteuer werden zu großen Aktionen aufgeschwellt.
Von der „Ariadne“ ist inzwischen noch kein Lebenszeichen vorhanden. Schon wird die Hoffnung auf die Weihnachtspost recht schwach; bleibt die aber aus, dann ist dem Feste alle Freude genommen. Nicht nur dem Völkchen der Seekadetten und Schiffsjungen, auch den Officieren bis zum Kommandanten hinauf – jeder hat doch ein liebes Menschenherz im fernen Deutschland, von dem ein Festgruß zu erwarten steht.
Der 24. December bricht an. Schon bei Zeiten hört man geheimnißvolles Klopfen und Hämmern, untermischt mit Gesang aus allen Ecken und Winkeln des Schiffs. Der bärbeißigste Unterofficier, der strengste Wachthabende drückt heute ein Auge zu. Von früh Morgens an wimmelt es um die Korvette von Sanpans, welche grünen Schmuck anbieten, und ganze Berge davon werden unter Deck geschleppt, wo hundert Hände sich darnach ausstrecken, um sie zur Ausschmückung der verschiedensten „Messen“ (Speisesäle der Officiere und Kadetten) und „Backen“ (Tischgesellschaften der Matrosen und Mannschaften) zu verwenden.
Inzwischen wird die Frage wegen der „Ariadne“ eifrigst erörtert. Sowohl „vor“ als „hinter dem Mast“ entstehen zahlreiche Wetten für und gegen das zu erwartende Schiff. Selbst der trübselige „Durchgänger“ kann sich der allgemeinen Aufregung nicht entziehen. Auch er wettet, und natürlich, seinem Gemüthszustand angemessen, gegen die „Ariadne“. Wenn sie überhaupt rechtzeitig eintrifft, ihm, Bruno Stein, bringt sie sicher keinen Brief; er hat die Liebe von Vater und Mutter gründlich verwirkt. Dennoch fliegen auch seine Blicke oft zu der Citadelle empor, von woher das erste Zeichen eines in Sicht kommenden Schiffes gegeben wird.
Endlich – schon steht die Sonne im Zenith – meldet der Kadett der Wache: „Kriegsschiff signalisirt.“ Alles stürzt an Deck; mit und ohne Ferngläser sucht man dem am Horizont auftauchenden Pünktchen seine Nationalität abzugewinnen. Vergebens, die Entfernung ist zu groß. Nun rückt der Punkt näher, ein Schiff entwickelt sich daraus; aber was für eins? Zwischen dem Schiffe und der Signalstation, welche die Nationalität melden muß, ist die Aufmerksamkeit getheilt. Jetzt wird auf der Station die Flagge gehißt – aber nicht die deutsche, sondern die englische. Ach, da steht manches Herz schier still und der Triumph der Gegner der „Ariadne“ will nicht so recht zu Tage treten. Dennoch wird ein Fünkchen Hoffnung festgehalten, es kann ein Irrthum vorliegen. Man weicht und wankt nicht vom Deck, und richtig – im Moment, wo mehrere Stimmen zugleich rufen: ein deutsches Schiff, die „Ariadne“! da rauscht auch auf der Citadelle die deutsche Kriegsflagge am Mast empor. Grenzenloser Jubel! Hundertstimmiges Hurrah empfängt das bald darnach majestätisch in den Hafen dampfende Schwesterschiff!
Nun beginnt auf der „Jason“ eine Unruhe, ein Hasten, eine Aufregung, die alle Schranken zu durchbrechen droht. Die Post? die Post?
„,Ariadne‘ hat keine Post mitgebracht!“ Durch diese Nachricht wird die junge Welt völlig niedergeschmettert; Mancher schleicht bei Seite, um die unvermeidlichen Thränen der Enttäuschung und des Heimwehs zu verbergen. Doch nicht lange dauert es und die Trauer wird abgeschüttelt; es gilt, letzte Hand [831] an die festlichen Vorbereitungen zu legen. Für die abendliche Bescherung werden jetzt schon die Lose gezogen; durch sie entsteht ein gewisses Gefühl der Sicherheit, daß es doch wohl nicht so „ganz ohne“ abgehen werde. Auch müssen die Wetten zum Austrag gelangen. Bruno Stein hat unvorsichtigerweise seine „ganze Bescherung“ eingesetzt und dementsprechend händigt er seinem glücklichen Partner gleich sein Los aus; er will gar nicht sehen, durch was man ihn erfreuen wollte.
Der Abend ist da und mit ihm jenes geheimnißvolle Weben der Liebe, die in Palast und Hütte waltet, so weit die deutsche Zunge klingt. Sie waltet auch auf dem deutschen Kriegsschiffe, fern an den Grenzen der Civilisation.
„Alles klar zur Bescherung!“
Zunächst wandert Alles, Hoch und Niedrig, Alt und Jung zu den „Backen“; ein Tisch ist noch herrlicher geschmückt als der andere: Licht, Glanz, fröhliche Gesichter überall. Darnach geht’s in das wahre Weihnachtsheiligthum, in die Kadettenmesse, wo der „Vorstand“ seit Stunden im Schweiße seines Angesichts gearbeitet hat. Eine in hundertfältigem Lichtschmuck strahlende Edeltanne reckt ihre Zweige bis an die Decke des Schiffsgemaches; die Wände sind mit stark duftendem Grün bekleidet, in welchem zahlreiche phantastische chinesische Lampen glühen. Auf langer weißgedeckter Tafel aber liegen die Geschenke ausgebreitet. Es werden der Kommandant und die höheren Officiere „um die Ehre ersucht,“ und erst nachdem der hohe Besuch sich entfernt hat, läßt die Jugendfreudigkeit sich nicht mehr zügeln. Ein unbeschreiblich heiteres Durcheinander füllt den Saal.
Ein Einziger nur hat sich in die fernste Ecke gedrückt und brütet dumpf vor sich hin. Im Getümmel scheint Niemand seiner zu achten: es ist Bruno Stein.
Jetzt öffnet sich die Thür abermals und herein hinkt am Krückstock eine mit Schneeflocken übersäte, vermummte Gestalt, die vorn einen langen grauen Bart hat, welcher verdächtige Aehnlichkeit mit einem aufgedröselten Stück Segelgarn zeigt; auf dem Rücken trägt die Gestalt einen schweren Korb. Eine starke Stimme ersucht die jungen Herren um einige Augenblicke Ruhe, denn – der Weihnachtsmann ist erschienen.
Im Juli, als auch das zärtlichste Mutterherz noch nicht an Weihnacht dachte, sorgte bereits die „große Mutter“, die Admiralität, für ihre Zöglinge. Durch einen Schulofficier war den Eltern der auf der ostasiatischen Reise befindlichen Seekadetten die briefliche Anforderung zugegangen, etwaige Weihnachtsgeschenke für die Söhne und Brüder verpackt in feste Kistchen, in genau vorgeschriebener Form, binnen kürzester Frist an die Admiralität in Kiel einzusenden, welche die Beförderung, respektive rechtzeitige Auslieferung derselben übernehme. Auch an die Eltern des zur Zeit unglücklichsten Kadetten auf Seiner Majestät Schiff „Jason“ war ein solcher fürsorglicher Brief gelangt und – – „es ist der Weihnachtsmann aus Deutschland angekommen, welcher einige Päckchen hier lassen möchte, ehe er seinen Spaziergang um die Erde fortsetzt.“
Athemlose Stille, freudigbange Spannung. Bruno Stein heftet die glühenden Augen auf den Sprecher, dessen Stimme ihn merkwürdig an die des knurrigen Bootsmannes mahnt. Da faßt der Weihnachtsmann in seinen Korb und hält ein Päckchen hoch: „Bruno Stein!“
Wie der Gerufene das Kistchen aufreißt, wie er aufschreit beim Anblick der schönen Bilder von Vater und Mutter, wie er nach dem lechzend ersehnten Brief sucht, wie er liest und dann im Erlösungsrausch den ersten besten Kameraden umarmt – das ist ein Anblick für Götter. „Du, das gehört mit zur ‚ganzen Bescherung‘, die ich Dir abgewonnen habe,“ neckt ein Freund den Glücklichen. Bruno hört es kaum, er hält seine Schätze fest. Die übermüthigen Kameraden, die festlichen Säle, das herrliche Schiff, die ganze Welt: sie sind nur ein schwacher Abglanz von der Seligkeit in seiner Seele. O, an dieser zauberartigen Wirkung zeigt es sich wieder: der Menschheit Höchstes ist die Liebe!
In diese Stimmung hinein tönen plötzlich die wunderbar ergreifenden Klänge des Liedes „Deutschland, Deutschland über Alles.“ Das Musikcorps der Matrosendivision schickt das Lied in die stille Christnacht hinaus zur Ehre des Vaterlandes, und mehrere hundert frische Seemannskehlen fallen ein: „Ueber Alles in der Welt.“
Während der nun folgenden Abendtafel und der Weihnachtsbowle saß Bruno Stein und schrieb Bogen auf Bogen. Die „Jason“ hatte zur Zeit keinen glücklicheren Menschen an Bord und – auch keinen besseren.
Gesegnete Weihnacht!
Alle Rechte vorbehalten.
Der Unfried.
Die Wolken schienen an den finsteren Dächern und an den Wipfeln der halb schon entblätterten Bäume anzustreifen. Sie lagen so dicht und schwer, daß der Sturm, so heftig er auch tobte, sie kaum zu bewegen vermochte. In das Pfeifen und Rauschen des Windes mischte sich das Kreischen der rostigen Dachfahnen, das Klappern der losen Fensterläden, das Aechzen der Bäume und das Knarren ihrer Aeste. In wirbelnden Säulen fuhren die dürren Blätter über die Straße hin oder sammelten sich, wenn die Gewalt des Sturmes sich für eine kurze Weile schwächte, auf der Erde zu raschelndem Tanze. Dann fielen auch schwere Tropfen, doch immer versiegte der Regen wieder, sobald der Wind mit heftigen Stößen sein altes Treiben und Rauschen begann.
Langsamen Schrittes folgte Götz der dunklen Straße. Seine Joppe flatterte und die gezausten Haare peitschten ihm die Wangen. Er schien die scharfe Kälte nicht zu fühlen, die ihn umwehte. Fast vor jedem Hause blieb er stehen, als hätte er stummen Abschied nehmen mögen von jeder Thür, durch die er gegangen, von jedem Fenster, aus dem er in all den verwichenen Jahren so manchen freundlichen Gruß und manch ein trauliches Wort vernommen. Auf den Kirchhof trat er, wanderte durch die Reihen der Gräber und verhielt sich vor jedem Hügel, zu welchem vor Jahr und Tag seine eigene Hand eine Schaufel voll Erde geworfen. Nun stand er vor einem eisernen Gitter, das ein zimmergroßes Geviert umschloß. Es erhob sich in ihm nur ein einziger Hügel – das Grab der seligen Pointnerin – und das drückte sich hart in eine Ecke, um Raum zu lassen für die Kommenden.
„Da – da, hätt’ ich g’meint – da sollt’ ich auch amal mein Platzl finden! Aber jetzt – wo jetzt!“
Er fuhr sich über die Augen, dann faltete er die Hände und betete.
„B’hüt’ Dich Gott halt, Bäuerin!“ seufzte er auf, bekreuzte sich und verließ den Kirchhof.
Er wanderte durch das halbe Dorf zurück, erstieg den Kapellenberg und setzte sich auf jene Bank, auf welcher Sanni gesessen, als er ihr die Nachricht von der Ankunft ihres Vaters brachte.
Auf dieser Höhe hauste der mächtige Sturm in seiner ganzen Wildheit. Er pfiff und johlte um die Mauerecke der Kapelle und heulte durch die Luken des Glockenturmes. Er peitschte das letzte Laub von den Bäumen und schlug die dürren Zweige von ihren Aesten.
Götz fühlte, wie der gewaltige Stamm der Linde, an die er sich mit dem Rücken lehnte, bis ins Mark erzitterte. Rindenstücke und kleine Zweige rieselten über ihn nieder, und häufig sah er sich in eine völlige Wolke der wirbelnden dürren Blätter gehüllt.
Ein Schauer rüttelte seine Schultern. Seufzend erhob er sich. „Es is kein Bleiben net!“ murmelte er – und es hatte dieses Wort für ihn einen doppelten Sinn. Es galt dem Orte, an dem er sich befand, und schloß zugleich die Reihe der Gedanken, welche ihm hier durch Kopf und Herz gestürmt.
[832] Während er zum Dorfe niederstieg, ließ das Tosen des Windes nach. Er schaute in die finstere Höhe. Nun würde wohl auch die Schwere der Wolken zu ihrem Rechte kommen. Unwillkürlich fiel er in rascheren Gang.
Als er den Pointnerhof erreichte, sah er hinter keinem der Fenster mehr ein Licht. Freilich, es mochten ja Stunden vergangen sein, seit er das Haus verlassen. Schon wollte er sich dem Zaunthor nähern, als er ein leises, klirrendes Geräusch zu hören vermeinte. Seine Augen überhuschten die Giebelwand und blieben betroffen an einem Fenster haften. Dort schob sich ein dunkles Etwas über die Brüstung ins Freie, glitt auf die Erde nieder und huschte an der Mauer entlang – eine weibliche Gestalt – und Götz erkannte sie. An der Hausecke blieb sie wie lauschend stehen und verschwand dann in der Tiefe des finsteren Hofes – nach einer Richtung, aus welcher sich ein dünnes Hüsteln hatte vernehmen lassen. Und er kannte dieses Hüsteln.
„Also doch!“
Mit zitternden Händen klammerte sich Götz an die Stäbe des Zaunes. Er wußte nicht, weßhalb es ihn so eigen schmerzte, daß er nun dennoch Recht gehabt – mit seinem ersten Gedanken über Kuni und den „Bruder von irgendwo“.
Wenn Gregor wirklich ihr Bruder war, wozu dieses heimliche Stelldichein in der Nacht? Und wenn sich Bruder und Schwester schon Dinge zu sagen hätten, die kein fremdes Ohr erlauschen sollte – konnten diese Beiden dazu nicht eine andere Stunde finden? Weßhalb hatte Kuni das Knarren der Hausthür zu scheuen, weßhalb mußte sie mit so lautloser Vorsicht durch das Fenster steigen, wenn sie den Bruder suchte – und nicht ihren Liebhaber? Wie häßlich, ach, wie häßlich! Und wie sie das Heucheln verstanden hatte in all dieser Zeit! Und jetzt gerade mußte er hinter die abscheuliche Wahrheit kommen, jetzt gerade, wo es ihn so sehr gefreut hätte, wenn er besser von Kuni hätte denken dürfen – von ihr, die ihm heute vor allen Anderen zuerst die Hand geboten!
Er wollte sich zum Gehen wenden, doch brachte er keinen Fuß von der Stelle. Durfte er denn gehen? Durfte er schweigen? Wurde er nicht selbst zum Mitschuldigen dieser häßlichen Heimlichkeit, wenn er sie schweigend geschehen ließ? Noch war er ja ein Glied dieses Hauses, über dessen Ehre er aus Pflicht und Dankbarkeit zu wachen hatte. Nur daß es sie gerade war, sie, die ihm heute in dieser bitteren Stunde die gedrückte Seele erhoben und getröstet und seinem Herzen dadurch so eigen nahe getreten – daß sie es gerade war, über die er nun Zorn und Schimpf heraufbeschwören sollte! Aber durfte er in seinem rechtlichen Sinn ein unklares Empfinden über die klare Pflicht, durfte er die Freude einer Minute über die Wohlthat dieser elf vergangenen Jahre setzen?
„Nein! Ich därf’s net hingehen lassen! Und reden müßt’ ich, und wenn’s mein’ eigne Schwester wär’.“
An der Stelle, an welcher er stand, überstieg er den Zaun. Er streckte die Hand nach dem Fenster – und zog sie kopfschüttelnd wieder zurück. Trotz des lauten Windes hörte er aus der Kammer ein rasselndes Schnarchen.
„An guten Schlaf hast, Bauer, daß Dein Ehr’ verschlafst!“
Hastigen Schrittes lenkte er um die Mauer nach der Hinterseite des Hauses. Dort kletterte er über das Scheitholz, welches an der Wand hoch aufgeschichtet war, und pochte an ein Fenster des oberen Stockes.
Stotternde Worte und dumpfe Tritte ließen sich hören und das Fenster wurde aufgerissen.
„Wer is da?“
„Ich bin’s, Karli.“
„Du, Götz – Du! Ja um Gotteswillen, was is denn?
„Geh ’nunter, Karli – geh ’nunter, sag ich Dir, und weck’ Dein’ Vater auf!“
„Na – jetzt so ’was! Ja was hast denn auf amal?“
„Dein’ Vater weck’ – und frag ihn, wo sein’ Bäuerin is.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, sprang Götz zu Boden. „Jesus Maria – jetzt is gut!“ hörte er den Burschen noch stammeln, dann sah er sein Gesicht verschwinden, sah, daß das Fenster offen blieb, und vernahm nach einer Weile das matte Knirschen einer Thür.
Da schoß ihm ein heißes Blut in die Stirn. Hatte er auch wirklich recht gethan? Oder hätte er nicht wenigstens einen anderen, besseren Weg finden können, als gerade diesen, der zu offenem, peinlichem Hader führen mußte? Wenn er auf Kuni zugetreten wäre – wenn er gütlich mit ihr gesprochen hätte? Er hatte doch vor kurzen Stunden erst erfahren, wie sie bei all den verwerflichen Eigenheiten ihres verbildeten Charakters ein so empfängliches Herz in ihrem Busen trug. Vielleicht hätte sie auf seine Worte gehört – vielleicht hätte sie die Häßlichkeit ihres heimlichen Treibens eingesehen und hätte sich durch diese Einsicht zur Umkehr bewegen lassen! Aber freilich, vielleicht auch nicht! und dann wäre er mit einer Ausrede abgefertigt worden – und sie hätte ihre Heimlichkeit eben nur noch heimlicher weitergetrieben.
Jählings schrak er aus seinen Gedanken auf, und ein Schauer rann ihm über den Rücken. Er glaubte nicht an Gespenster – aber wenn es Gespenster gäbe, meinte er, so müßten sie wohl der unheimlichen Erscheinung gleichen, welche lautlos unter den finsteren Bäumen näher schlich – eine hagere, fast übermenschlich hohe Gestalt, die wie mit weißen Grabtüchern angethan erschien. Diese Tücher sah er im Winde flattern und hörte das Murmeln einer hohlen Stimme. Wer das auch sein mochte – sicher war es Einer, der im Bereich des Pointnerhofes nichts zu schaffen hatte, Einer, der nichts Gutes im Sinne haben mochte.
Hastigen Schrittes trat er auf den Schleicher zu, faßte ihn am Arm und frug: „Wer bist – was hast daherin zum schaffen in der Nacht?“
Nur einen keuchenden Laut erhielt er zur Antwort; doch bedurfte er einer solchen nicht mehr – er hatte den Bygotter bereits erkannt. Der staunende Schreck, der ihn darüber befiel, raubte ihm einen Augenblick die Fassung, und diesen Moment benützte der Andere, um den Arm loszureißen und mit langen Sprüngen durch die Bäume gegen die offene Wiese zu flüchten. Ueberstürzten Laufes folgte ihm Götz. Er sah ihn an der bergwärts steigenden Hecke gegen die Höhe fliehen, sah ihn hinter einer Wölbung des Bodens untertauchen; ein paarmal schimmerten ihm noch die weißen Tücher durch die Nacht entgegen; dann war der Fliehende im Dunkel verschwunden, und kein Laut, kein Zeichen mehr verrieth, welchen Weg er genommen. Eine Weile rannte Götz noch ziellos in die Finsterniß hinein, bis er endlich, hoch oben in der Wiese, schwer athmend einhielt.
Ohne große Gedankenmühe meinte er sich sagen zu können, was der Bygotter hier gesucht haben könnte. Und sicher war er nicht zum ersten Male hier gewesen. Irgendwo im Walde oder in den Bergen droben mochte er seinen Schlupfwinkel haben, den er nur zu nächtiger Zeit verlassen hatte, um den Aufenthalt seines Kindes zu erforschen.
Quer über die finstere Wiese schritt Götz der jenseitigen Hecke zu und folgte dann langsamen Ganges den thalwärts ziehenden Büschen, welche hart an der Rückwand des Gesindehauses endigten.
Nun hatte er den ebenen Grund erreicht, und er wollte schon die Hecke verlassen, als er betroffen die Schritte verhielt. Eine gedämpfte Stimme war an sein Ohr geschlagen. Seine Augen suchten die Richtung, aus welcher er die Stimme vernommen hatte, und da gewahrte er auf kaum zehn Schritte vor sich eine männliche Gestalt, welche an die fensterlose Rückwand des Gesindehauses gelehnt stand. Das konnte nur der „Bruder“ sein, und er meinte trotz des herrschenden Dunkels auch das Weib zu erkennen, das an Gregor’s Seite auf den zu Füßen der Mauer übereinandergeschichteten Brettern kauerte.
Die Beiden schwiegen jetzt, und Kuni hielt wie lauschend den Kopf erhoben.
„Ah na – es is nix zum hören als der Wind und ’s dürre Land in die Stauden,“ murmelte sie nach einer Weile. Dann seufzte sie auf und sprach in raschen, halblauten Worten weiter: „Und jetzt sag ich Dir’s zum letzten Mal – morgen in der Fruh gehst fort. Kannst Dich auch selber um an Ausred’ b’sinnen, damit Dein Fortgehn net so auffallt – Dir selber z’lieb!“
„Laß’ mich aus! Ich hab’ Dir’s schon g’sagt! Ich denk’ an kein’ Fortgehn net! Warum denn auch? Ich hab’ mein’ kommode Liegerstatt, mein g’sundes Essen – und um an Biergroschen
[833] Der Frieden.
Lächelnd wie der Sonne Licht
Ruht auf blühendem Gefilde,
So aus diesen Zügen spricht
Sanfte Güte, fromme Milde.
Gieb den Herzen Deinen Segen,
Jedem, welcher kämpfen muß
Auf verschlung’nen Lebenswegen;
Jedem, der da irrt und zagt,
Der umsonst den Himmel fragt,
Wann er ihm Erlösung sendet.
Möge Deine sanfte Hand
Leuchtend das Gewölke spalten,
Droht mit nächtigen Gewalten!
Hoch mag unser Lorber stehn,
Braust der Sturm des Krieges wieder;
Doch wo Deine Palmen wehn,
Rudolf v. Gottschall.
[834] manchmal, da brauch’ ich mich auch net z’sorgen – Du schwimmst ja jetzt im Geld.“
„Na, na, so sag’ mir nur g’rad das Eine – steigt denn gar net a Bißl a Scham in Dir auf? Aber freilich, Du därfst Dich ja stellen, wie D’ magst – mehr kannst ja dengerst nimmer z’wegen bringen, als was schon lang vermöcht hast: daß mir z’wider bist in d’ Seel’ ’nein. Aus’kennt hab’ ich mich schon lang in Dir! Hast mich ja schon die ganzen Jahr’ in Rosenheim g’schunden und aus’preßt bis aufs Blut – da brauch’ ich gar net an die alten Zeiten denken. Das Eine aber hätt’ ich dengerst net ’glaubt von Dir: daß den traurigen Muth hast und kannst Dich ’neinsetzen in das Haus, wo ich verheirath bin – und daß Du’s treiben kannst auf a solchene Weis’! G’wiß wahr – wie ich das schmarotzerische Tagdiebleben mit ang’sehn hab’, wo die ganze Zeit her g’führt hast, da hab’ ich Dich bloß anschauen dürfen, und es is mir g’wesen, als müßt’ ich ausspeien vor Dir!“
„Das muß ich schon sagen – Du redst amal sauber mit Dei’m Bruder!“ fiel Gregor lachend ein und legte dabei einen seltsam spöttischen Ton in sein letztes Wort.
„Bruder? Du bist mein Bruder net!“
„Geh’? Bist am End’ gar noch stolz da drauf? Freilich, so a noble Familli wie die Deinig’, das giebt’s gar net leicht. Da därf man schon suchen. Ja, ja, da hast schon Recht, daß gar so hochmüthig daherredst. Und schöne Sachen sagst mir hin! Aber no – ich bin a guter Kerl – ich trag’ Dir nix nach. Ich kenn’ Dich ja länger – ein andersmal wirst wieder anders reden. Und ’s Warten verdrießt mich net.“
„Du hast kein’ Zeit zum Warten nimmer! Die ganzen Tag’ her hab’ ich Dir’s schon sagen wollen – und allweil hab’ ich’s g’schoben, weil ich Dein Reden g’forchten hab! Du selber aber hast mir d’ Furcht aus ’m Herzen ’trieben! Heut’ Abend hast Dein Maß zum überlaufen ’bracht – durch Dein’ heimtückische Bosheit, mit der an Menschen elend g’macht hast, der Dir seiner Lebtag nie nix ’than hat.“
„Nix ’than? So?“ brauste Gregor mit rohen Worten auf. „G’nug hat er mir ’than! Scheniert hat er mich, mit seine g’schaftigen Augen. Und Luft hab’ ich schaffen müssen!“
„Luft? Für wen? Denn Du, Gori, Du gehst allein – der Götz aber bleibt!“
„Jetzt da schau her! Weßwegen nimmst Dich denn gar so an um ihn? Machst mich ja völlig neugierig, was er Dir is!“
„Z’lieb is er mir, als daß ich von ihm noch länger red’ mit Dir! Und ’leicht – ’leicht is er mir mehr, als Du Dir denken kannst.“
„Ja Narr – ja Narr!“ scholl es mit häßlichem Lachen in Wind und Nacht hinaus. „Da hast Recht – auf so ’was hätt’ ich nie net ’denkt! Ausschauen thut er freilich net darnach, der alte Pharisäer!“
„Gori!“
„Was schreist denn so – daß man Dich drei Häuser weit hören muß?“ zischelte der Bursche, während er unwillkürlich vor Kuni zurückwich, welche so dicht vor ihm stand, daß er durch die Dunkelheit ihre Augen funkeln sah.
„Mag man mich hören – meintwegen! Und Dir – Dir sag’ ich jetzt was! Jetzt bleibst mir auch kein’ einzige Nacht nimmer da! Und auf der Stell’ kannst gehn – denn Du – Du thust mir kein Schritt nimmer ’nein ins Haus!“
„Was? ’s Haus willst mir verbieten? Du? Ah geh! Da müßt’ ich schon z’erst a Wörtl reden –“
„Red’! Red’! Jetzt is mir schon alles eins! Ja – die ganzen Tag’ her – da hab’ ich mich g’forchten Stund’ um Stund’ – vor Dir und vor allem, was ’leicht in Deiner Bosheit reden könntst. Jetzt aber – jetzt is mir d’ Furcht vergangen!“
„Geh! Seit wann denn?“
„Seit wann? Seit ich wen hab’, an den ich mich anhalten kann, der mir a Trost sein wird und a Hilf’ –“
„Ah so – Dein’ Götz, Dein’ lieben! Da hätt’ ich jetzt schier vergessen –“
Jählings verstummte Gregor. Er hatte kein verdächtiges Geräusch und keinen Schritt vernommen; er sah nur plötzlich, daß sie zu Dreien waren.
Da fühlte er auch schon eine Faust an seiner Brust, spürte den Hauch eines heißen Athems in seinem Gesichte und hörte eine in Zorn und Erregung keuchende Stimme: „Du – Du so a Red’ thust Du a zweits Mal nimmer!“
Einen Augenblick stand Kuni wie gelähmt. Dann aber fuhr sie mit schluchzenden Lauten auf, packte Götz am Arme und riß ihn von Gregor zurück. „Na – net – net anrühren thu’ ihn! Der is Dein’ Hand net werth! Mich laß reden mit ihm – mich! Aber net in Zorn und Haß will ich reden – na – in Güt’ und Dankbarkeit. Denn was er mit seiner heutigen Schlechtigkeit auch vermeint hat – mir hat er an G’fallen ’than damit, wie mir unser Herrgott selber an größern net hätt’ erweisen können. Denn was er mir auch g’nommen hat – mein Kinderglück, mein’ Ruh’ in die letzten Jahr’, an jeden Kreuzer, den ich mir verdient hab’, und mein Glauben an d’ Menschen – heut’ hat er mir ’was ’geben, was Alles wett macht. Ja, Gori – heut’ hast mir wiedergeben, was ich g’meint hab’, ich hätt’s mit meiner Mutter ins Grab ’neing’legt – mein Herz, mein Leben und Lieben – – mein’ Vater hast mir geben!“
„Was – was is jetzt das für a Reden?“ stotterte Gregor
„Z’gut g’wesen is mir das Wort, als daß ich’s vor Dir auf mein’ Zung’ hätt’ nehmen mögen. Jetzt aber magst es wissen – mein Vater is er, der Götz – mein Vater!“
Lautlose Stille folgte; nur der Wind war noch zu hören, der um die finsteren Mauern des Hauses fuhr und raschelnd durch die schwarzen Büsche zog.
„Ah, da legst Dich nieder! Was man heut’ net Alles erfahrt! Ja g’rad schauen thu’ ich!“ brach Gregor mit heiserem Lachen das Schweigen.
Durch dieses Lachen wurde Götz aus seiner Betäubung aufgerüttelt. „Kuni – Kuni!“ schrie er in die Nacht hinein, und fast wie zornige Härte klang es aus dem Ton dieses Namens.
„Gelt – magst es schier selber net glauben,“ schluchzte sie, während sie mit zitternden Händen an seinem Arm hing. „Und ich weiß auch warum! Ich – ich kann ja z’frieden sein – ich find’ an Vater, der mein’ Achtung werth is und mein’ Lieb’! Aber Du – – der liebe Herrgott soll mir’s verzeihen, daß ich Dir kein anders Kind net geben kann, als wie ich eins bin. Aber wann net glauben kannst, so sag’ g’rad eins noch – sag’ mir, wie das Deandl g’heißen hat, von dem uns heut’ verzählt hast.“
„Lenei hat ’s g’heißen – Lenei Brandtner.“
„Und Brandtner Magdalen’ hat mein’ Mutter g’heißen und“ – da verstummte sie, richtete die Augen auf Gregor und fuhr ihn nach kurzem Schweigen mit schrillenden Worten an: „Du – was willst denn Du noch da.“
„Ah ja – hast Recht,“ erwiederte Gregor mit galligem Lachen. „Da wird’s jetzt weiters kein’ Flennerei absetzen! Und von so ’was bin ich noch nie kein Freund net g’wesen!“ Er grub die Hände in die Taschen und wandte sich zum Gehen. Ueber die Schultern spottete er noch in widerlicher Weise zurück: „Da gratulier’ ich halt derweil! Und schier was einbilden thu’ ich mir d’rauf, wie ich zwei zu einander ’bracht hab’, wie ’s die Katzen hätten net schöner z’sammtragen können. Und daß mir fein Dein’ Vater recht gut betten thust, er is ja gar so lang auf der harten Pritschen g’legen – schau – und da räum’ ich Dir gleich mein Stüberl ein! Im Wirthshaus bin ich auch net schlecht versorgt – d’ Walli wird mir schon a Platzl wissen – ich – versteh’ mich ja auf’s Reden mit die Kellnerinnen – so oder so! Und wer weiß, leicht find’ ich drüben auch noch a G’sellschaft, die sich net ungern ’was verzählen laßt – es is nur g’rad, daß d’ Leut’ morgen in aller Fruh dem Pointner a richtigs Glück anwünschen können! Na, wie’s der Bauer jetzt ’troffen hat – jetzt braucht er seine Weiberleut’ gar nimmer mit ’m Spinnen plagen – sein Schwiegervater versteht’s ja besser!“ Mit diesen Worten bog er um die Ecke; man hörte noch sein häßliches Lachen und dann verhallte sein Schritt im Winde.
Unsere projektirte Ferienreise nach Hause muß einen Aufschub erleiden, liebste Marie, Ihr braucht morgen noch keine Kränze zu winden! Hugo, der sich schon seit ein paar Tagen unwohl fühlt, hat heute eine tüchtige Halsentzündung. Schonen will er sich natürlich nicht, aber daß er so nicht reisen kann, das sieht er doch ein. Ich habe eben Mama abgeschrieben; indessen hoffen wir doch, in einigen Tagen fortzukommen; wir müssen es eigentlich, denn Rike ging am Ersten und statt ihrer ist nur eine Aushilfe da. Bis zu unserer Rückkehr im August kommt dann ein neues Mädchen von weniger stürmischem Temperament, die sich hoffentlich vor dem großen Ereigniß im Herbst noch gut eingewöhnen wird.
Ach, wenn wir doch Samstag fort könnten! Sehr in EileO Marie, Marie! In Verzweiflung schreibe ich Dir heute. Hugo ist schwer krank, es ist die Diphtheritis und, wie mir der Arzt heute sagte, „kein leichter Fall!“ Ich bin innerlich fassungslos, wenn ich mich auch vor Hugo so viel als möglich zusammennehme. Er wird es vielleicht bald nicht mehr beachten; das Fieber ist so stark, die Noth in dem armen gequälten Hals so schrecklich! Sag’s der Mama schonend, ich schreibe morgen mit dem Frühesten wieder.
Das Fieber steigt noch immer, der Doktor schüttelt den Kopf, wenn er das Thermometer betrachtet. Wir wenden jedes mögliche Mittel an, aber keins bringt ihm Linderung. Sorgt nicht um mich, Hugo’s Mutter ist bei mir.
Er lebt noch, aber unter welchen Leiden! Was bevorsteht – ich weiß es nicht. Der Arzt will mich offenbar schonen und spricht sich deßhalb nicht aus. O, nur mitsterben können, wenn er stirbt – alles Andere wäre Verzweiflung! Aber nein, nein, nicht einmal denken kann ich das! O Marie, ich leide fürchterlich …
Es soll Niemand kommen, Niemand! Es ist mir eine Erleichterung, daß Papa die Mama nicht fortläßt, ich kenne ihre Scheu vor Ansteckung. Und – es muß bald entschieden sein, das ist unser trauriger Trost! …
Heute Morgen nur 38,5 Grad. Hals etwas freier, Arzt giebt Hoffnung. Brief unterwegs.
Meine theure Marie!
Endlich, endlich finde ich die Möglichkeit, den Brief zu schreiben, den Du Gute, Treue so lange schon haben solltest. Aber erst die schwere Sorge um Hugo, dann nach seiner Genesung die Uebersiedelung hierher: Alles das ließ mich zu keiner Ruhe kommen, heute aber, im Schatten eines allerliebsten Landhauses unter hohen Bäumen sitzend und dem Geläut der Sonntagsglocken ringsum horchend, fühle ich mich wie in einem neugeschenkten Leben, so tief glücklich und so innig dankbar. Dort unter den Kastanien in einer Hängematte ruht Hugo; er sieht noch ein Bischen blaß aus; aber er betrachtet sich bereits die Bergspitzen, die über den Garten hereinschauen, und spricht von baldigem Besteigen. Neben ihm sitzt seine Mutter, seine gute, großdenkende Mutter, und ich, Marie – ich sehe die Beiden an und freue mich innig ihres frohen Aussehens. Auf meine Bitte hat uns die Mutter hierher begleitet – aber ich muß etwas weiter ausholen, um Dir das zu erklären; sonst kannst Du es ja nicht verstehen!
Wie wir früher standen, weißt Du. Vollends nach jener Kolotschine-Geschichte zog ich mich sehr zurück; ich konnte es ihr nicht vergessen, daß sie mich wie ein Schulmädchen behandelt hatte, ging immer seltener hin. Natürlich kam sie auch wenig genug zu mir, und Hugo gab am Ende seine Bemühungen auf und besuchte die Mutter allein. Auch an jenem schrecklichen 14., als plötzlich das Fieber und die Halsschmerzen so stark wurden, daß ich mitten in der Nacht den Arzt holen ließ und mir dann mährend des Einpinselns und Eisumschlägemachens voll Angst überlegte, was nun werden solle in der öden Wohnung mit einer einfältigen Bauernmagd als einziger Hilfe – auch da kam mir kein Gedanke, nach der Schwiegermutter zu schicken.
Aber am andern Morgen, als ich müde und überwacht ein paar Augenblicke ausruhte, da stand auf einmal die alte Frau neben dem im Fieber glühenden Hugo. Er sah sie mit einem mühsamen Lächeln an und versuchte zu sprechen. Aber es gab nur ein heiseres Geflüster und sie winkte ihm dringend, zu schweigen. Während ich den Inhalationsapparat richtete, verschwand sie geräuschlos; als ich aber nach zehn Minuten rasch in die Küche lief, fand ich sie, eine große Schürze umgebunden, am Herd und im Begriff, der ungeschickten Lisbeth bei Bereitung der Kraftbrühe für Hugo zu helfen.
„Ich bleibe nun hier,“ sagte sie, als das Mädchen nach der Apotheke fortlief, „aber Du brauchst nicht zu erschrecken, Emmy, ich will weiter nichts, als Dir die Arbeit abnehmen, welche Dich verhindern würde, stets um Hugo zu sein. Du bist seine Frau und hast das ausschließliche Recht auf seine Pflege. Aber Dein Zustand erfordert Hilfe und die, welche Du hast, ist gar zu schlecht. Heute Nachmittag hole ich Lene her, und wir Beide Übernehmen dann das Hauswesen. Es kann nicht anders sein,“ fuhr sie wie entschuldigend fort, „ich meiß, daß Dir meine Gegenwart nicht angenehm ist, aber“ – hier brach ihr Schmerz erschütternd heraus, „es handelt sich ja um Hugo, um meinen Letzten, Einzigen! Wir wollen allein an ihn denken, nicht an uns Beide; willst Du das, Emmy?“
Sie streckte mir ihre Hände hin, ich legte die meine hinein. „Und die Ansteckung?“ hielt ich mich doch verpflichtet zu fragen, „fürchtest Du sie nicht?“
„Ich fürchte nur noch Eines,“ erwiederte sie. „Alles Andere ist daneben gleichgültig.“
Und von der Stunde an, liebe Marie, war es mir, als sei das eine ganz andere Frau, die ich jetzt kennen und lieben lernte. Es kamen die schlimmsten Tage und Nächte, wo ich furchtbar verlassen gewesen wäre, weil Alle das Haus mieden, aus Scheu vor der Ansteckung. Aber an meiner Seite stand fest und ruhig, Alles bedenkend und besorgend, stets mit Rath und That bei der Hand die seltene, edle Frau, die ich heute aus tiefstem, dankbarem Herzen über Alles liebe und verehre. Sie band sich an ihren Vorsatz, nicht die erste Stelle einnehmen zu wollen; ich sah sie mehr als einmal Magddienste thun, wenn Lene ausgegangen war, damit ich ruhig bei Hugo bleiben konnte. Und dabei – ich möchte ihr heute noch auf den Knieen dafür danken – verschmähte sie die Gelegenheit, mich zu demüthigen, die eine kleine Natur sicher benutzt hätte, gönnte sich nicht den Triumph, von mir auch bei Hugo zu Hilfe gebeten zu werden, sondern ging freundlich ab und zu und stand Abends, wenn ich die Nacht vorher bei ihm gewacht hatte, ungerufen an seinem Bett, mir zu sagen: „Lege Dich etwas, Emmy; ich wecke Dich auf, sobald Hugo Etwas bedarf.“
Dann saß sie, während ich von Erschöpfung schlief, die ganze Nacht wachsam und besorgt bei ihm und weckte mich nicht, und wenn ich mich Morgens beklagte, sagte sie freundlich: „Du bist es uns Beiden schuldig, mein Kind, Dich jetzt zu schonen. Alte Augen wachen leichter als junge!“
So schmolz, ehe ich recht wußte, wie, mein altes häßliches Gefühl gegen sie völlig dahin; erst war ich ihr nur dankbar; dann fing ich an, sie aufrichtig und von Herzen zu lieben, nur konnte ich es nicht recht fertig bringen, ihr das zu sagen und fühlte doch, daß ich es sollte und müßte.
Als es nun mit Hugo ganz entschieden besser ging und wir aus seiner unglaublichen Krittelhaftigkeit die besten Hoffnungen schöpften (obgleich dieses Stadium ganz anders ist als in den Romanen, wo man sich um den Hals fällt und schluchzt: Gerettet!), da saß ich eines Nachmittags, vom vielen Hin- und Herlaufen erschöpft, im großen Fauteuil im Eßzimmer und war offenbar in der kühlen Stille sanft und süß eingeschlafen. Denn ich hörte nichts von den Eintretenden, bis mich ihre gedämpften Stimmen wieder zum Bewußtsein brachten. Es waren meine Schwiegermutter und der Doktor, welche aus dem Schlafzimmer kamen und an der Thür auf dem Gang plaudernd stehen blieben. Ich war zu faul zum Aufstehen, behielt also die Augen geschlossen, als ob ich weiter schliefe.
„Sehen Sie nur," hörte ich sie sagen, „wie rührend hübsch das junge Geschöpfchen da im Lehnstuhl sitzt, die Hände über dem Hausschürzchen zusammengelegt. Wenn sie so schläft, tritt doch die reine Kinderseele auf ihr Gesicht, ich habe mich schon oft daran erfreut, sie zu betrachten.“
„Man kann Ihnen zu der Schwiegertochter gratuliren,“ sagte der Doktor höflich.
„Das kann man in der That,“ erwiederte sie mit Lebhaftigkeit, „Emmy ist eine prächtige Natur, wahrhaftig, gut und warm, mein Sohn ist glücklich, sie zu besitzen, und ich bin es für ihn. Ich gestehe ehrlich, daß ich früher anders dachte; es fehlte mir die richtige Art, sie zu behandeln, und deßhalb trug ich wohl die Hauptschuld an der zwischen uns herrschenden Kühle. Aber nun ist es anders geworden; ich kenne sie jetzt und habe sie von Herzen lieb gewonnen, die kleine Frau!“
Sie waren unter diesen Worten zur Thür hinausgegangen; ich aber sprang auf meine Füße, und als sie allein wieder hereinkam, fiel ich ihr um den Hals und rief: „Ich habe Dich auch von ganzem Herzen lieb, Du gute, gute Mutter, aber Du hast keine Schuld, ich allein – und ich bitte Dich um Ver…“ Da schloß sie mir mit einem Kusse den Mund und sagte: „Still, still, davon darf gar nicht mehr die Rede sein!“
Tags darauf saßen wir zum ersten Mal mit Hugo nachmittags im Hausgärtchen. Er sah uns mit sehr vergnügten Blicken an, aber sonst war Alles unerträglich. die Mücken, der unbequeme Lehnsessel, das Halstuch, welches ich niemals lernen würde, richtig zu knüpfen, und vor Allem der niederträchtige Krautgarten um uns her. Wir ließen ihm sein RekonvalescentenvergnÜgen, nur als er ganz elegisch seufzte: „Ja, wenn man wenigstens nach Reichenhall könnte!“ da sagte die Mutter ruhig: „Das könnt Ihr ja,“ und ich fügte hinzu: „Das können wir, willst Du sagen, liebe Mutter!“
Ach Marie, wenn ich denke, wie viele Menschen sich mit Antipathien das Leben verbittern, die keinen besseren Grund haben, als diese meine so vollständig überwundene, da dauert mich Jeder, der den häßlichen Ballast nicht aus seinem Herzen wirft!
Und nun sitzen wir in Reichenhall, sehen alle Morgen die Bergherrlichkeit um uns her und genießen die Tage und Wochen. Nicht mehr allzuviel der letzteren und ein ernstes Ziel naht heran, an das ich in der Aufregung der letzten Zeiten kaum je dachte. Aber nun – wie wird es werden? Ist die schwermüthige Weichheit, die oft über mich kommt, der Vorbote, daß vielleicht diesen Herbst schon die Astern auf meinem Hügel stehen?? … Manchmal kommen mir die Thränen bei diesem Gedanken, aber dann sucht mich Hugo zu ermuntern durch die Frage, ob wir unseren Sohn Hans, Kunz, Klaus oder Peter nennen wollen!
Jetzt wird er ungeduldig in seiner Hängematte. Leb wohl, mein liebes Herz! Deine Emmy.
Meinst Du nicht, Sigfried wäre auch sehr hübsch? Oder Tristan? Lohengrin kommt mir doch ein Bischen romantisch vor! …
[836]
Das große Fest der Liebe.
Schneeflocken! Helle Lichter! Eilende Menschen! Rasch dahinfliegende Wagen! Boten, betreßte Diener, nebenbei trippelnde, schritthaltende Kinder, beladene Mütterchen, Herren und Damen, Schlitten mit Klingklang! Erleuchtete Fensterscheiben, geöffnete Thüren. Geschäftiges Leben, wohin man blickt! In jedem Haus eine Vorbereitung zum Allerheiligsten der kommenden Tage.
Stille, glückliche Mienen in der Vorfreude des Gebens und Nehmens. Weichere Herzen, gefügigere Hände, leichteres Arbeiten, frühere Morgen-, spätere Abendstunden! Fleißige Nadeln, rasches Verstecken, Kinderjauchzen und heimliches Flüstern! Zu Bett! Zu Bett! Morgen ist Weihnachtsabend! Ein Zauberwort für menschliche Herzen, für Große und Kleine!
| * | * | |||
| * |
Schnee, Schnee, Schnee, der zu Eis wird, sobald er sich herabsenkt. Wie sonst auf einer warmen Erde die Flocke wie eine Thräne zerrinnt, so erstarrt sie heute zu einem festen Gebilde! Als ob Millionen lebendige, angsterfüllte Geschöpfe aus dem Himmelsgewölbe, von einer dämonischen Gewalt gepackt, hinabjagten, so erscheint’s dem Führer, der auf der Maschine steht und gerade heute seinen Dienst versehen muß. Das schnaubende, wilde, rothlaternige Ungeheuer, die Lokomotive, stürzt sich über die Schienen, trotz Nacht und Einsamkeit, um ihr Pensum auszukeuchen. Und wie alles Diabolische, bläst sie ihren stinkenden Athem aus dem hochemporgerichteten, gleichsam das Unglück witternden Rachen und schleudert die Kohlenatome und den Dampf, aus denen sie ihre Kräfte entwickelt: Reste vergangener Pflanzenwelten und Wasser über die schneedurchflockte, sturmdurchwühlte Gegend.
Und fort, fort durch die Landschaft, durch den Schneewirbel, gegen das Eis, das von den Schaufelmessern der Lokomotive gefaßt und zerstäubt wird. Vorbei an Dörfern, Flecken und Städten mit ihren glitzernden Lichtern, vorbei an den hellerleuchteten Gebäuden und Palästen, vorüber an weißstarrenden Feldern, Aeckern und Wiesen, vorüber an silberumhüllten Tannenwäldern – –
Ah! Tannenwälder! Nun zuckt es durch des Mannes Brust. Daheim sitzt die Familie ohne ihn und harrt auch seiner nicht. – Der Weihnachtsbaum ist angezündet und flimmert mit seinen stillen, sanften Lichtern. Und die Frau und die Kinder umstehen den kleinen Tisch, und auch in ihre Herzen dringt die Freude; aber es ist doch nur eine halbe Freude! Er fehlt mit seinem zärtlichen Auge und den kräftigen Armen, mit denen er die kleine Schar emporzuheben pflegt. Sie Alle müssen ihn entbehren, gerade heute entbehren, wo Jeder ein Anrecht hat auf Zusammensein und unbekümmertes Genießen.
Aber sie haben doch ein schützendes Dach über sich und dürfen der Ruhe pflegen. Jenen aber ruft die eiserne Pflicht. Gerade in dem Augenblicke, in welchem sie sich in die warmen Betten verkriechen, ertönt abermals der schrille, unheimliche Pfiff der Lokomotive als Antwort auf das Zeichen zur Abfahrt. Und durch Kälte, Heulen und Sturm geht’s von Neuem durch die dunkle Nacht – fort bis an den frühen Morgen.
| * | * | |||
| * |
In einem kleinen, kahlen Stübchen ohne Gardinen sitzen eine Frau und ein Mann. Im Bett liegt ein schmales, hohläugiges Geschöpf, – ihr letztes am Leben gebliebenes Kind von vieren. Krankheit und Armuth! Zwei furchtbare Worte!
Die Frau versieht in einem großen Hause Portierdienste. Sie arbeitet den ganzen Tag und scheuert in dem eisigen Zuge Abends die Treppen. Schwer ist’s und doppelt anstrengend, weil sie schon seit Wochen an Reißen in den Zähnen leidet. Alles half nichts. Ein Arzt? Es fehlt die Zeit und das Geld. Er trägt die Hand in einer Binde. Die Maschine hat ihn gepackt und ein paar Finger zermalmt. Das kleine Mädchen hustet schrecklich hohl. Etwas Warmes, Nahrung! Nahrung? Brot und Kartoffeln, dazu ein schwacher Kaffee. Weihnachtsabend! Ob’s was bringen wird? Werden die Vielen, die in dem großen Hause wohnen, an uns denken? Ja, heute denken sie der Armen, Elenden, Bedrückten.
Immer von Neuem öffnet sich die Thür. Feuerung ist draußen. Hier Kleider, warme Socken, ein Braten, Kuchen, Wein! Für die Kranke eine wollene Decke, ein kleiner Schmuckgegenstand. Blumen, duftende, in der Winterzeit! Und Geld! Geld! Die Aussicht, in den nächsten Wochen nicht zu darben! – – –
Große Gegensätze: ein unbefangenes Kind sein, des Daseins Härte bei Anderen mitten im eigenen Wohlleben zu empfinden oder in Pflichttreue sich zu opfern, der Gefahr ausgesetzt und in der Fremde abgelöst zu sein von Allem, was der Mensch lieb hat!
Aber die Macht dieses Festes ist eine wunderbare! Wir werden fast Alle wieder zu Kindern durch unsere Freude, unsere Hoffnungen und Erinnerungen. Und wir gucken Alle durch das Schlüsselloch und schauen, was das neue Jahr uns bringen wird. Wir hegen Alle Hoffnungen auf bessere Tage, wie die armen Leute in der Dachstube, und wir zehren an der Vergangenheit und trösten uns in der Hoffnung auf Wiederkehr guter Zeiten.
Das Weihnachtsfest reinigt unsere Herzen. Wir tauchen in ein heiliges Bad und erheben uns daraus mit einer von Menschenliebe erfüllten Brust.
Wer würde nicht der Armen gedenken, nicht Streit und Unfrieden vergessen, nicht Freude und Glück fördern in seinem Kreise an diesem Fest? Und es ist auch ein Blumengarten, durch den wir wandeln, um in eine neue Welt zu treten. Die neue Welt ist das neue Jahr. Freilich, willkürlich haben wir uns selbst die Grenzen gezogen, aber unsere Vorstellung ist überhaupt unser freudevolles oder trostloses Dasein. Und ein freudenloses Dasein hat niemals ein Mensch, der sich nicht allein sieht in der Welt, der lebt, indem er auch für Andere denkt und schafft, der Liebe übt und empfängt.
Weihnacht ist das Fest der Liebe! Liebet Euch unter einander! Haltet fest an Dreierlei: bleibet Kinder im frohen Genießen, thut Eure Pflicht, arbeitet, hoffet, und sorget nicht allzuviel und allzuweit. Und wenn das Herz krank ist – gedenket der guten Tage und verzaget nicht! Nach dunkler Nacht und Wogendrang erscheint wieder die Sonne am blauen Himmelsgewölbe, umfluthet die ganze Welt mit ihren milden, warmen Strahlen und senkt auch in Eure Herzen wieder goldenes Licht!
Freuet Euch des fröhlichen Festes, glaubet, trotz Entbehrung und Unglück um Euch her – „an gute Tage im – neuen Jahr!“
[837]
Weihnacht.
Kein Windhauch draußen, regungslos die Luft,
O wunderbarer herber Winterduft!
Es schneit, es schneit! Ein stumm’ Gewimmel
Schwebt Flock’ und Flöckchen von dem grauen Himmel
Verschneit die Tannen draußen in dem Walde,
Ruht leuchtend weiß auf jedem Thurm und Dach
Und scheint so helle in mein still Gemach,
Daß ich die Feder gerne ruhen lasse
So einsam dort; ’s ist Alles in den Stuben,
Nicht mal den Schlitten ziehn des Nachbars Buben;
Warum dies nur, da es sie sonst so freut? –
Ei, weißt du nicht? Es ist ja Weihnacht heut!
Wohl übers Dörfchen in das Land hinein,
Und in der Brust wird es mir plötzlich enge
Und in die Augen tritt ein feuchter Schein.
O heilige Nacht, du süße fromme Nacht,
In jedes Haus weht dein geheiligt Schauern!
Und wär’ ein Herze noch so voller Trauern,
Es muß ihm doch die holde Kunde werden:
Verzage nicht, der Friede kam zur Erden!
So strahlend hell, so festlich eigen;
Von frischen Kinderstimmen tönt ein Chor
Herüber in mein andachtsvolles Schweigen:
Das alte Lied – die frohe Mär –
Wohin du siehst, der helle klare Schein,
Und so wie hier in unserm Dörfchen klein
Flammt jetzt im großen weiten Erdenraum
In jedem Haus der grüne Tannenbaum;
Und jeder Arme dünkt sich wonnereich,
Und jede Hand, sie schenkt und reicht und giebt.
– – – – – – – – – –
* * *
Was steht dort draußen an der Thür betrübt
Und schaut so bang zum hellen Fensterlein?
Hast keine Mutter mehr? Hast keinen Baum?
Daß heil’ger Abend ist, Du weißt es kaum?
Tritt ein, denn heute soll zu Himmelshöhen
Doch kein bekümmert Aug’ vergeblich flehen,
Es ist ja Euer Fest, das Fest der Kleinen. –
Da, nimm nur hin, viel ist es freilich nicht,
Und freue Dich daran, Du blonder Wicht.
O Kinderhand, wie bald bist du gefüllt!
Was jetzt aus blauen Aeuglein blinkt,
Ist süße Lust, die tief zum Herzen dringt.
Nun geh, mein Kind, und siehst Du noch so einen
Vergeß’nen kleinen Buben weinen –
Das zur Bescherung Niemand ließ herein –
Sag’ ihnen rasch, ich wohnte an der Ecke
Und hätte eine große Zuckerwecke,
Und auch ein Bäumchen und ein warmes Kleid –
W. Heimburg.
Weihnachtsbüchertisch für die Jugend.
Erst kürzlich haben wir in dem Artikel „Was sollen unsere Kinder lesen?“ („Gartenlaube“, S. 763) Winke für die richtige Wahl des Lesestoffes unserer Jugend zu geben versucht. Heute wollen wir im Anschluß an jenen Artikel eine Relhe guter Jugendschriften namhaft machen. Des begrenzten Raumes wegen müssen wir uns freilich auf diejenigen Bücher beschränken, welche neu erschienen sind, doch ist auch gerade hier ein zuverlässiger Führer am nothwendigsten. Die guten älteren Schriften, welche wir zum Theil auch in früheren Jahrgängen unseres Blattes empfohlen haben, wird man über den neuen sicher nicht vergessen!
Die Kleinsten können sich freuen! Sie sind ungewöhnlich reich bedacht, und einige der für sie bestimmten Bilder- und Geschichtenbücher sind ganz vorzüglich. Eines der besten Bilderbücher trägt den einladenden Titel „Mach’ mich auf!“ (Eßlingen, J. F. Schreiber.) Die Bilder lassen nichts zu wünschen übrig; sie sind klar und schön bis in alle Details und bieten sorgsamen Müttern zugleich vortrefflichen Stoff für leicht zu ersinnende kleine Geschichten. Auch das lustige Ziehbilderbuch „Hansel und Gretel“ von Lothar Meggendorfer (ebenda) ist ein gutes Unterhaltungsmittel für die Kleinen. Die größte Freude aber wird desselben Verfassers „Internationaler Cirkus“ (ebenda) hervorrufen. Das Bilderwerk läßt sich kreisförmig auf dem Tische aufstellen und zeigt dann das bunte Innere eines Cirkus mit allem phantastischen Aufputz, mit Künstlern und Zuschauern. Herr Funkulo führt auf ungesatteltem Pferde den „Flammensprung“ aus, Miß Ella reitet „die hohe Schule“, der „Courier des Sultans“ führt dem Publikum vier prachtvolle Schimmel vor. „August der Dumme“ producirt sich in ergötzlicher Weise auf einem Esel etc. Der Humor, welcher den Schöpfer dieses Buches beseelt hat, ist echt: er steckt an. Ebenfalls humoristisch ist „Der Thierstruwwelpeter“ (Breslau, C. T. Wiskott) von Julius Lohmeyer und Fedor Flinzer, den bekannten Freunden unserer Kleinen, welche diesen erst im vorigen Jahre den „König Nobel“ schenkten, ein Bilderwerk, das zu den allerbesten gehört. Der Thierstruwwelpeter ist dem vielbefehdeten Hofmann’schen Struwwelpeter nicht ähnlich; die Bilder und Verse wirken komisch, sind aber von künstlerischem und poetischem Werthe.
Wilhelm Hey’s sinnige, altbekannte „Fabeln für Kinder“ werden von dem Verleger F. A. Perthes in Gotha in Prachtausgabe herausgegeben. Uns liegt das erste Heft vor, welches zwölf Fabeln mit eben so vielen großen Farbendruckbildern nach den Zeichnungen Otto Speckter’s enthält. Die Hey’schen Fabeln sind noch immer unübertroffen; die geschmackvolle künstlerische Ausstattung der Prachtausgabe ist ihrem Werthe angemessen. – Alte Reime mit neuen Bildern enthält Wilhelm Claudius’ „Kinderlust“ (Dresden, C. C. Meinhold und Söhne), ein solid ausgestattetes Buch mit 32 Farbendruckbildern, deren Zeichnung und Ausführung größtes Lob verdienen. Die Verse sind meist ernsten Inhalts. – Mit seinem Kindertagebuch „Mein Vaterhaus“ (Leipzig, Meißner und Buch) erinnert Julius Lohmeyer an den alten Erzähler Friedrich Jakobs, dessen gemüthvolle Erzählungen durch ihre vor wenigen Jahren erfolgte Aufnahme in die bekannte „Universalbibliothek für die Jugend“ neue Verbreitung gefunden haben. Das hübsche Buch führt Scenen aus dem Leben im Elternhause vor und ist von Julius Kleinmichel ansprechend illustrirt.
Von Büchern für die Kleinen, in welchen das Hauptgewicht auf die Erzählungen gelegt ist, nennen wir: „Hundert Erzählungen aus der Kinderwelt“ von Lina Morgenstern (Stuttgart, K. Thienemann’s Verlag), eine Sammlung sehr anziehend erzählter einfacher Geschichten; „Ist’s wahr?“ Märchen von Maria Rebe und „Die gute Schwester Anna“ von E. Wuttke-Biller (Gotha, F. A. Perthes). Alle drei Werke sind in erster Reihe dazu bestimmt, Müttern Anregung und Stoff zum Vorlesen und Nacherzählen zu geben.
Eine treffliche Gabe für jedes Jugendalter ist Emil Rumpf’s „Instruktionsbuch für Infanteristen“ (Stuttgart, Karl Krabbe), eine faßliche Anleitung für Kinder zum Soldatenspiel. Der Herausgeber macht das Kind mit Allem bekannt, was zur Ausrüstung eines vollkommenen kleinen Soldaten gehört, nimmt dabei aber gleichzeitig auf die Geldtasche der Eltern Rücksicht und wählt nur Uniformstücke, welche auf allen Anzügen getragen werden können. Auch Hugo Elm’s „Kindertheater“ (Eßlingen, J. F. Schreiber) wendet sich an kein bestimmtes [838] Alter, sondern bietet sich Allen als Rathgeber an, welche an Kinderspielen auf der Bühne Vergnügen haben und an der Einrichtung solcher Bühnen en miniature sich betheiligen wollen.
Als ein gediegenes Geschenkwerk für das mittlere Jugendalter empfehlen wir zunächst „Im Frühlicht“, Märchen und Erzählungen von Julie Ludwig, mit sechs Bildern in Farbendruck von Hermann Vogel (Stuttgart, Gebrüder Kröner). Die Verfasserin hat sich einen geachteten Namen als Jugendschriftstellerin erworben und erzählt in ihrem neuen Buche der jungen Herzen Freud und Leid in meisterhafter Weise. Ihre anmuthend poetische, lebenswarme und -wahre Darstellung fesselt und erhebt den jugendlichen Leser; gern wird er zu den einzelnen Geschichten wiederholt zurückkehren, der echt künstlerisch aufgebauten Handlung von Neuem mit ganzem Interesse folgen und am Schlusse dieselbe freundliche und nachhaltige Befriedigung empfinden wie beim ersten Male. Auch der reiferen Jugend wird dieses Buch hochwillkommen sein, welches nicht nur als Geschenkwerk Verwendung finden sollte; auch die Schulen sollten sich diese Bereicherung ihrer Bibliotheken nicht entgehen lassen.
Unser geschätzter Mitarbeiter Viktor Blüthgen erfreut mit einer Märchensammlung aus aller Welt: „Der Märchenquell“ (Leipzig, Ambr. Abel). An solchen Sammlungen, und zwar guten, ist kein Mangel; wer aber die Blüthgen’sche andern vorzieht, darf gewiß sein, eine sehr glückliche Wahl getroffen zu haben. Die „Volksmärchen der Deutschen“ von Musäus, für die Jugend ausgewählt und bearbeitet von M. W. G. Müller (Stuttgart, K. Thienemann’s Verlag) können wir für die gewecktere reifere Jugend ebenfalls nur empfehlen, da nicht nur die Auswahl der Märchen zu billigen ist, sondern namentlich auch die Illustrationen dieses stattlichen Geschenkwerkes – nach Zeichnungen von Hermann Vogel theils in Farbendruck, theils in Holzschnitt ausgeführt – unbedingter Anerkennung werth sind. (Eine weniger umfangreiche, aber nicht minder sorgfältige Auswahl der Volksmärchen von Musäus ist in der „Universalbibliothek für die Jugend“ erschienen) – Von der längst vortheilhaft bekannten Sammlung deutscher Märchen und Sagen „Der Wunderborn“ (Stuttgart, Gebrüder Kröner), mit dem reichen Illustrationsschmuck von Eugen Neureuther, haben die Verleger eine neue billige Ausgabe veranstaltet und damit den Wünschen Vieler Rechnung getragen, welchen der frühere Preis zu hoch, der Besitz der werthvollen, in ihrer Art einzigen Sammlung aber doch erwünscht war. – Lina Walther’s „Wunderbare Geschichten“ (Gotha, Fr. Andr. Perthes) sind frisch und keck erzählt. Die Verfasserin trifft den Ton für Kinder und fesselt zugleich durch originelle Stoffe; wir hoffen ihr noch öfter zu begegnen.
Von den Erzählungen, welche dem täglichen Leben entnommen sind, müssen wir „Arthur und Squirrel“ von Johanna Spyri (Gotha, F. A. Perthes) obenanstellen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn uns ein neues Buch dieser Schriftstellerin zu Gesicht kommt. Sie ist unter allen Jugendschriftstellerinnen der Gegenwart entschieden die bedeutendste, und nur eine möchten wir ihr überhaupt an die Seite stellen: die verstorbene Ottilie Wildermuth. Es ist merkwürdig, wie verschieden Beide in ihren Werken und wie ähnlich sie doch in ihrem Streben und Können sind. Wir bedauern, daß wir auf den Inhalt von „Arthur und Squirrel“ nicht kurz nacherzählend eingehen können; wer aber einmal das Buch zur Hand nimmt, wird es nicht ohne die höchste Befriedigung fortlegen. – Recht erfreulich und beachtenswerth sind auch zwei andere Novitäten. „Die Kinder von Bucheck“ von A. v. d. Osten (Stuttgart, K. Thienemann’s Verlag) und „Vier Erzählungen aus der Kinderwelt“ von Thekla von Gumpert (Stuttgart, W. Effenberger), beide ansprechend illustrirt.
Von den geschichtlichen Erzählungen für das mittlere Jugendalter nennen wir in erster Reihe die „Patriotischen Erzählungen“ von Ferdinand Schmidt, dem verdienten Berliner Jugend- und Volksschriftsteller (Düsseldorf, Bagel), „Otto IV. mit dem Pfeile“ und „Der falsche Waldemar“ von demselben (ebenda). Von Franz Heyer erschienen „Kaiser Konrad II.“ und „Kaiser Heinrich III.“ (Breslau, M. Woywod), zwei Jugendschriften von großem Werthe. – L. Willigerod erzählt „Altes und Neues aus Bayern“ (Gotha, F. A. Perthes). Bei König Ludwig II. und seinen Schöpfungen verweilt die Verfasserin am längsten, und ihre gewandte Darstellung wird den Leser lebhaft fesseln.
Eine Zeitschrift für die Jugend feiert ihr fünfundzwanzigjähriges Jubiläum: die „Kinderlaube“ (Dresden, C. C. Meinhold und Söhne). Der vorliegende Jubiläumsband bildet ein überaus stattliches Geschenkwerk; der Inhalt ist mannigfaltig und nach Text und Bildern gediegen. – D. Duncker’s „Buntes Jahr“ (Berlin, A. Hofmann und Comp.) ist ein Kinderkalender, der sich bereits im vorigen Jahre Freunde erworben hat und von den alten Bekannten herzlich willkommen geheißen wird.
Die Zahl der ausschließlich für die reifere Jugend vom zwölften Jahre aufwärts bestimmten Schriften ist eine so große, daß wir nur die bedeutendsten derselben hier erwähnen können. Zuerst: „Freuden und Leiden auf offener See“ von J. H. O. Kern (Stuttgart, Gebrüder Kröner), mit Völker-, Insel- und Seebildern aus dem Stillen Ocean. Das ist ein Buch, wie es der Jugend gefällt und wie es Eltern und Lehrer ihr ruhig in die Hand geben können: spannend geschrieben und nach Stoffwahl und Darstellung Zeugniß ablegend von den für den Verfasser maßgebenden trefflichen erzieherischen Grundsätzen. Zahlreiche Abbildungen, zum Theil in prächtigem Farbendruck, unterstützen die Anschaulichkeit der Schilderungen. Auch „In Sturm und Noth“ von demselben Verfasser (Leipzig, Hirt und Sohn) enthält Bilder aus dem Seeleben, welche geeignet sind, das Interesse lebhafter Knaben zu fesseln und Achtung und Liebe für den von steten Gefahren bedrohten, aber in allen Lagen ruhigen und kühnen Seemann in ihnen zu erwecken. „Seespuk“ (ebenda) von dem kaiserlichen Marinepfarrer P. G. Heims in Kiel setzt ein sehr reifes Verständniß voraus und wendet sich nicht allein an die Jugend, sondern auch an Erwachsene. Was das Buch enthält, sind Geschichten von allerhand Aberglauben, Märchen und Schnurren aus dem Seemannsleben, welche der Verfasser entweder fremden Schriftstellern entlehnt oder in Seemannskreisen gesammelt und meisterhaft nacherzählt hat. – „Der letzte Mohikaner“ (ebenda) von [[James Fenimore Cooper |Cooper]] ist bekannt. Die vorliegende von A. Helms veranstaltete neue Ausgabe empfiehlt sich durch sorgfältige Bearbeitung und glänzende Ausstattung.
Von Oskar Höcker erschien eine neue kulturgeschichtliche Erzählung aus der Zeit Karl’s des Großen: „Wuotan’s Ende.“ (Leipzig, Hirt und Sohn). Auch Julius Pederzani-Weber und Adolf Glaser entlehnen ihre Stoffe der Kulturgeschichte. Ersterer schildert in seinem Buche „Kynstudt“ (ebenda) die vielfachen Kämpfe der Brüder vom deutschen Orden gegen die Littauer und Polen; Letzterer in „Masaniello“ (Leipzig, Otto Spamer) das kampfbewegte Leben Neapels im 17. Jahrhundert. Eine Leuchte der Wissenschaft, Galileo Galilei, steht mit im Vordergrund der Handlung. – „Theodor Körner und sein Vaterhaus“ von W. Weyergang (ebenda) sollte in keiner Jugendbibliothek fehlen.
Ein hervorragendes Geschenkwerk für Knaben ist „Das Buch der Jugend“ (Stuttgart, K. Thienemann’s Verlag), ein in gediegenster Ausstattung erschienenes Jahrbuch, von dem wir wünschen möchten, daß es sich in recht zahlreichen Familien einbürgere. Erzählungen aus Leben und Geschichte, Naturschilderungen, Experimente, Rechenaufgaben und Räthsel etc. bieten eine reiche Abwechslung.
Einen trefflichen Wegweiser durch das Gebiet der Astronomie bietet der „Bilderatlas der Sternenwelt“ von Edmund Weiß, dem Direktor der Sternwarte zu Wien (Eßlingen, J. F. Schreiber). Einen solchen Atlas haben wir bisher noch nicht gehabt. Er enthält 41 lithographirte vorzügliche Tafeln mit leichtverständlichem erläuternden Text aus berufenster Feder. Das Werk darf ein Geschenk genannt werden, an welchem sich die ganze Familie erfreuen kann.
Die hübsch ausgestatteten Bändchen der „Universalbibliothek für die Jugend“ dürfen, wenn es für den Weihnachtstisch einzukaufen gilt, nicht vergessen werden. Die Bibliothek enthält Geschenkwerke für jedes Alter und für Knaben und Mädchen. Jedes Bändchen ist auf das Sorgfältigste bearbeitet und macht in dem saubern rothen Einbande mit reichem Schwarz- und Golddruck einen echt weihnachtlichen Eindruck. Dazu haben sie den Vorzug außerordentlicher Billigkeit, so daß ihre Beschaffung auch Denen leicht möglich ist, deren pekuniäre Mittel nicht allzu reichlich bemessen sind oder bei denen die größere Reihe der zu Beschenkenden eine gewisse Beschränkung auferlegt. Gutsherren, Vorstände von Vereinen, die Leiter von Erziehungsanstalten etc., welche eine ungewöhnlich große Schar von Kindern bedenken wollen, finden in der Universalbibliothek eine reiche Auswahl, mögen sie nun Erzählungen aus dem Leben oder aus der Geschichte wünschen, Robinsonaden, Märchen oder Sagen, Indianergeschichten oder markige Erzählungen aus dem Seeleben.
Von den speciell für die reifere weibliche Jugend berechneten Schriften erwähnen wir nur kurz folgende: „Was soll denn aus ihr werden?“ von der trefflichen Johanna Spyri (Gotha, Perthes), „Ringen und Streben“ von Julie Werner (Stuttgart, Karl Krabbe), „Die letzten Maltheims“ von Brigitte Augusti (Leipzig, Hirt u. Sohn) und „Vielliebchen“, Bilder aus dem deutschen Familienleben von Charlotte Molotka (Stuttgart, Krabbe). Diese Auswahl ist zwar keine große, dafür aber sind die wenigen gebotenen Erzählungen um so werthvoller.
Mädchen im sogen. Uebergangsalter sollten auch mit den Perlen der Dichtung bekannt gemacht werden; denn gerade dieses Alter erschließt sich dem innigen Verständniß für Schönheit und Poesie am leichtesten. Als
gediegene Sammlungen zugleich in geschmackvollster Ausstattung, empfehlen wir namentlich die „Lieder der Heimath“ von Ludwig Bund (Iserlohn, Julius Baedeker) und „Album deutscher Kunst und Dichtung“ von Friedrich Bodenstedt (Berlin, G. Grote) oder als eine kleinere Sammlung „Am eignen Herd“ von Maximilian Bern (Leipzig, Adolf Titze): Bücher, welche den damit Beschenkten bis in späte Jahre werth bleiben werden. Dietrich Theden.
Blätter und Blüthen.
Das Geburtshaus Napoleon’s I. Von dieser Casa Bonaparte in Ajaccio, welche von den Reisenden aller Länder heimgesucht wird, entwirft uns Ludwig Hevesi in seinen „Bildern aus Italien“ (Stuttgart, Adolf Bonz), denen er den italienischen Titel „Almanaccando“ giebt, ein sehr anschauliches Bild. Dies Haus ist ein Eckhaus der Straße Saint-Charles und der Straße Letizia; in der ersteren ist, seiner Stirnseite gegenüber, eine Hausstelle offen gelassen worden und der hierdurch entstandene kleine Platz heißt Place Letizia: es ist der anspruchsloseste Platz der Welt. Die Häuser, die ihn bilden, kehren ihm zum Theil die Rückseiten zu. Ein blauweiß gestrichenes Schilderhaus, dessen Schildwache jedoch die sparsame Republik eingezogen hat, ist das einzige monumentale Gebäude des Platzes; nicht einmal in einen umfriedeten Square haben die beiden Kaiserreiche diesen historischen Fleck Erde verwandelt. Nur der Hauswirth hat zwei struppige Grasrondeaus angelegt und einige magere Bäumlein darein gesetzt. In der Mitte des einen steht eine Palme, in der Mitte des andern ein Oelbaum: sie sind von dem braven Hausmann gepflanzt worden, als der kleine Lulu das Licht der Welt erblickt hat, allein die Palme ist keine Palme des Ruhmes geworden für den Helden von [839] Saarbrücken und der Oelbaum kein Oelbaum des Friedens für den Verbannten von Chislehurst. Im Hintergrunde des Platzes ragt eine hohe Maststange empor, an deren Spitze ein napoleonischer Kaiseraar sitzt, ehemals prächtig vergoldet, jetzt glanzlos und schäbig; früher hatte er noch zwei gleiche Genossen auf hohen Stangen; doch die Republikaner schlugen eines Tages das kaiserliche Geflügel herab.
Das Haus selbst hat drei Stockwerke, die in der Raumeintheilung freigebig angelegt sind. Die Fenster sind hoch und breit; die Färbung der sechs Fenster breiten Hauptfaçade ist durch eine zwischen gelb und grau schwankende Tünche sehr unentschieden; unter den Fenstern hat der Regen Fransenbehänge von langen schwarzgrauen Streifen über die Mauer gezogen. Die Jalousien sind lichtgrau gestrichen, „kaiseraugengrau“, sagte man unter Napoleon III., wie ehemals „kaiseraugenblau“ unter Joseph II. Die Thüren und Fenster im Erdgeschoß sind schwarz wie in einem Trauerhause, und das ist es ja oft genug gewesen. Eine ungeheure viereckige Marmortafel über der einfachen Hausthür kündet die Bedeutung des Hauses in großen goldenen Buchstaben an.
Mit einem einzigen Schritt durchmißt man von der Schwelle aus den ganzen Hausflur des Advokaten Karl Bonaparte und betritt die Treppe, die, aus schiefergrauen Steinstufen gebildet, in zwei Absätzen zum ersten Stock hinaufführt. Hier finden sich acht Gemächer: die Wohn- und Staatszimmer der großen Advokatenfamilie von Ajaccio; doch sind dieselben jetzt in etwas verwahrlostem Zustande. Die Tapeten, welche der schlimme Jerome einst bekritzelt, sind schon längst fort, ebenso wie die Schulbücher, aus denen Napoleon die erste Kunde von Alexander dem Großen und Julias Cäsar erhalten. Die Wände der meisten Zimmer sind heute weißgetüncht oder mit bescheidenen Streifenmustern versehen, sogar das berühmte blaue Zimmer, in dem der große Kaiser geboren wurde. Alle Räume, mit Ausnahme des großen Tanzsaales, sind gleichmäßig mit rothen Thonfliesen gepflastert; der Hausrath deutet theils auf die geschnörkelte Zeit des Rokoko, theils auf die Epoche von der großen Revolution bis zum ersten Kaiserreich. In den Damastüberzügen der Stühle und Sofas haben die Motten wenig, die Engländer aber desto ärger gehaust. Fetzenweise ist dieser historische Damast nach England gewandert, so daß eine Menge Sessel kahl dastehen und ein Theil bereits neue Ueberzüge erhalten hat; denn der echte britische Mann kann keinen Napoleon I. leiden, doch die Ueberzüge seiner Sessel nimmt er gern mit.
Von den Räumen des Hauses ist außer dem Geburtszimmer Napoleon’s der kleine Salon bemerkenswerth mit seinen halbblinden Spiegeln, dem Plafond mit den zwei Gesetzestafeln mit Wage und Richtschwertern zwischen Wolken, einem vielfarbigen Hausrath, gelbem Sofa, kirschrothen Sesseln, einigen total geschundenen Stühlen, und einem Piano von vier Oktaven, einem alten, wackligen, wurmstichigen Kasten mit abgeschlagenen Ecken und einem altkorsischen Podagra in allen Beinen. Dies ist das Piano der Madame Letizia, der Mutter der Könige. Der große Saal, der in seinen beiden Langseiten je sechs Fenster hat, ist im Laufe der Zeit bald Tanzsaal, bald Kaserne gewesen, letzteres zur Zeit der großen Revolution, als der junge Feuerkopf Napoleon sich mit Freunden und der Familie im Hause verschanzte und mit den Waffen in der Hand den Todfeinden seines Hauses, den Pozzo di Borgo und Peraldi, Trotz bot.
Bilder, Angedenken, Reliquien aus beiden Kaiserreichen finden sich im ganzen Hause verwahrt, das jetzt allerdings nur noch den Eindruck eines großen Reliquienschreins macht, nachdem die Cäsaren, die ihm entstammten, von der Bildfläche der Weltgeschichte verschwunden sind. †
Weihnachtssingen in Luzern. (Mit Illustration S. 824 und 825.) Für die Gemälde-Ausstellung im Krystallpalast zu London, welche zu Ehren des Herrscherjubiläums der Königin Viktoria veranstaltet war, wurde
eine große goldene Jubiläumsmedaille geprägt, um damit das beste seit 1879 gemalte Bild, abgesehen von Nationalität, Stoff und Schule, zu krönen. Diese hervorragende Auszeichnung wurde dem Gemälde von Hans Bachmann „Das Weihnachtssingen“, welches unsere Holzschnittreproduktion vorzüglich wiedergiebt, mit vollem Recht zuerkannt. Der junge Meister entnahm den Stoff zu demselben dem Leben seiner schweizerischen Heimath. Es stellt nämlich einen alten Brauch im Kanton Luzern dar. Alljährlich in der Zeit von Weihnachten bis Dreikönigen zieht dort der Schulmeister, der zugleich die Stelle des Organisten bekleidet, mit den Kirchensängern und Musikern, die er zum Theil aus seiner Schuljugend bildet, von Gehöft zu Gehöft, frohe Weihnachtslieder zum Vortrag bringend. Diese klingen gewöhnlich in den Neujahrswunsch aus:
„Wir kommen hier an,
Zu wünschen Euch an,
Ein gutes glückselig
Gesund auch und fröhlich
Ein gutes Neujahr!
Gott mache es wahr!“
Von den durch solchen Gesang geehrten Hausbewohnern werden dann die Musiker und Sänger beschenkt und bewirthet, wobei in der Regel die gemüthlichste Geselligkeit mit Tanz und Jubel sich entwickelt.
Diesen sinnigen Brauch hat Bachmann in seinem Bilde sehr anschaulich geschildert; man sieht, daß er Land und Leute gründlich studirt hat; denn beide hat er mit treuer Wiedergabe der eigenartig frischen Alpennatur zur Darstellung gebracht. Und zugleich trägt das Gemälde den Stempel des echten Kunstwerks, da es neben der strengen Wahrheit auch eine poetische Auffassungsweise bekundet, welche dem Vorgange eine tiefere Weihe verleiht. Mit der feierlichen Fröhlichkeit der an der Thür des Gehöfts Versammelten klingt die Abendstimmung des klaren Wintertags bei aufgehendem Mond harmonisch zusammen.
Hans Bachmann wurde 1852 in Winikon, Kanton Luzern, geboren. Um sich zum Maler auszubilden, besuchte er zunächst die Kunstakademie zu Düsseldorf; dann wurde er Privatschüler von Eduard von Gebhardt und später von Karl Hoff. In seinen ersten Bildern war namentlich der Einfluß des letzteren Lehrers bemerkbar. Doch bald strebte der junge Künstler mit allen Kräften danach, sich zu einer besonderen Eigenart durchzuringen. Da zwang ihn eine tückische Krankheit, ein paar Jahre in seiner Heimath zuzubringen. Und hier nun, mit der Wiederherstellung seiner Gesundheit, fand er auch den rechten Boden für seine künstlerische Schaffenskraft. Er kehrte nach Düsseldorf zurück mit einem reichen Material, mit einer Menge origineller Naturstudien, die von dem gediegenen Ernst einer schlichten, aber durchaus gesunden Auffassungsweise beredtes Zeugniß ablegten. Sein nächstes Bild, ein Begräbnißzug in den Alpen, „Zur letzten Ruhe“ betitelt, bekundete demgemäß eine volle kräftige Individualität und erhielt auf der internationalen Ausstellung in Antwerpen eine wohlverdiente ehrenvolle Erwähnung. Der Künstler war zum selbständigen Manne gereift. Sein neuestes Bild, das in London prämirt worden ist, zeigt einen wesentlichen Fortschritt auf dem klar erkannten Wege, und so darf von dem strebsam schaffenden Vertreter eines echt künstlerischen Naturalismus für die Zukunft noch Bedeutendes erwartet werden.
Ein Pamphlet auf Schiller und Goethe. Daß unsere großen klassischen Dichter zu jeder Zeit ihre Gegner hatten, ist wohlbekannt: in der Regel war nur der Eine oder Andere von ihnen den gestrengen Kritikern unsympathisch; sie wurden nicht Beide zugleich in einen gemeinsamen Sündenfall verwickelt. So war Wolfgang Menzel ein warmer Verehrer Schiller’s, während er Goethe aufs Schärfste verurtheilte; höchstens die ultramontanen Tendenzschriftsteller wandten sich gegen Beide mit gleicher Verketzerung. Jetzt aber ist ein dramatischer Dichter erstanden, der in der Vorrede zu seinem Drama auf die weimarischen Dioskuren die heftigsten
[840] Schmähungen schleudert. Ihm sind Schiller und Goethe „irreleitende Abschreiber, welche sich die Achtung der von ihnen zur Kunstsimpelei verführten Nation erschwindelt haben“. (!) Schiller hat „Ziel und Endzweck des Dramas vollständig verkannt“. (!) Goethe ist frivol; bei seinen weiblichen Gestalten denkt man an Voltaire’s Faungesicht; Goethe’s „Faust“ ist „ein kopfloses Durcheinander“. „Diesen Faust soll der Teufel holen!“ „Schiller’s Muse hätte eine Kur im Tollhause durchmachen müssen.“ (!) Wahrlich, eine beneidenswerthe Selbständigkeit des Urtheils! Und wer ist der unerschrockene Kritiker? Ein bayerischer Dichter Namens Hans Pöhnl, dessen Volksbühnenspiel „Gismunda“ am Münchener Hoftheater in Scene ging und wegen seiner kindischen Fibelverse in allen tragischen Scenen eine wachsende Heiterkeit erweckte und einen großen Lacherfolg davontrug. Daß ein solches Stück vom Münchener Hoftheater gegeben werden konnte, das muß allerdings ganz unbegreiflich erscheinen, eben so wie das unverfrorene Urtheil über unsere großen Dichter, wie es ähnlich kaum jemals zu Tage gefördert wurde. †
„Nase und Schule.“ In dem Artikel über den chronischen Nasenkatarrh (vgl. „Gartenlaube“ Jahrg. 1887, S. 442) hat Dr. Fritsche darauf hingewiesen, daß Krankheiten der Nase die geistige Thätigkeit beeinträchtigen können. Dieses Thema wurde auch auf der letzten Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte behandelt. Herr Guye aus Amsterdam bereicherte dabei die Wissenschaft um ein neues gelehrtes Wort: „Aprosexia“, was auf deutsch die Unfähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand zu lenken, bedeutet. Daß dieselbe sehr oft mit Krankheiten der Nase zusammenhängt, ist wiederholt beobachtet worden; besonders schlagend ist aber das folgende von Guye mitgetheilte Beispiel. Ein siebenjähriger Knabe konnte in der Schule in einem ganzen Jahre nicht mehr als die drei ersten Buchstaben des Alphabets erlernen. Nach einmaliger Operation einer Geschwulst in der Nase lernte er in einer Woche das ganze Alphabet. Guye legt nun in Folge seiner Erfahrungen den Pädagogen besonders ans Herz, bei jedem hinter den Anderen zurückbleibenden Schüler auf den Zustand der Nase und insbesondere auf die Form des Athmens ihre Aufmerksamkeit zu richten. Die Thatsache, daß die sogenannte „Aprosexia“ oft auch mit der sogenannten „Faulheit“ zusammenhängt, wird durch die an und für sich beachtenswerthen Guye’schen Ausführungen natürlich in keiner Weise erschüttert, und man sollte darum in der Schule künftig nicht zu viel auf die Nase schieben! *
Die alte Sage vom Zauberer Merlin hat in Deutschland besonders der „romantischen Dichterschule“ und ihren Anhängern Stoff zu dichterischen Gebilden gegeben. In den meisten dieser Dichtungen charakterisirt sich Merlin als ein verzauberter, in die Tiefen des Waldes verbannter Naturgeist. Der echte Merlin aber, der bretonische Barde und Zauberer, trägt eine wesentlich andere Physiognomie. Er ist nach den alten bretonischen Volksliedern ein Sohn Lucifer’s, der zur Welt gekommen ist, um die Welt der Hölle zurückzuerobern, und nichts liegt ihm ferner als zarte Gefühle über den stillen Frieden der Waldwelt. Den echten, bretonischen Merlin hat jetzt Rudolf von Gottschall in seiner neuesten gewaltigen, epischen Dichtung: „Merlin’s Wanderungen“ (Breslau, S. Schottlaender) von Neuem heraufbeschworen, um ihn eine neue Erdenfahrt vollführen zu lassen. Gottschall’s neuestes Werk ist ein Gedankenpoem von hoher, künstlerischer Vollendung. Auf den Wanderungen, welche Merlin mit den Genien der Hölle, Hochmuth, Stolz, Wollust, Neid, Geiz, Schwelgerei und Trägheit, unternimmt, reißt er mit unentwegter Hand den Schleier vom Antlitz unserer Zeit und zeigt uns in farbenprächtigen, formschönen Schilderungen, die eben so menschlich wahr wie dichterisch edel sind, die „Krankheiten des Jahrhunderts“.
Er schildert uns, wie die Sündenkönigin des Genusses ihr Gift den höchsten Kreisen wie den niedern Schichten des Volkes einflößt, wie der Hochmuth, Stolz und Zorn die Nationen gegen einander im wilden Kampf empören, wie Neid und Geiz das wahre menschliche Glück verkümmern. Aber als echter Dichter weiß Gottschall diesen Nachtseiten unseres Lebens auch einzelne lichte Momente entgegenzustellen, die schließlich den trüben Erscheinungen in poetischer, versöhnender Weise das Gegengewicht halten. Dahin gehört die schlichte, erhebende Episode der kleinen Näherin „Nanette“, die der Tugend getreu bleibt; dahin gehört der Künstler, der mitten in dem Strudel des Lebens das Panier der idealen Kunst hoch hält. Zu den imposantesten Schilderungen der Dichtung gehört die poetische Rückschau auf den deutsch-französischen Krieg, in welcher der Dichter die Schlachtgemälde mit einem markigen, gluthvollen Kolorit versieht. Jedenfalls charakterisirt sich das Epos in einer Zeit, wo gerade auf epischem Gebiet die Wasserfarben allzu sehr Mode sind, als eine hervorragende geistvolle Schöpfung, die den Leser wie ein echtes Kunstwerk magisch fesselt. Hermann Pilz.
Unerwartete Bescherung. (Vergl. die Kunstbeilage.) Das Christkind bereitet Freude in Stadt und Land. Doch größere Freude als uns die Scene auf dem reizenden Blume-Siebert’schen Bild zeigt, wird es wohl selten bereitet haben. Da sitzt das Mädchen mit der Feder in der Hand, um an den Geliebten zu schreiben; „an den Husarengefreiten …!“ so lautet die Aufschrift des Packets, das den Brief begleiten soll. Da werden der anmuthigen Briefschreiberin plötzlich die Augen zugehalten: ihr fröhliches Lächeln zeigt, daß sie bereits die volle beglückende Gewißheit darüber hat, wer solchen Scherzes sich erdreistet. In der That, der
Husarengefreite ist unbemerkt ins Zimmer getreten; er hat ein Recht, ihr die Augen zuzuhalten … sie braucht ja die Zeilen nicht mehr zu sehen, die sie schreibt – Brief und Packetsendung sind ja überflüssig geworden; der Gefreite hat Urlaub erhalten und bringt der Geliebten das schönste Christgeschenk – sich selbst. Der Ausdruck des höchsten Glückes auf den Gesichtern des militärischen Romeo und seiner ländlichen Julie verklärt das ganze schlichte Zimmer des Bauernmädchens mit seinen weihnachtlichen Vorbereitungen – und ein Wiederschein davon ruht auf dem Gesichte der Mutter, die an der Thür steht, die Säbeltasche und den Säbel des Husaren haltend, denn sie war im Einverständniß mit dem Ankömmling und der klirrende Säbel sollte die Ueberraschung nicht stören. Der Maler hat uns eine reizende Idylle vorgeführt, an welcher das freudenspendende Christkind selbst seine Freude haben muß. †
Allerlei Kurzweil.
Kleiner Briefkasten.
B. in K. Belehrung über die Frage, bei wie viel Grad Wärme ein Bad kalt oder sehr kalt bezeichnet wird, finden Sie in dem Artikel „Ueber den Schlaf und die Verhütung der Schlaflosigkeit“ von Dr. Kühner in diesem Jahrgang S. 74 der „Gartenlaube“. Der Verfasser hat inzwischen, veranlaßt durch vielfachen Wunsch der Leser der „Gartenlaube“, verschiedene Normalthermometer konstruirt, auf welchen die für verschiedene Bäder maßgebende Temperatur verzeichnet ist. Sehr praktisch für jeden Haushalt ist namentlich das in einem uns vorliegenden Cirkular unter Nr. 4 aufgeführte Thermometer, welches nicht nur Angaben über die übliche und allgemeine Verwendung der Wärme und Kälte beim Baden, sondern auch solche der zuträglichen Zimmertemperatur, der normalen Blutwärme und der Fiebertemperaturen enthält. Die Fabrikation dieser Thermometer hat Karl Grendel in Oberneubrunn (Thüringen) übernommen.
R. H. in Karlsruhe. Ernst Eckstein’s beliebter Roman: „Die Claudier“ (Leipzig, Karl Reißner) ist in wohlfeiler Ausgabe in einem Bande erschienen. Der Preis ist statt 15 Mark jetzt nur 8 Mark. Es ist das überhaupt die neunte Auflage des vielgelesenen Werkes.
R. P. in Dresden. Die neue Volapüksprache findet auch scharfe Kritiker, so Henne am Rhyn in „Unsere Zeit“ und Pfarrer Joseph Stempfl in seiner Schrift: „Ausstellungen an der Volapük“ (Kosel’sche Buchhandlung in Kempten), worin verschiedene Mängel der neuen Weltsprache dargelegt werden.
B. in K. Die Illustration „Raubritter Hans Schüttensamen wird gefangen nach Nürnberg gebracht“ (vergl. „Gartenlaube“ S. 776 u. 777) ist seiner Zeit auf unserm Prospekt für das Jahr 1887 als Probebild erschienen, keineswegs aber in einem anderen Blatte, wie Sie meinen.
Argia Z. in Triest. Ueber die Bedingungen, unter welchen Ihnen die Uebersetzung der betr. Novellen eingeräumt werden kann, werden Sie genaue Auskunft erhalten, sobald Sie Ihre volle Adresse uns angegeben haben.
W. in St. Petersburg. Den Bericht über russische Suppen haben wir der kleinen Schrift des als Kulturhistoriker bekannten Ed. Schranka entnommen. Wenn Sie andere Recepte uns schicken wollen, so wird es uns willkommen sein.
P. R. in Karlsruhe. Sie meinen, Monaco sei der einzige Ort, wo noch das öffentliche Glücksspiel im Großen getrieben werde? Nach neuern Nachrichten hat sich auch in Montreux in der Schweiz das Hazardspiel eingebürgert und zwar in Gestalt des Baccarat, welches mit Billardkugeln gespielt wird, die in die 23 Vertiefungen eines am unteren Ende des Billards angebrachten blechernen Aufsatzes fallen, indem sie an die Bande gespielt werden und von dieser zurückprallen. Es handelt sich dabei um „grade“ oder „ungrade“ mit Bezug auf die Nummern der Vertiefungen: je nachdem das Eine oder das Andere festgesetzt ist, kassirt der Banquier die auf dem grünen Streifen des Billardrandes aufgesetzten Summen ein, wenn die Kugel fehlging.
Inhalt: Heilige Nacht. Gedicht von Otto Sievers. Mit Illustration. S. 821. – Die Geheimräthin. Novelle von Hieronymus Lorm (Schluß). S. 822. – Ein Hochverrathsproceß in Kanada. Von Hans Blum (Schluß). S. 826. – Weihnachten eines Seekadetten. Von Helene Pichler. S. 828. Mit Illustrationen S. 828 und 829. – Der Unfried. Eine Hochlandsgeschichte von Ludwig Ganghofer (Fortsetzung). S. 831. – Der Frieden. Gedicht von Rudolf v. Gottschall. Mit Illustration. S 833. – Das erste Jahr im neuen Haushalt. Eine Geschichte in Briefen. Von R. Artaria. XIII. S. 835 – Das große Fest der Liebe. Von Hermann Heiberg. Mit Illustration. S. 836 – Weihnacht. Gedicht von W. Heimburg. Mit Illustration. S. 837. – Weihnachtsbüchertisch für die Jugend. Von Dietrich Theden S. 837. – Blätter und Blüthen: Das Geburtshaus Napoleon’s I. S. 838. – Weihnachtssingen in Luzern. S. 839. Mit Illustration S. 824 und 825. – Ein Pamphlet über Schiller und Goethe. S. 839. – Vor Weihnachten. Illustration. S. 839. – „Nase und Schule“. S. 840. – Die alte Sage vom Zauberer Merlin. Von Hermann Pilz. S. 840. – Unerwartete Bescherung. S. 840. – Allerlei Kurzweil: Bilder-Räthsel. S. 840. – Auflösung des magischen Quadrats auf S. 804. S. 840. – Auflösung des Bilder-Räthsels auf S. 804. S. 840. – Kleiner Briefkasten. S. 840.
- ↑ Die leuchtende, zehn Minuten brennende Rettungsboje, welche entzündet und über Bord geworfen wird, sobald bei Nacht der Ruf „Mann über Bord“ ertönt. Gelingt es dem Verunglückten, sie zu erfassen, so wird er von dem schnell ausgesetzten Boote meist gerettet werden können.