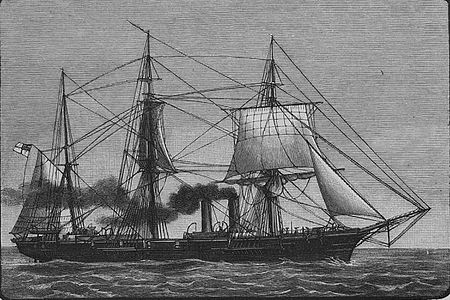Die Gartenlaube (1885)/Heft 14
[221]
| No. 14. | 1885. | |
Illustrirtes Familienblatt. — Begründet von Ernst Keil 1853.
Osterzeit.
Nach der kurzen Fröhlichkeit
Unsres kleinen Mummenschanzes
Kommt die wahre Faschingszeit,
Kommt das Fest des Sonnenglanzes:
Ihrem großen Karneval
Stürmt die Erde jetzt entgegen,
Schon beginnt ihr, Berg und Thal,
Bunte Kleider anzulegen.
Lächelnd zerrt sie her und hin
Ihre Maskengarderobe,
Wirft den Schnee als Hermelin
Auf der Veilchen blaue Robe,
Launenhaft von Eis bestreut
Und durchwogt von Blumendüften,
Tanzt sie mit den Flocken heut,
Morgen mit den Frühlingslüften.
Auf einander folgt wie toll
Abends spät und früh am Tage
Lerchenjubel wonnevoll,
Amselschlag, die süße Klage.
Du, des Balles Königin,
Sonne, dringe durch, erhebe
Aller Herzen, Aller Sinn,
Und was todt noch scheint, belebe!
Hermann Lingg.
Die Frau mit den Karfunkelsteinen.
Der alte Maler war bei den letzten Worten aufgestanden, hatte zärtlich den Arm um seine Frau geschlungen und sie sanft in die Sofa-Ecke zurückgedrückt.
„So – das Stehen macht Dir Schmerz, lieber Schatz. Und Du mußt auch Deinen Alten nicht so ängstigen mit der Erregtheit, die Dir allemal schadet! … Ja, wissen Sie, Fräulein, solch ein Frauenherz ist ein Wunder an Liebeskraft und Liebesfähigkeit,“ sagte er, seinen Platz wieder einnehmend, zu Margarete. „Man meint, mit der Hingebung und Aufopferung für die Kinder müsse es erschöpft sein, und da kommen die Enkel, und das Großmutterle ist wieder dieselbe Löwin, die sie in der Jugendkraft gewesen.“
Margarete dachte mit Bitterkeit an die alte Dame im oberen Stock des Vorderhauses, für welche Kinder und Kindeskinder nur Stufen waren, auf denen sie emporsteigen wollte.
„Sehen Sie, da an den warmen Ofenkacheln lehnen die Hausschuhe, und in der Ofenröhre steht heißes Warmbier für unseren kleinen Kurrendschüler,“ fuhr er fort. „Und wenn er heimkommt, da strahlt er allemal vor Freude; denn seiner Meinung nach hat er jetzt einen mächtigen Wirkungskreis – er sorgt für seine Großeltern.“
Der alte Mann lächelte, und dabei wischte er sich unter der Brille eine Thräne der Rührung fort.
„Ja, es kamen ein paar fatale, ein paar schlimme Tage für uns, nachdem der junge Herr mir aufgesagt hatte,“ hob er wieder an. „Wir hatten die Schneider- und Schuhrechnung für Max bezahlt und unseren Kohlenvorrath angeschafft, und eine Summe, auf die wir stets pünktlich rechnen konnten, war plötzlich weggefallen; da kam ein Abend, an welchem wir vor der leeren Kasse standen und nicht wußten, wovon wir am anderen Tag auch nur eine Suppe kochen sollten … Ich wollte gehen und ein Paar von unseren Silberlöffeln verkaufen; aber das Frauchen da“ – er zeigte mit zärtlichem Blick auf seine Frau – „kam mir zuvor. Sie nahm Stickereien und Strickereien, die sie mit ihren geschickten Händen in Mußestunden gearbeitet hatte, aus der Kommode und ging – so sauer ihr auch das Gehen wird – mit Max in die Kaufläden, und da brachte sie nicht nur Geld, sondern auch viel Bestellungen mit heim … Nun lasse ich alter Kerl mich von der Hand ernähren, an die ich einst den Verlobungsring gesteckt hatte, in der unerschütterlichen Ueberzeugung, daß mein Mädchen das Leben einer Prinzessin an meiner Seite haben solle. Ja, sehen Sie, das ist nun Künstlerleben und Künstlerhoffen!“
„Ernst!“ unterbrach ihn Frau Lenz und drohte mit dem Finger. „Willst Du wirklich Fräulein Lamprecht weismachen, ich sei so Eine gewesen, die sich ein Schlaraffenleben bei Dir erträumt hätte? … Nein, Fräulein, er fabelt, der alte Künstlerkopf! Zum Faulenzen habe ich nie Talent gehabt, dazu bin ich immer zu rasch gewesen. Schaffen und Helfen, das war stets mein Lebenselement, und die Ader hat auch Max von mir. ‚Großmama,‘ sagte er auf dem Nachhauseweg, ‚morgen gehe ich unter die Kurrendschüler. Der Herr Kantor hat zu mir gesagt, solch einen kleinen Jungen mit meiner Stimme könnte er brauchen für seinen Chor, und die Jungens bekommen ganze Taschen voll Geld –‘“
„Wir suchten ihm die Idee auszureden,“ fiel Herr Lenz ein; „aber er ließ nicht nach; er bat und weinte und schmeichelte, und da gab meine Frau endlich den Ausschlag und erlaubte es –“
„Aber nicht um des Erwerbes willen!“ unterbrach sie ihn fast heftig protestirend. „Denken Sie das um Gottes willen nicht! Die paar Groschen liegen unberührt im Kasten; sie sollen als ein Denkzeichen an die Zeit aufbewahrt werden, wo das bittere ‚Muß‘ dem Kinde den Gedanken eingegeben hat, ums liebe Brot vor dem Hause zu singen, das –“
„Häunchen !“ mahnte der alte Mann mit großem Ernst und Nachdruck.
Sie preßte die Lippen auf einander und sah mit seltsam loderndem, beredtem Blick durch das gegenüberliegende Fenster in die froststarrende Luft hinein. Es lag etwas Rachedürstendes in ihrem ganzen Wesen.
„Das Kind ist schlecht genug behandelt worden in dem großen, stolzen Hause, seit es die deutsche Heimath betreten hat,“ sagte sie mit noch weggewandtem Blick, grollend, wie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. „Der Kies im Hofe war zu vornehm für seine Sohlen, und der Gartentisch unter den Linden wurde entweiht durch seine Bücher, seine schreibenden Händchen. Und von dem Sarge droben im großen Saal sollte er weggescheucht werden, wie –“ sie brach ab und legte die Hand über die Augen.
„Mein Bruder ist krank und deßhalb keines Menschen Freund; mit ihm dürfen Sie nicht so streng ins Gericht gehen, auch Andere müssen unter seiner Schroffheit leiden,“ tröstete Margarete sanft. „Dagegen weiß ich, daß mein Vater den kleinen Max sehr gern gehabt hat, wie alle in unserem Hause. Ich weiß, daß er für seine Zukunft hat Sorge tragen wollen, und aus dem Grunde bin ich gekommen … Es würde auch ihm gewiß, wie mir, ans Herz gegangen sein, das prächtige Kind draußen vor der Thür stehen zu sehen, und deßhalb möchte ich Sie bitten, dem kleinen Kurrendschüler die gegebene Erlaubniß von heute ab zu verweigern und mir die Freude zu gönnen –“ sie schob heißerröthend die Hand in die Tasche.
„Nein, kein Almosen!“ rief Frau Lenz fast wild und legte die Hand auf den Arm der jungen Dame. „Kein Almosen!“ wiederholte sie beruhigter, als Margarete die leere Hand aus der Tasche zog. „Ich fühle, Sie meinen es gut. Sie haben von kleinauf ein edles, braves Herz gehabt, Niemand weiß das besser als ich – Sie trifft kein Vorwurf! … Aber lassen Sie uns auch das bischen Stolz darauf, den über uns verhängten Schlag aus eigener Kraft parirt zu haben … Sehen Sie,“ – sie zeigte nach einer großen Korbwanne im Fensterbogen, die bis an den Rand mit bunter Stickerei gefüllt war, – „das ist lauter fertige Arbeit! Wir brauchen vorläufig nicht zu darben, und später wird Gott helfen! … Max soll nicht wieder auf der Straße singen, ich verspreche es Ihnen heilig und theuer! Er wird zwar jammern, aber er muß sich hineinfinden.“
Margarete nahm die Rechte der alten Frau in ihre Hände und drückte sie warm.
„Ich kann Sie verstehen und werde gewiß nicht wieder so plump ,mit der Thür ins Haus fallen‘,“ sagte sie mit einem flüchtigen Lächeln. „Sie werden mir dagegen gewiß erlauben, das Kind nach wie vor lieb zu haben und seinen Lebensgang im Auge zu behalten.“
„Wer weiß, Fräulein – die Verhältnisse wandeln oft ganz plötzlich die scheinbar festesten Ansichten – wer weiß, wie Sie nach vier Wochen darüber denken!“ erwiderte Frau Lenz mit schwerer Betonung.
„Nicht anders als heute auch, dafür möchte ich meinen alten Kopf verwetten!“ rief ihr Mann ganz enthusiastisch. „Ich habe das kleine Gretchen in seinem Thun und Wesen beobachtet, als es noch im Hofe spielte. Es gehört eine starke Geschwisterliebe und Aufopferungsfähigkeit dazu, immer wieder das geduldige Pferdchen eines verzogenen, kränklichen Bruders zu sein und sich widerstandslos schlagen und peinigen zu lassen. Ich habe ferner gesehen, wie das liebe, kleine Ding nach der Küche rannte und von der brummenden Bärbe für die Bettelkinder in dem Hausflur Butter auf die Brotstücken ertrotzte … Wollte ich alle die erlauschten Züge eines guten, wackeren Herzens aufzählen, ich würde nicht fertig. Und ich weiß, das Weltleben draußen hat von dem reichen Fonds nichts genommen – das hat der alte Lenz gleich in den ersten Tagen nach der Rückkehr an sich selbst erfahren.“
Margarete hatte sich währenddem erhoben – sie war ganz roth und verlegen.
„Nun, dann haben doch wenigstens ein Paar Augen die wilde Hummel nachsichtig beurtheilt,“ sagte sie lächelnd. „Aber Sie sollten nur die Censuren von damals sehen, sollten wissen, wie oft mir der Kopf gewaschen werden mußte meiner Frevelthaten wegen! Das ist freilich Geheimniß des Vorderhauses geblieben und konnte Ihre gütige Meinung nicht alteriren … Nur in dem einen Punkte gebe ich Ihnen Recht – ich habe [223] einen harten Kopf, den die Macht der Verhältnisse doch nicht so leicht binnen vier Wochen wandeln dürfte.“
Sie reichte den beiden alten Leuten abschiednehmend die Hand und verließ, von ihnen bis zur Treppe geleitet, das Packhaus. Sie ging weit gedankenvoller, als sie gekommen war … War das ein köstliches Zusammenleben in dem alten Hause da hinter ihr! Je heftiger das Schicksal auf die Herzen einstürmte, desto enger schlossen sie sich an einander an.
Ihr Blick flog unwillkürlich über die vornehme obere Etage des Vorderhauses – da herrschte freilich ein anderer Geist, „Anstand, gute Sitte, Konvenienz“ nannte ihn die Großmama, und „verknöcherte Selbstsucht, gepaart mit verachtungswürdigem Unterwerfungstrieb gegen Hochgestellte“ der alte Mann, der lieber einsam draußen auf dem Lande lebte, als daß er die Eisesluft athmete, in welcher sich die distinguirte Frau Gemahlin gefiel. War es da ein Wunder, wenn Herbert – aber nein, selbst im Geiste durfte sie ihn nicht mehr durch das Vorurtheil kränken, daß er herzlos sei! … Er war gut zu ihr. Er hatte ihr sogar zweimal nach Berlin geschrieben, fürsorglich, als sei er ihr Vormund, und sie hatte ihm geantwortet. Darauf hin war er ihr bei ihrer Rückkehr auf die letzte größere Station entgegengekommen, in dem zartsinnigen Wunsche, ihr das Wiederbetreten des vereinsamten Vaterhauses in etwas zu erleichtern … Das hatte die Großmama freilich nicht erfahren; sie hätte diese Zuvorkommenheit und Herablassung des Herrn Landraths gegen das junge Ding, die Grete, sicher nicht gebilligt, schon aus dem Grunde nicht, weil sie ihr das Leid angethan hatte, durchaus nicht Baronin von Billingen werden zu wollen. Die alte Dame hatte bitterböse darüber an ihre Schwester und Margarete geschrieben … Wie Herbert über das Scheitern dieser Wünsche dachte, das war dem jungen Mädchen bis zur Stunde dunkel geblieben. Er hatte die delikate Angelegenheit in keinem seiner Briefe erwähnt, und sie war auf ihrer Hut gewesen, auch nur mit einem Worte daran zu rühren …
Mit diesen abschweifenden Betrachtungen war sie längst in die Hofstube zurückgekehrt und hatte die Geldrolle wieder in den Kasten des Schreibtisches gleiten lassen – unter einem abermaligen Erröthen. So konnte und durfte sie ihre Theilnahme für den kleinen Max nicht wieder bethätigen wollen – der Weg war ihr verschlossen. Sie fühlte sich machtlos; die Verhältnisse übersehen und wissen, wie da zu wirken sei, das konnte nur ein Mann. Sie nahm sich vor, mit Herbert darüber zu sprechen …
Seitdem waren zwei Tage verstrichen. Der Landrath war noch nicht zurückgekehrt, und deßhalb herrschte tiefe Ruhe auf der sonst so frequentirten Treppe und im oberen Stocke. Margarete ging jeden Morgen pflichtschuldigst hinauf, um der Großmama guten Tag zu sagen. Das war stets ein saurer Gang; denn die alte Dame grollte und zürnte noch heftig. Sie schalt zwar nicht laut – Gott behüte, nur keine offenkundige Leidenschaftlichkeit! Der gute Ton hat ja dafür feinere und desto sicherer treffende Waffen: Messerschärfe in Blick und Stimme, und Dolch- und Nadelspitzen auf der Zunge. Aber diese Art und Weise des Angriffs empörte die Enkelin doppelt, und sie brauchte oft ihre ganze Selbstbeherrschung, um gelassen und schweigend zu ertragen … Meist ungnädig entlassen, ging sie dann immer mit dem Gefühl der Erlösung die Treppe wieder hinab, um für einen Moment in den Flursaal einzutreten. Es herrschte zwar eine mörderische Kälte in dem weiten Saale, und Papas Privatzimmer waren versiegelt; nicht einer der traulichen Räume, in denen er gelebt und geathmet, nicht der kleinste Gegenstand, den seine Hand berührt, waren ihr zugänglich; sie mußte sich mit der Stelle begnügen, wo sie ihn zum letzten Male friedlich schlafend, einen Schein der Verklärung auf der im Leben so finsteren Stirn, gesehen hatte. Aber an dieser Stelle überkam sie doch immer das wehmüthige und wohlthuende Gefühl, als spüre sie einen Hauch seiner Nähe. Drunten geschah ja Alles, um die Spuren seines Daseins und Wirkens möglichst schnell zu verwischen. –
Heute Morgen nun hatte Margarete beim Verlassen des Flursaales eine Begegnung gehabt. Sie war rasch auf die Schwelle der Thür getreten und hatte plötzlich Auge in Auge vor der eben vorübergehenden schönen Heloise gestanden. Der jungen Dame um einige Schritte voraus war die Baronin Taubeneck die Treppenwendung hinauf gekeucht; sie hatte, von der Anstrengung des Emporsteigens ganz benommen, die aus dem Flursaale Tretende gar nicht gesehen; ihre Tochter dagegen hatte sehr freundlich gegrüßt, ja, ihr Blick war sogar mit dem unverkennbaren Ausdrucke von Theilnahme über die Mädchengestalt in tiefer Trauer hingeglitten, das konnte Margarete sich selbst nicht wegleugnen, und doch war sie in Versuchung gewesen, den höflichen Gruß zu ignoriren und, ohne ihn zu erwidern, in den Flursaal zurückzuflüchten. … Diese schöne, gerühmte Heloise war ihr nun einmal in tiefster Seele unsympathisch – weßhalb? Sie wußte es selbst kaum. So in nächster Nähe gesehen, war die herzogliche Nichte in der That am schönsten. Die herrliche Sammethaut des jungen Gesichts, die Pracht der Farben und die großen, glänzend blauen Augen blendeten förmlich, und der Großpapa hatte Recht, wenn er sagte, davor müsse sich seine Enkelin, das braune Maikäferchen, verkriechen. Selbst die phlegmatische Ruhe ihres Wesens machte sich im Gehen nur als stolze Würde und Vornehmheit geltend. „Was, Neid, Grete?“ hatte sich das junge Mädchen selbst in diesem Augenblicke des aufsteigenden Grolles und Widerwillens gefragt. Nein, Neid war es nicht! Ihr war es ja stets ein Genuß gewesen, in ein schönes Mädchenantlitz zu sehen – Neid war es ganz bestimmt nicht! Wohl aber mochte es die angeborene Verbitterung des plebejischen Blutes gegen die Widersacher des Bürgerthums sein – ja, das war der Grund! Und als die Großmama droben unter einem Wortschwalle der Freude und Beglückung dem Besuche entgegengekommen war, da hatte das junge Mädchen die Hände auf die Ohren gelegt und war die Treppe hinabgeflogen.
Drunten aber hatte der herrschaftliche Schlitten, eine herrliche Muschel mit kostbarer Pelzdecke, vor der Thür gehalten, und nachdem später die Damen wieder eingestiegen waren, da hatte die schöne Heloise mit ihrem weißen Schleier und wehenden Goldhaare ausgesehen, als fliege eine Fee über den Schnee hin. O weh, wie lächerlich dagegen mochte neulich das zusammengeduckte „Rumpelstilzchen“ im Schlitten gehockt haben, wie frostgeschüttelt und hilfsbedürftig neben Herbert’s vornehmer Erscheinung! –
Den ganzen Tag über hatte sie bittere, aufdringliche Gedanken und Empfindungen nicht loswerden können, und dazu war es dunkel in allen Stuben. Der Himmel schüttelte unermüdlich ein dichtes Flockengestöber über die kleine Stadt her, und nur selten fuhr ein Windstoß lichtend durch die stürzenden Schneemassen, die wie ein silberstoffener Behang alle Aussicht in Gassen und Straßen verschloß. … Erst am Abend, als die Lampe auf dem Tische brannte, wurde es heimlicher in der Wohnstube und stiller in Margaretens Seele. Tante Sophie war trotz des Schneewetters ausgegangen, um einige unaufschiebbare Bestellungen zu machen, und Reinhold arbeitete in seiner Schreibstube; er kam überhaupt nur noch herüber, wenn er zu Tische gerufen wurde.
Margarete ordnete den Abendtisch. Im Ofen brannten die Holzscheite lichterloh und warfen durch die Oeffnung der Messingthür einen breiten, behaglichen Schein über die Dielen, und von dem Gesims der unverhüllten Fenster her, gegen die draußen die Schneeflocken wie hilflos flatternde Seelchen taumelten, um an den erwärmten Scheiben rettungslos zu sterben, dufteten doppelt süß Tante Sophiens Pfleglinge, ganze Schaaren von Veilchen und Maiblumen. … Nein, gerade dem häßlichen Tage zum Trotze sollte nun der Abend gemüthlich werden! Bärbe brachte sauber garnirte kalte Schüsseln herein, und Margarete entzündete den Spiritus unter der Theemaschine, und als Reinhold sagen ließ, man möge ihm ein belegtes Butterbrot hinüberschicken, er werde nicht kommen, da wurde das Herz der Schwester erst recht leicht.
Draußen fuhren mehrere Wagen vorüber, und es war auch, als halte einer derselben vor dem Hause. War der Landrath zurückgekommen? Nun, das erfuhr man ja morgen, früher freilich nicht! – Margarete fuhr fort, Schinkenscheibchen auf Reinhold’s Butterbrot zu legen; sie sah auch nicht auf, als ein leises Thürgeräusch an ihr Ohr schlug – Bärbe brachte jedenfalls noch Etwas für den Tisch herein; aber ein so kalter Luftzug, wie er eben über ihre Wange strich, kam doch nicht von der warmen Küche her; unwillkürlich bückte sie auf, und da sah sie den Landrath an der Thür stehen. Sie schrak heftig zusammen, und die Gabel mit dem Schinken entfiel ihrer Hand.
[224]
Die linden Lüfte sind erwacht, 5 Nun, armes Herze, sei nicht bang!Nun muß sich Alles, Alles wenden. |
Die Welt wird schöner mit jedem Tag, 10 Es blüht das fernste, tiefste Thal!Nun, armes Herz, vergiß der Qual; |
[225] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [226] Er lachte leise auf und trat näher an den Tisch. Er war noch im Reisepelz, und auf seiner Mütze glitzerten Schneeflocken, also direkt von draußen kam er herein.
„Aber solch ein Schrecken, Margarete!“ sagte er kopfschüttelnd. „Warst wohl, trotz Deiner hausmütterlichen Beschäftigung, im sonnigen Griechenland, und der Hans Ruprecht im Pelz riß Dich in die rauhe thüringer Wirklichkeit zurück? … Nun, guten Abend auch!“ setzte er in treuherzig thüringer Weise hinzu und bot ihr die Hand – war ihr doch, als müsse es Freude sein, die sie aus seinen Augen unter der Pelzmütze hervor anleuchtete.
„Nein, in Griechenland war ich nicht,“ antwortete sie, und die augenblickliche innere Erregung bebte noch in ihrer Stimme nach. „Trotz Schnee und Eis bin ich um die Weihnachtszeit doch lieber hier. Aber es ist für mich etwas ganz Unerhörtes, Dich in unsere Wohnstube eintreten zu sehen. Du wirst selbst wissen, daß diese Stube stets abseits von Deinem Wege gelegen hat. Früher mag Dich der Kinderlärm verscheucht haben, und später“ – der schmerzhafte Zug, der seit dem Tode ihres Vaters ihre Lippen umlagerte, wich momentan einem schelmischen Lächeln – „später das ausgesprochene Spießbürgerthum in der Einrichtung und dem Leben und Weben hier unten.“
Er zog ein kleines Paket aus der Rocktasche und legte es auf den Tisch. „Das ist’s, weßhalb ich hier eingetreten bin, das einzig und allein!“ sagte er ebenfalls lächelnd. „Weßhalb soll ich ein ganzes Pfund Thee, das ich für Tante Sophie in der Residenz besorgt habe, zwei Treppen hinaufschleppen?“ Nun nahm er die Pelzmütze ab und schleuderte die letzten funkelnden Schneereste fort. „Uebrigens irrst Du in Deiner Annahme – ich finde es urgemüthlich hier, und Dein Theetisch sieht nichts weniger als spießbürgerlich aus.“
„Darf ich Dir eine Tasse Thee anbieten? Er ist eben fertig –“
„Ei wohl! Er wird mir gut thun nach der kalten Fahrt. Aber dann mußt Du mir auch erlauben, daß ich meinen Pelz ablege.“ Er mühte sich, die schwere Last abzustreifen. Unwillkürlich hob Margarete den Arm, um zu helfen, wie sie es bei Onkel Theobald zu thun gewohnt war; aber er fuhr zurück und ein Zornesblitz sprühte aus seinen Augen. „Lasse das!“ wies er sie fast rauh zurück. „Die töchterliche Hilfe mag bei Onkel Theobald nöthig sein – bei mir noch nicht!“
Unmuthig, mit einem letzten kräftigen Rucke riß er den Pelz von der Schulter und warf ihn auf den nächsten Stuhl.
„So, nun bin ich allerdings hilfsbedürftig – ich lechze nach Deinem heißen Thee!“ sagte er gleich darauf und ließ seine elegante Gestalt in die Sofa-Ecke gleiten. Seine Stirn war wieder heiter, und er strich sich behaglich den Bart. „Aber ich bin auch hungrig, liebes Hausmütterchen, und solch ein appetitliches Butterbrot, wie Du es eben vor meinen Augen zurecht gemacht hast, sollte mir schon schmecken und jedenfalls besser munden, als die Butterbrote oben, die meine Mutter konsequent durch die Köchin herrichten läßt. … Später, am eigenen Herde, werde ich mir das allerschönstens verbitten – die Hausfrau muß mir eigenhändig dergleichen Bissen mundgerecht machen, wenn sie nicht will, daß ich hungrig vom Tische aufstehe.“
Margarete reichte ihm den Thee; aber sie schwieg und sah ihn nicht an. Sie mußte denken, ob die stolze Heloise wirklich die Etikette so bei Seite setzen und mit ihren wundervollen weißen Händen die Butterbrötchen für den Herrn Gemahl streichen würde? – Und Herbert selbst? Dachte er im Ernste so spießbürgerlich häuslich, Großmamas Sohn, der Mann der Formen, mit denen er der Welt imponirte?
„Du bist sehr still, Margarete,“ unterbrach er das eingetretene kurze Schweigen; „aber ich sah ein spöttisches Zucken Deiner Mundwinkel, und das spricht deutlicher als Worte. Du moquirst Dich innerlich über die Häuslichkeit, wie ich sie haben will, und meinst, mein Wille könne an so Manchem scheitern. Ja, siehst Du, ich lese in Deinen Zügen wie in einem Buche – Du brauchst deßhalb nicht gleich so roth zu werden wie ein Pfingströschen – ich weiß mehr von Deinen Seelenvorgängen, als Du denkst.“
Jetzt sah sie verletzt und unwillig auf. „Schickst Du Deine Gendarmen wirklich auch auf die Hetzjagd nach Gedanken, Onkel?“
„Ja, meine liebe Nichte, das thue ich mit Deiner gütigen Erlaubniß, und das mußt Du Dir schon gefallen lassen,“ antwortete er leise lachend. „Mich interessiren alle oppositionellen Gedanken und mehr noch solche, denen der Kopf selbst nur widerwillig Raum giebt, gegen die er ankämpft wie das junge Roß gegen seinen oktroyirten Herrn, und die schließlich glänzend siegen, weil ein mächtiger Impuls hinter ihnen steht.“
Er führte seine Tasse zum Munde und sah dabei aufmerksam zu, wie die zierlichen Mädchenfinger flink das gewünschte Butterbrot zurecht machten.
„Ein Einblick in die Wohnstube hier muß in diesem Augenblick außerordentlich behaglich und anmuthend sein,“ hob er mit einem Blick auf die unverhüllten Fenster nach einem momentanen Schweigen wieder an. „Da drüben“ er neigte den Kopf nach der jenseitigen Häuserfront des Marktes – „könnte man uns füglich für ein junges Ehepaar halten –“
Margarete wurde flammendroth. „O nein, Onkel, die ganze Stadt weiß –“
„Daß wir Onkel und Nichte sind - ganz richtig, meine liebe Nichte,“ fiel er sarkastisch gelassen ein und griff abermals nach seiner Tasse.
Margarete widersprach nicht; aber eigentlich hatte sie sagen wollen „die ganze Stadt weiß, daß Du verlobt bist“ … Nun, mochte er denken, was er wollte! Er neckte sie in fast übermüthiger Weise, und Humor, den sie bis jetzt nicht an ihm gekannt, prickelte in jedem seiner Worte. Er war offenbar froh gelaunt und brachte jedenfalls stillbeglückende Aussichten aus der Residenz mit. Aber sie selbst war nicht in der Stimmung, sich mit ihm zu freuen, sie war unsäglich deprimirt und wußte nicht weßhalb, und wie man oft im inneren Zwiespalt unbewußt gerade nach Widerwärtigem greift, nur um eine Wendung herbeizuführen, so sagte sie, indem sie ihm das fertige Brötchen hinreichte: „Heute Morgen hatte die Großmama Besuch – die Damen vom Prinzenhofe waren da!“
Er richtete sich lebhaft auf, und eine unverkennbare Spannung malte sich in seinen Zügen. „Hast Du sie gesprochen?“
„Nein,“ erwiderte sie kalt. „Ich hatte nur eine flüchtige Begegnung mit der jungen Dame im Treppenhause. Du weißt am besten, daß sie mich einer Anrede nicht würdigen kann, weil ich im Prinzenhofe noch nicht vorgestellt bin.“
„Ach ja, ich vergaß! – Nun, Du wirst das ja wohl nunmehr in den allernächsten Tagen abmachen.“
Sie schwieg.
„Ich hoffe, Du thust das schon um meinetwillen, Margarete.“
Jetzt sah sie ihn an; es war ein finsterer Grollblick, der ihn traf. „Wenn ich das Opfer bringe, mich in tiefer Trauer und in meiner Seelenstimmung zu der Komödie hinausschleppen zu lassen, so geschieht es einzig und allein um dem Drängen und den Quälereien der Großmama ein Ende zu machen,“ versetzte sie herb. Sie hatte sich auf den nächsten Stuhl gesetzt und kreuzte die Hände auf dem Tische.
Ein kaum bemerkbares Lächeln schlüpfte um seinen Mund. „Du fällst aus Deiner Rolle als Hausmütterchen,“ rügte er gelassen und zeigte auf ihre feiernden Hände. „Die Gastlichkeit verlangt, daß Du mir Gesellschaft leistest und auch eine Tasse Thee nimmst –“
„Ich muß auf Tante Sophie warten.“
„Nun, wie Du willst! Der Thee ist vortrefflich und soll mir trotzalledem schmecken … Aber ich möchte Dich doch einmal fragen, was hat Dir denn die junge Dame im Prinzenhof gethan, daß Du stets so – so bitter wirst, wenn von ihr die Rede ist?“
Eine glühende Röthe schoß ihr in die Wangen. „Sie – mir?“ rief sie wie erschrocken, wie ertappt auf einem bösen Gedanken. „Nicht das Mindeste hat sie mir angethan! Wie könnte sie auch, da ich bis jetzt kaum in ihre stolze Nähe gekommen bin?“ Sie zuckte die Schultern. „Ich fühle aber instinktmäßig, daß das der Kaufmannstochter noch bevorsteht –“
„Du irrst. Sie ist gutmüthig –“
„Vielleicht aus Phlegma – möglich, daß sie sich ungern echauffirt. Ihr schönes Gesicht –“
„Ja, schön ist sie, von einer unvergleichlichen Schönheit sogar,“ fiel er ein. „Und ich möchte gern wissen, ob heute Morgen nicht etwas wie ein heimliches Glück in ihren Zügen zu lesen gewesen ist – sie hat gestern Hocherfreuliches erfahren.“
Ach, also darum war er heute Abend so übermüthig, so voll übersprudelnder Laune; das „Hocherfreuliche“ betraf ihn und sie zusammen. „Das fragst Du mich?“ rief sie mit einem bitteren Lächeln. „Du solltest doch am besten wissen, daß die Damen vom Hofe viel zu gut geschult sind, um ihre Gemüthsaffekte jedem [227] profanen Blick auszusetzen. Von ‚heimlichem Glück‘ konnte ich nichts bemerken; ich bewunderte nur ihr klassisches Profil, die blühenden Farben, die prächtigen Zähne bei ihrem gnädigen Lächeln und erstickte fast in dem Veilchenparfüm, mit welchem sie das Treppenhaus erfüllte, und das, dieses Uebermaß, war nicht vornehm an der Aristokratin –“
„Sieh, da war ja gleich wieder der bittere Nachgeschmack!“
„Ich kann sie nicht leiden!“ fuhr es ihr plötzlich heftig heraus.
Er lachte und strich sich amüsirt den Bart. „Nun, das war gutes, ehrliches Deutsch!“ sagte er. „Weißt Du, daß ich in der letzten Zeit manchmal des kleinen Mädchens gedacht habe, das ehemals mit seiner geradezu verblüffenden derben Offenheit und Wahrheitsliebe die Großmama nahezu in Verzweiflung gebracht hat? … Das Weltleben draußen hatte nun diese Geradheit in allerliebste, kleine, graziöse Bosheiten verwandelt, und ich meinte schon, auch der Kern der Individualität sei umgemodelt. Aber da ist er, blank und unberührt! Ich freue mich des Wiedersehens und muß wieder an die Zeiten denken, wo der Primaner öffentlich im Hofe als Spitzbube gebrandmarkt wurde, weil er eine Blume annektirt hatte.“
Schon bei seinen ersten Worten war sie aufgestanden und nach dem Ofen gegangen. Sie schob unnöthiger Weise ein Stückchen Holz um das andere in die helllodernden Flammen, die ihre finster zusammengezogene Stirn, ihre sichtlich erregten Züge anglühten … Sie ärgerte sich unbeschreiblich über sich selbst. Das, was sie gesagt hatte, war allerdings die strikte Wahrheit gewesen, aber dabei eine Taktlosigkeit, deren sie sich bis an ihr Lebensende schämen mußte.
Sie blieb am Ofen stehen und zwang sich zu einem Lächeln. „Du wirst mir glauben, daß ich jetzt nicht mehr so penibel denke,“ erwiderte sie von dorther. „Das ,Weltleben‘ härtet die Seele gegen allzu feine Auffassung. Es wird in der heutigen Gesellschaft so viel gestohlen an Gedanken, man nimmt vom guten Namen des lieben Nächsten, von seinem ehrenhaften Streben, von der Rechtlichkeit seiner Gesinnungen so viel, als irgend zu nehmen ist, und möchte gar oft am liebsten die ganze Persönlichkeit vom Schauplatz verschwinden machen, wie damals die Rose in Deine Tasche eskamotirt wurde. Diesen Kampf ums Dasein, oder eigentlich diesen Diebstahl aus Selbstsucht und Neid kann man am besten im Hause eines Mannes von Namen beobachten. Ich habe mir viel davon hinters Ohr geschrieben und diese Weisheit allerdings auch mit einem guten Theil meiner kindlich naiven Anschauung bezahlt … Du könntest mithin vor meinen Augen alle Rosen der schönen Blanka in die Tasche stecken –“
„Die wären jetzt sicher vor meiner räuberischen Hand –“
„Nun, dann meinetwegen das ganze Rosenparterre vor dem Prinzenhofe!“ fiel sie schon wieder erregter ein.
„O, das wäre denn doch zu viel für das Herbarium meiner Brieftasche, meinst Du nicht, Margarete?“ Er lachte leise in sich hinein und lehnte sich noch behaglicher in seine Sofa-Ecke zurück. „Ich brauche mich auch nicht als Dieb dort einzuschleichen. Die Damen theilen redlich mit mir und meiner Mutter, was an Blumen und Früchten auf ihren Fluren wächst, und auch Du wirst Dir bei Deinem Besuche einen Strauß aus dem Treibhause mitnehmen dürfen.“
„Ich danke. Ich habe keine Freude an künstlichen Blumen,“ sagte sie kalt und ging nach der Stubenthür, um sie zu öffnen. Tante Sophie war zurückgekommen und stampfte und schüttelte draußen den Schnee von ihren Schuhen und Kleidern.
Sie machte große Augen, als sich Herbert’s hohe Gestalt aus der Sofa-Ecke erhob und sie begrüßte. „Was, ein Gast an unserem Theetische?“ rief sie erfreut, während Margarete ihr Mantel und Kapotte abnahm.
„Ja, aber ein schlechtbehandelter, Tante Sophie!“ sagte er. „Die Wirthin hat sich schließlich in die Ofenecke zurückgezogen und mich meinen Thee allein trinken lassen.“
Tante Sophie zwinkerte lustig mit den Augen. „Da hat’s wohl ein Examen gegeben, wie vor alten Zeiten? – Das kann die Gretel freilich nicht vertragen. Und wenn Sie vielleicht ein Bischen ins Mecklenburgsche hineinspaziert sind, um hinzuhorchen –“
„Keineswegs,“ antwortete er plötzlich ernst, mit sichtlichem Befremden. „Ich habe gemeint, das sei abgethan,“ setzte er wie fragend hinzu.
„Bewahre! Noch lange nicht, wie die Gretel alle Tage erfährt!“ entgegnete die Tante stirnrunzelnd im Hinblick auf die Quälereien der Frau Amtsräthin.
Der Landrath suchte prüfend Margaretens Augen, aber sie sah weg. Sie hütete sich, auch nur mit einem Worte auf dieses widerwärtige Thema einzugehen, das die Tante unvorsichtiger Weise berührt hatte … Aber er sollte es nur wagen, mit der Großmama gemeinschaftlich vorzugehen und in sie zu dringen, ihren Entschluß doch noch zu ändern – er sollte es nur wagen! –
Sie trat, beharrlich schweigend, hinter die Theemaschine, um Tante Sophiens Tasse zu füllen; Herbert aber kehrte nicht wieder an den Tisch zurück. Er übergab der Tante den mitgebrachten Thee und wechselte in verbindlicher Weise noch einige Worte mit ihr; dann nahm er den Pelz auf den Arm und hielt Margarete seine Rechte hin. Sie legte ihre Fingerspitzen flüchtig hinein.
„Kein ,Gutenacht‘?“ fragte er. „So bitterböse, weil ich Dich bei Tante Sophie verklagt habe?“
„Das war Dein Recht, Onkel – ich war nicht höflich. Böse bin ich nicht; aber gerüstet!“
„Gegen Windmühlen, Margarete?“ – Er sah ihr lächelnd in die zornig aufblickenden Augen, dann ging er.
„Sonderbar, wie sich der Mann geändert hat!“ sagte Tante Sophie und sah über ihre Tasse hinweg heimlich lächelnd in das blasse Mädchengesicht, das, den Fenstern zugewendet, mit verfinstertem Blick in das Schneegestöber hinausstarrte. „Er ist immer gut und voll Höflichkeit gegen mich gewesen, das kann ich nicht anders sagen; aber er war und blieb mir doch ein Fremder, von wegen seiner vornehmen, kühlen Art und Weise … Jetzt ist mir aber oft ganz kurios zu Muthe, ganz so, als hätte ich ihn auch, wie Euch, unter meiner Zucht gehabt. Er ist so herzlich, so zutraulich, – und daß er heute Abend den Thee hier unten genommen hat –“
„Das will ich Dir erklären, Tante!“ unterbrach sie das junge Mädchen kalt. „Es giebt Stunden, in denen man die ganze Welt umarmen möchte, und in einer solchen Stimmung ist er aus der Residenz, vom Fürstenhofe zurückgekommen. Er hat, wie er selbst sich ausdrückte, ‚hocherfreuliche Nachrichten‘ mitgebracht. Wir dürfen demnach in der Kürze die endliche ,Proklamation‘ seiner Verlobung erwarten.“
„Kann sein!“ meinte Tante Sophie und leerte den Rest ihrer Tasse.
Zum sechszigjährigen Professoren-Jubiläum Leopold von Ranke’s.
„Den Sand der Wüste treibt der Sturmwind dahin und dorthin;
das Gebirge läßt er wohl stehen.“
Histor.-polit. Zeitschrift 1, 824.
Am 31. März sind es sechszig Jahre, daß Leopold von Ranke Professor ist. Nicht viel länger ist es her, seitdem er sein erstes Buch geschrieben hat. Bis dahin war er ein der gelehrten Welt so gut wie unbekannter Gymnasiallehrer zu Frankfurt an der Oder. Hier hatte er jenes Werk aus der sonst nicht benutzten Bibliothek eines Professor Westermann herausgearbeitet; ohne Honorar zu empfangen, hatte er es Georg Reimer zum Druck übergeben. Das Buch verschaffte ihm alsbald Namen und Stellung. Wenige Monate später ward er als außerordentlicher Professor der Geschichte nach Berlin berufen, in den Kreis der Savigny und Hegel, an die Universität, welche, wie er selbst rückblickend gesagt hat, „noch unmittelbar in jenem Geiste, in welchem sie gestiftet worden war, lebte, in der Vereinigung der preußischen Strenge und Zucht mit der Vielseitigkeit und Tiefe der deutschen Nation“: in dem Kampf der beiden Parteien, welche damals in allen Disciplinen mit einander rangen, der philosophischen und historischen, hat er seitdem zwei Menschenalter hindurch als Vorkämpfer der historischen Richtung für die politische Historie hier im Centrum der deutschen Wissenschaft und Staatsidee gewirkt. Entfernte er sich von Berlin, so geschah es fast immer, um neue [228] Schätze aus den Archiven der Staaten, deren Leben er erforschte, zusammenzutragen. Jetzt aber, in einem Alter, wo er das Ziel, welches der Psalmist setzt, längst überschritten hat, lebt er ganz daheim unter seinen Büchern, in der Wohnung, die seit Jahrzehnten seine Arbeitsstätte war, in immer gleich geregelter und unermüdlicher Thätigkeit, zurückgezogen von dem Getriebe der Welt, dem er doch mit freier und lebendiger Aufmerksamkeit folgt – und unter dem Blicke des Greises entrollen sich noch einmal die allgemeinen Geschicke: aus den echtesten Quellen schöpfend, durchschreitet er mit jugendlicher Kraft, ja mit stürmischem Eifer den Kreis der Nationen, in deren „lebendiger Gesammtheit“ die Geschichte der Menschheit erscheint.
Alle Welt spricht davon, daß Leopold Ranke die moderne historische Methode ausgebildet oder doch wenigstens auf die mittlere und neuere Geschichte übertragen habe; drei Generationen deutscher Forscher nennen ihn darin ihren Meister. Er selbst aber ist nicht in dieser historischen Methode groß geworden: Historiker von Fach ward er erst mit dem Buch, in dem er die Bahnen seiner Lebensarbeit und die nicht zu vertilgenden Grundlinien der deutschen Geschichtswissenschaft gezogen hat. Weltgeschichtlich allerdings waren die Ereignisse, welche die Jahre seiner Ausbildung begleiteten. Geboren in der Zeit, wo das vulkanische Feuer, welches den morschen Staatsbau des alten Frankreichs verzehrt hatte, in furchtbaren Ausbrüchen über die Grenzen hinwegschritt (zu Wiehe im Unstrutthal am 21. December 1795), erlebte er elf Jahre später, wie die revolutionäre Lava seine thüringische Heimath erreichte: die Donner der Schlacht von Jena dröhnten aus der Ferne dumpf an das Ohr des Knaben; er sah die Fliehenden, die Verwundeten, wie sie in dem Hause der Eltern kurze Rast und Erquickung fanden, und wie dann die übermüthigen Sieger raubend den friedlichen Ort durchzogen.
Als der Vater ihn auf die Schule nach Pforta brachte, stand Napoleon auf dem Gipfel seiner Macht; und eben war die Uebermacht des Gewaltigen auf den Feldern von Leipzig zerbrochen worden, als der Jüngling in derselben Stadt wieder von dem Vater bei seinen Universitätslehrern eingeführt wurde. Hier studirte er, während auf den Schlachtfeldern jenseit des Rheins wie durch die Verhandlungen von Wien und Paris die Karte Europas umgestaltet wurde, und mußte zusehen, wie sein Heimathland von Sachsen losgerissen und Preußen zuertheilt ward; und er hatte kaum seine Studien beendigt, als die vaterländische Romantik der deutschen Bursche sich in dem Enthusiasmus des Wartburgfestes Luft machte.
Doch dürfte man nicht glauben, daß Ranke durch die elementaren Kräfte, welche in dieser Epoche zum Durchbruch kamen und von denen jene Feier ein weithin wirkender Nachhall war, unmittelbar gepackt und beeinflußt wäre. Friedlichere Geister haben sein Leben gestaltet. In den patriarchalisch engen Verhältnissen eines kursächsischen Landstädtchens wuchs er auf. Einige Edelleute, die Officiere einer Husarenschwadron, die Pfarrer und wenige Beamte, dazu etwa noch Rektor und Apotheker, das waren die Honoratioren des Ortes. Zu ihnen gehörte Gottlob Israel Ranke, der als Anwalt und Gerichtsdirektor dreier adliger Familien wirkte. Noch steht das Wohnhaus, nahe der Stadtmauer, dort wo die Rankengasse sich zum Riesbach hinabsenkt, an dessen umbuschten Ufern in den Frühlingsnächten ein Heer von Nachtigallen schlägt. Ein stattliches Anwesen, mit Hof und Garten, Stall und Scheuer; denn zu ihm gehörte ein Landgütchen, das noch heute im Besitz des Gefeierten ist, der „Berg“, welches der Vater durch seinen Knecht, den treuen Dietsch, bewirthschaften ließ. Der Geist der Arbeit und Pflichttreue, des Frohsinns, der Wahrhaftigkeit waltete in dem Hause. Der Ernst des Vaters, die Milde der Mutter begegneten sich in der gleichen Liebe zu den aufblühenden Kindern.
Ein sonniger Glanz des Glückes, selten vom Kummer getrübt, lag über diesen Jahren im Elternhause gebreitet. Lebendige Religiosität, in den alten strengen Formen erhalten und genährt, durchdrang das Ganze. Mit ungemeiner Sorgfalt widmete sich der Vater der Erziehung seiner Knaben; staunend bemerkte er die Begabung und Schwungkraft des Erstgeborenen, den selbständigen Sinn, mit dem dieser das Heilsame und Rechte erkannte. Früh gab er ihn aus dem Hause. Zunächst nach Kloster-Donndorf, das nur eine Stunde weit auf einer Höhe vor dem Walde liegt. Oft noch sah Leopold hier die Seinen. Wenn er dann dem Bruder Heinrich auf dem Heimwege das Geleite gab, erzählte er
[229][230] ihm wohl mit wundervoller Lebendigkeit von den Geschichten des trojanischen Krieges, die er in der Klasse gelernt hatte: der hellenischen Vorwelt „silberne Gestalten“ umfingen da die jugendlichen Seelen. Doch auch die Geister einer großen nationalen Vergangenheit weben über den frischen Wiesen, den wogenden Kornfeldern der Güldenen Aue, über dem raschen tiefen Strom, der sie durchzieht, über den prächtigen Laubwäldern, die das Gelände ihrer Berge krönen: sie umschwebten den Knaben, wenn er auf oder, wie man dort sagt, in dem „Berge“ stand (denn es war ehemals ein Weinberg), unter dem uralten Birnbaum, der seit tausend Jahren, hieß es, seitdem die christliche Gesittung hier gepflanzt ward, seine schweren Fruchtzweige über diesen Abhang breitete. Das sind die Gefilde, die Wälder, wo nach der Ueberlieferung König Heinrich der Sachse am liebsten geweilt und gejagt hat. Flußaufwärts sucht das Auge jenes Ritteburg, auf dessen Feldern wohl der König die Magyaren schlug; dort im Pfarrhause hat die Wiege von Ranke’s Vater gestanden. Weiterhin, in mäßiger Entfernung, wölbt sich der thurmgekrönte Gipfel des Kyffhäuser. Im Osten aber, eine gute Stunde unterhalb Wiehe, erinnert wieder Memlebens schöne Ruine an die Todesstunde des Sachsenkönigs. Die Schatten des Begründers unseres alten Reiches und seines glänzendsten Helden walten über diesem Thale.
Auch auf der Pforte umgaben den Knaben, der hier zum Jüngling heranreifte, die begrenzten Verhältnisse des heimathlichen Lebens. Die Anstalt zeigte noch ganz den Charakter, der ihr eingepflanzt war, humanistischer Schulung und konfessionell gebundener Religiosität: die Lehrer, an ihrer Spitze der gestrenge Rektor Ilgen, sämmtlich Theologen und gewiegte Lateiner; einer unter ihnen trug gar noch Zopf und Perücke: Hausordnung und Unterricht in klösterlicher Gemeinsamkeit straff geregelt. Aber in den engen Formen pulsirte doch wieder jugendlich frisches Leben, gezügelt nur durch die pflichtstrengen Vorschriften, angespornt durch die wetteifernde Gemeinschaft des Umgangs und der Arbeit, und durch das eifrigste Studium des klassischen Alterthums mit Idealität und Schönheitssinn erfüllt. Die großen Weltbegebenheiten berührten freilich nur mit leichtem Wellenschlage die klösterlichen Mauern. Selbst als der sächsische Boden unter den ersten Schlägen der großen Erhebung erdröhnte und der Sturm hart an der Gemarkung des Klosters vorüberzog, konnten sich die Jünglinge schwer von dem inneren Widerstreit lösen, in den sie die Haltung ihres Landesherrn bringen mußte, der auch damals noch sein Geschick mit dem Napoleon’s verknüpft hatte. Erst die Leipziger Schlacht nahm von den jugendlichen Gemüthern den Bann, unter dem ihr nationales Empfinden gehalten war.
So wirkte denn auch auf der Universität vor allem der Geist des Alterthums auf Ranke ein. Hatte er aber in Pforta sich besonders mit den griechischen Tragikern beschäftigt, so zog ihn in Leipzig unter Gottfried Hermann’s Leitung vornehmlich Thukydides an. Es war, wie er sagt, der erste große Historiker, durch den er in der Tiefe ergriffen wurde; mit äußerstem Fleiße habe er in seiner kleinen Stube in der Hainstraße sich der Lektüre desselben hingegeben. Nächst ihm habe er Niebuhr’s Schriften mit nicht geringerem Eifer zu studiren begonnen. Eine andere Richtung habe ihn bald darauf zu den Werken Luther’s geführt, durch die er keinen geringen Impuls erhalten habe. Der antike und der zeitgenössische, kritische Historiker also, welche mit staatsmännischem Blick und in einer klassischen Form die Geschichte von Hellas und von Rom schrieben, und Thüringens größter Sohn, der deutsche Reformator, der auf dem ewigen Grunde des Evangelium die Scheidung des Weltlichen und Geistlichen vollzog, „der das große Gespräch begann, das die seitdem verflossenen Jahrhunderte daher auf dem deutschen Boden stattgefunden hat“ – das sind die drei Geister, denen Ranke die Grundelemente verdankt, aus denen sich seine historischen Studien auferbaut haben. Nach ihnen nennt er als Vierten Fichte, den sittlich-kühnen Denker, dessen religiös-ethische und national-politische Ideen, wie sie an Luther erinnern, so auch mit Ranke’s Auffassung sich innerlich nah berühren.
Wie hätte aber Ranke, von diesen Heroen der Klarheit und der Kraft geleitet, sich in den phantastischen Nebeln der Romantik verlieren mögen, welche damals Kunst und Leben, Litteratur und Politik mit strebender Unruhe erfüllte! Daß er sie begriffen hat, dafür zeugen seine Werke; Niemand hat ihren Geist in Vergangenheit und Gegenwart wärmer, glänzender, wahrer geschildert. Aber sie vermochte ihn nicht mehr zu übermannen. Da sie in der Vollkraft ihrer berauschenden Blüthe stand, trat er ihr klaren Auges, mit der überlegenen Objektivität des Historikers entgegen. Gerade in den Jahren ihrer Herrschaft, eben in Frankfurt schrieb er jenes erste Werk, welches in Kritik und Auffassung bereits den vollen Stempel seines Geistes trägt, die „Geschichte der romanischen und germanischen Völker“.
In dem Titel ist schon der Grundbegriff, in dem alle Werke Ranke’s gedacht sind: die Einheit der romanischen und germanischen Nationen, im Gegensatz zu den bisher vorherrschenden Anschauungen einer allgemeinen Christenheit, der Einheit Europas, endlich auch der analogsten einer lateinischen Christenheit; denn zu dieser gehören auch slavische, lettische, magyarische Stämme, welche eine eigenthümliche und besondere Natur haben. In der Völkerwanderung ward jene Einheit begründet, in dem Zusammentreffen der nationalen, staatlichen und kirchlichen Kräfte, welche auf dem Boden des westlichen, des lateinischen Imperium lebten. In dem Kreise dieser Völker wuchs fort, was sich von den Kulturelementen der alten Welt durch jene Jahrhunderte der Stürme hindurch gerettet hatte; sie haben in der päpstlichen und der kaiserlichen Gewalt, in ihren kirchlich-politischen Kolonisationen, in allen Formen ihrer staatlichen, geselligen und kirchlichen Organisation, in allen Aeußerungen ihres künstlerischen und litterarischen Geistes gemeinsam die mittleren Jahrhunderte erfüllt und gestaltet. Die fremden Nationen an den Grenzen werden abgewehrt oder unterworfen und assimilirt, aber auch dann sind sie nur nebengeordnete, dienende Glieder: Träger der welthistorischen Entwickelung bleiben die sechs Nationalitäten, in welchen die romanischen und germanischen Elemente unter dem Vorwalten des einen oder des andern gemischt sind, eine in Kampf und Verkehr unablässig bewegte, hin- und herfluthende, schließlich doch fortschreitende Gemeinschaft. Indem Ranke in der Einleitung jenes Buches diese Einheit durch die Geschichte des Mittelalters hin verfolgte, faßte er als besondere Aufgabe nur die Epoche ihrer Zertrennung ins Auge, welche das neue Weltalter bedingte: die Ausbildung des spanisch-habsburgischen und des französischen Machtsystems sowie die Spaltung durch die Reformation war das Thema; der erste Gang dieser Entwicklung, bis 1535, sollte betrachtet werden; was zunächst erschien, umschloß die 20 Jahre von 1494 bis 1514, „gleichsam den Vordergrund der neueren Geschichte“.
Das Buch blieb in dieser Form Fragment und hat daher in dem Kreise der Ranke’schen Werke eine Stellung für sich. In Kraft und Fülle der Anschauung, in der lebensvollen Darstellung steht es einzig da; eine Gestalt z. B. wie Savonarola ist mit einer Schärfe der Linien und einer Leuchtkraft der Farben geschildert, welche unmittelbar an den künstlerischen Konfrater des feurigen Prädikanten, an Fra Bartolomeo erinnert. Doch fehlt es nicht in Sprache und Gruppirung an Elementen der Gährung, welche besonders durch die litterarischen Vorbilder und die Materialien der Forschung bedingt waren; mit deren Erweiterung, mit der wachsenden Erkenntniß mußten sie sich abklären; der Grundbegriff selbst gestaltete sich unter dem vergrößerten Gesichtskreise umfassender. Den Uebergang bemerken wir nach Form und Inhalt in dem zweiten Buch, „Die Osmanen und die spanische Monarchie im 16. und 17. Jahrhundert“, das als erste Abtheilung eines umfassenderen Werkes, „Fürsten und Völker von Südeuropa“ in der gleichen Epoche, 1827 zur Ausgabe kam; wie es denn auch bereits aus archivalischen Quellen geschöpft ist. Die „Geschichte der Päpste“ sodann, noch als Ausführung jenes Gesammttitels gedacht, nach der Rückkehr von der epochemachenden italienischen Reise (1831) vollendet, zeigt das volle Gepräge der Meisterschaft. Staunend bemerken wir, daß Ranke in dieser Höhezeit seines Schaffens, in den Jahren, wo er die „Historisch-politische Zeitschrift“ herausgab (1832 bis 1836), seine Lebensarbeit in ihrem vollen Umfange erfaßt und vorgezeichnet hat.
Das Fragment über die „großen Mächte“, welches den zweiten Band jenes Unternehmens eröffnete, enthält, wenn wir von der Weltgeschichte absehen, über deren Vollendung ein wahrhaft göttliches Geschick zu wachen scheint, das Programm aller späteren Werke, ja mehr als dies, einzelne Gedanken darin harren noch heute der Ausführung. In Verbindung gebracht mit den Grundlinien der früheren Arbeiten, steht in diesem Aufsatz die Entwickelung der europäischen Großmächte, des Systems und [231] seiner Glieder, so wie Ranke es später ausgeführt hat, in voller Deutlichkeit vor Augen: das Frankreich Ludwig’s XIV., katholisch und national, monarchisch centralisirt und doch feudalistisch geartet, uniform und stets doch voller Gährung, nach Glanz und Herrschaft begierig; ihm gegenüber das protestantisch-nationale, germannisch-maritime England in dem gewaltigen Ringen seiner beiden aristokratischen Parteien, die doch immer einen durch das nationale Interesse und die populäre Tendenz bestimmten, legal umschriebenen Kreis innehalten, in deren politischem Wettstreite erst der Strom der englischen Nationalkraft weltgestaltend hervortritt; Oesterreich sodann, wirthschaftlich und national so vielgestaltig und doch religiös wie politisch so stabil, katholisch-deutsch, wohlbewaffnet, voll unversiegbarer Lebenskräfte; Rußland, wie eine Naturgewalt plötzlich und furchtbar sich erhebend: die griechisch-slavische Macht, jetzt erst europäisch; Preußen endlich, in dem die deutsch-protestantischen Ueberlieferungen einen späten Anhalt und Ausdruck fanden, nachdem Schweden zusammengebrochen war. Wir lesen da bereits, was alle folgenden Bände ausführlich beweisen, wie modern diese vier letzten Mächte sind, nicht blos der Staat Peter’s des Großen und die norddeutsche Großmacht, sondern auch das parlamentarische Großbritannien und die scheinbar älteste, legitimste Monarchie, das erst durch die Eroberung Ungarns konstituirte Oesterreich: ihre Ausbildung ist die Summe der hundert Jahre von der „glorreichen“ bis zum Ausbruch der großen Revolution, das Resultat die Verdrängung Frankreichs von der Stellung, die es bis 1688 errungen hatte. Und unter dem Einfluß dieser Kraftgruppirung zeigen nun auch die Litteraturen, die religiösen und philosophischen Systeme, die rechtlichen und politischen Theorien, die ganze Sitten- und Empfindungswelt, alles, was man Kultur des 18. Jahrhunderts nennt, ihre zersetzenden wie ihre positiven Tendenzen! Ausführungen, welche aber keineswegs in so blassen Linien der Abstraktion gegeben werden, sondern mit der Fülle des Details, plastischer Anschauung, schärfster persönlicher Zeichnung. Auch über die Revolutionsepoche selbst ergreift Ranke das Wort; und was er in seinen späteren Werken darüber ausgeführt hat, originale bahnbrechende Gedanken, über den explosiven Charakter der Bewegung, die Nothwendigkeit ihres Kampfes mit den umgebenden Mächten, des Zusammenbruches der mechanisirten Staatsgebilde des Kontinentes unter dem Stoß jener eisernen, in vulkanischen Gluthen geschmiedeten Gewalt – das Alles stellt er hier auf wenigen Seiten augenscheinlich dar. Die Stärke Frankreichs beruhte in der nationalen Einheit, in der Centralisation aller Kräfte, die es in der Zertrümmerung selbst durchführte. So konnte es für Europa – und damit tritt die Abhandlung schließlich in unser eigenes Jahrhundert – keine Rettung geben, ehe es „dieser Forderung der Weltgeschicke Genüge zu leisten, die schlummernden Geister der Nationen zu selbstbewußter Thätigkeit aufzuwecken begann“. Das ist die Aufgabe, in deren Lösung wir noch begriffen sind.
Kein Historiker, kein Politiker auch sollte es versäumen, diese Abhandlung, und zugleich die letzte jenes Bandes, das „Politische Gespräch“, wieder und wieder zu lesen. Beide enthalten die Summe der neueren Geschichte und damit auch die Grundlage, auf der alle Politik sich bewegen wird. Alles aber ruht auf dem obersten Begriff der romanisch-germanischen Nationen und der Verkörperung ihres Wesens in dem System ihrer Staaten.
Gerade daß Ranke als Staatsmann schreibt, hat man ihm gern zum Vorwurf gemacht. Daraus leite sich sein Talent ab in der Entwirrung diplomatischer Truggewebe, überhaupt die Meisterschaft in der Behandlung aller auswärtigen Politik, aber auch ein Mangel an Verständniß populärer Strömungen, der inneren Entwickelung, Empfindungskälte gegenüber den sittlichen Forderungen, welche der strebende, reifende, fortschreitende Volksgeist an die Regierung stelle: Vorwürfe, welche, wie man sieht, dem Begriff des Staates den der Regierung unterstellen und dann einen Unterschied konstruiren zwischen Staat und Volk, Regierung und Regierte jedoch einander so entgegen setzen, daß diese als die Regulatoren der ersteren in Bezug auf die sittlichen Ziele und Mittel des staatlichen Lebens erscheinen. Das aber ist nicht, was Ranke meint. So wenig wie allerdings nach seiner politischen Ueberzeugung die Regierung eine leere Form, der kraftlose „Indifferenzpunkt“ im Gewoge der Parteien und ihrer Theorien sein soll, sondern eine lebenerfüllte Macht, „eine Wesenheit, ein Selbst“, eben so wenig ist ihm der Staat ein von der Nationalität lösbares Gebilde, Produkt allgemeiner Theorien, hergeleitet aus der philosophirenden Konstruktion eines Vertrages, sondern ein Lebendiges, Innerlich-Wachsendes, eine machtvolle Gemeinschaft, „moralische Energie“, enger gemeinhin als die Nation, aber ruhend auf ihrem Grunde, so lange noch Leben darin ist. Wie sollte eine solche Individualität nicht auch nach äußerer Entfaltung streben! Da aber begegnet sie im ganzen Umkreis anderen Gebilden, analog und doch wieder eigenthümlich geartet, Modifikationen der Nationalität, lebensvoll, strebend wie sie selbst. So müssen denn alle mit einander ringen. „Denn der Kampf,“ sagt ‚Heraklit‘ „ist der Vater aller Dinge.“ Dennoch aber bleiben sie eben in ihm, in Aktion und Reaktion eine lebendige Gemeinschaft. Denn sie stehen gemeinsam unter den Abwandlungen der großen Verhältnisse, als ein Abglanz des Ewigen überschattet von dem gewaltigen Schicksal, das in ihrem Dasein an dem lebendigen Kleide der Gottheit wirkt.
Wenn Ranke vornehmlich die auswärtige Politik ergründet hat, so ist auch das nur wieder eine Folge seiner Fragestellung: das erste Ziel mußte auf die Entwickelung des Systems, also auf den Zusammenhang und Kampf seiner Glieder gerichtet sein. Gerade darin offenbart sich am deutlichsten, wie sehr innere und äußere Entwickelung sich bedingen; niemals aber begreift unser Historiker die auswärtige Politik eines Staates anders, als seine Kraftentwickelung innerhalb seines Umkreises.
Man redet so oft von Ranke’s Objektivität. Diese besteht eben in jener Auffassung vom Staate und ist nur eine andere Form seines Forschungsprincipes, das, wenn man es auf seinen Grund prüft, die mit philosophischem und religiösem Tiefsinn erfüllte, freiheitliche, universale, das heißt wissenschaftliche Anschauung der historischen Erscheinungen sein will. Diese zu sehen und zu schildern ist die Aufgabe: „die Begebenheit selbst in ihrer menschlichen Faßbarkeit, ihrer Einheit, ihrer Fülle.“ Alles hängt von dem obersten Gesetze ab: die sorgfältigste Erforschung des Einzelnen und die kühne, unbeirrte Erfassung des Ganzen; die Würdigung der Grundkräfte wie alle Schätzung der Persönlichkeit; denn „die großen Begebenheiten reißen Gemüth und Handlungsweise gewaltsam sich nach“, nur unter den Schicksalsmächten ihrer Epoche können wir die Individuen begreifen.
Und nun dürfen wir wohl auch nicht mehr von der Theilnahmlosigkeit oder der verstandesmäßigen Technik dieser objektiven Forschung sprechen, die sich in einer gewissen Kälte der Darstellung zeige. Der Schaden wäre schließlich zu ertragen, wenn nur das Princip gewahrt würde: „strenge Darstellung der Thatsachen, wie bedingt und unschön sie sei, ist ohne Zweifel das oberste Gesetz“. Für uns Jüngere übrigens ist ein Mangel an patriotischer Empfindung, wenn wir nur eben das Princip wahren, nicht mehr zu befürchten, nachdem sich die nationalen Gährungen unter der Doppelwirkung wissenschaftlicher Erkenntniß und politischer That im nationalen Staate abgeklärt haben: sie ist die Lebensluft, in der wir athmen; wie sollte sie also nicht auch unsere Versuche, die Vergangenheit neu zu denken, beleben! Nimmermehr aber dürfen wir darum für die Darstellung versäumen, was wir für die Forschung fordern: Beides hängt unlöslich zusammen; gemeinsam erst macht es einen Widerglanz der Weltereignisse möglich. Denn nur eben dies ist unsere Aufgabe, nicht Ausübung des Weltgerichtes, das Gottes ist und jenseit der Geschichte liegt. Wohl aber können wir die „göttlichen Geheimnisse“ ahnend fassen, wenn wir ihre irdische Erscheinung zu erkennen trachten. Mögen wir unsere Seele dafür empfänglich stimmen! Allzuviel nur des Persönlichen wird ja an den Gebilden unserer Erkenntniß haften bleiben, da sie durch unsere Persönlichkeit hindurch gehen. Unsere Seele ist nun einmal der Spiegel, in den die Urgestalten hinein fallen, aus dem sie wiederkehren müssen. So besitze sie also die krystallene Klarheit der Wahrhaftigkeit! Sollten wir aber nicht hoffen dürfen, daß die Bilder um so schärfer, farbiger, beseelter erscheinen werden, je heller ihre Spiegelfläche ist?
Freilich ist die Aufgabe für uns eine andere geworden als für den Begründer unserer Wissenschaft. Er konnte in stürmischer Bewegung die großen Linien ziehen, die Fundamente legen des Bildersaales der Zeiten. Er hat dann auch die Mauern, Pfeiler, Hallen errichtet und eine Fülle des Schmuckes hinzu gethan; an allen Wänden prangen seine Gestalten. Wir können nur weiter daran bauen und schmücken. Zahllos aber sind die Geschlechter, welche über den Erdball dahin gingen, unermeßlich ist die Summe [232] ihres Wollens, ihrer Arbeit, ihres Glückes und ihrer Schmerzen. Soviel davon auch klanglos untergegangen ist, unendlich bleibt immer noch die Fülle des Erkennbaren. Uns mag nun wohl besonders die innere Geschichte der Nationen interessiren, die litterarische, die wirthschaftliche Bewegung und so fort; aber wir wollen nicht wähnen, daß wir von neuen Principien her, jeder etwa für sich, das Weltganze und die Einzelerscheinungen begreifen können, sondern wollen zunächst den Meister verstehen lernen. In dem Maße, als unter uns die Erkenntniß seiner Principien zunimmt, welche nicht die Schablonisirung liberaler oder konservativer Theorien, sondern die Feststellung historischer Kräfte sind und darum eine ewige Dauer haben werden wie Kepler’sche Gesetze, in dem Maße wird auch der Zusammenhang, der Ueberblick und die Gemeinsamkeit der historischen Arbeit wachsen, werden ihre Jünger, wie Ranke an seinem fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum sagte; „gewissermaßen eine große Familie bilden, zusammengehalten durch den gemeinsamen Kultus der Wahrhaftigkeit“.
Damals, vor nunmehr achtzehn Jahren,[1] hat der Gefeierte selbst, wie er sich ausdrückte „gewissermaßen als sein historisches Testament“ demuthsvoll das Zukunftsideal deutscher Geschichtschreibung kund gegeben, welches ihm stets vorgeschwebt habe: die Verbindung der nationalen, kraftvoll den Moment erfassenden Historie der uns benachbarten Nationen mit der universal-historischen Betrachtung, die dem deutschen Genius gemäß sei: er blicke wie Moses in das gelobte Land einer zukünftigen deutschen Historiographie, wenn er es auch nicht betreten sollte. Halten wir mit ihm an der Hoffnung fest, daß wir ein noch höheres Ziel vor Augen haben, aber lassen wir von dem Wahn, daß wir es schon etwa gar erreicht hätten oder auf einer anderen Straße erreichen könnten, als die er gebahnt hat. Ist unsere Aussicht und somit Kraft und Wille auch begrenzter, so mögen wir uns damit trösten, daß wir auf dem rechten Wege, „der Wahrheit, die nur eins sein kann“, dahergehen. Max Lenz.
- ↑ Vergl. „Gartenlaube“ 1867, S. 100.
Eine Mägdeherberge in Berlin.
Wie tief beklagenswerth die Lage unserer dienenden Klassen ist, wenn eine temporäre Arbeits- und Verdienstlosigkeit über sie hereinbricht; welche Gefahren namentlich den weiblichen Dienstboten in solcher Lage drohen, ist längst allen denjenigen klar geworden, die sich eingehend und Hilfe spendend mit ihnen beschäftigten. Erschreckende Zahlen und Thatsachen brachten manche, die es ehrlich mit ihrem Vaterlande und seiner Entwickelung meinen, zu ernstem Nachdenken, wie man Diejenigen retten könne, die meist durch eine unselige Verkettung der Verhältnisse auf dem Wege zum Sumpfe des Lasters sich befinden oder in denselben schon hineingerathen waren. Es rührte sich aller Orten. In Berlin entstand zuerst der „Verein zur Rettung und Erziehung minorenner weiblicher Strafentlassenen“, sowie der „Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit“, in dessen Aufruf zur Theilnahme es heißt: „Wenn uns bei unserem Willen die Empfindung trägt, daß es hohe Zeit sei, dem äußerlich so stolz aufgerichteten Baue unseres geeinten Vaterlandes nun auch den köstlichen inneren Schmuck, eine geläuterte Sittlichkeit wieder zu gewinnen, so sind wir überzeugt, daß diese Empfindung überall Widerhall wird finden müssen.“
Wenn dieser Widerhall auch leider nicht so laut war, wie man wohl hätte erwarten dürfen, so hinderte das den Verein nicht, die erste Nummer seines Arbeitsprogramms: „Die Errichtung einer Mägdeherberge“ in Berlin zur Ausführung zu bringen.
„Eine Mägdeherberge?“ hören wir Diejenigen fragen, welche die Berliner Anstalten kennen; „wir besitzen ja in Martha’s Hof und Amalienhaus zwei vorzügliche Herbergen, die mit Dienstmädchenschulen verbunden sind!“
Ja gewiß, die Anstalten verdienen alles Lob und haben lange segensreich gewirkt, aber sie leiden unter einem Fehler: sie liegen zu weit von allen Bahnhöfen entfernt. Ein fremd ankommendes Mädchen muß sich den langen Weg mühsam erfragen; die Meisten wissen ihnen gar keinen Bescheid zu geben. Auf diese Weise sind schon Viele in ganz andere und oft sehr schlimme Hände gerathen, oder durften froh sein, wenn sie nur mit dem Verlust ihrer Sachen davonkamen.
Der Verein beschloß nun, im Centrum der Stadt eine dritte Herberge einzurichten, sobald die Mittel dazu vorhanden sein würden. Aber die schlimme Geldfrage! Sie hat auch dem Vorstande manche sorgenvolle Stunde bereitet. Endlich ergab die vom Ober-Präsidium der Provinz Brandenburg bewilligte Hauskollekte die nöthige Summe, um mit der Ausführung beginnen zu können. – Nun kam die zweite Zeit der Noth: Wer vom Vorstande hatte die Aufopferung und die Fähigkeit, sich vorläufig ganz dem Unternehmen zu widmen?
Aber auch hier wurde Rath; ein Vorstandsmitglied, der frühere Fabrikbesitzer Reischel, der neben praktischer Erfahrung eine begeisterte Hingabe für die Arbeiten des Vereins besitzt, nahm die Sache nun ganz in die Hand. Nach langem vergeblichen Suchen, eine passende Lokalität zu finden, wurde im Stadtbahnhof „Börse“, im Centrum der Stadt, ein großes, nicht gebrauchtes Wartezimmer nebst den zwei daran stoßenden Stadtbahnbögen gemiethet, welche letztere allerdings ganz für die in Aussicht genommene Herberge eingerichtet werden mußten. – Der große Bogen gab einen hohen geräumigen Schlafsaal, in dem 30 gute, neue Betten aufgestellt wurden. Ein abgetheilter Raum darin bildet das Schlafzimmerchen der Hausmutter. Der kleine Stadtbahnbogen enthält Küche, Waschraum und Gepäckkammer.
Am Tage müssen sich die Mädchen, nachdem sie ihr Bett ordentlich gemacht und sich angezogen haben, im großen Wartezimmer aufhalten, wo ihnen Gelegenheit zu Handarbeiten gegeben ist und wo sie auch immer etwas passende Lektüre finden.
Für das Quartier zahlen die Mädchen pro Tag 25 Pfennig, für Kaffee nebst zwei Brötchen 10 Pfennig, für Mittagessen 15 Pfennig etc.
So gering diese Preise auch gestellt sind, so kommen doch sehr oft Mädchen an, denen nach Zahlung des Eisenbahnfahrgeldes auch nicht ein Pfennig in der Kasse geblieben ist. In solchen Fällen erfüllt das Haus recht eigentlich seine Aufgabe, indem es solchen Hilflosen Wohnung, Nahrung und Schutz gewährt! Selbstverständlich ist ein Stellenvermittelungsbureau damit verbunden, in welchem sich bis jetzt fast auf jedes Mädchen 10 Herrschaften gemeldet haben. Somit findet die Mehrzahl der Passanten leicht einen Dienst und ist im Stande, die erwachsenen Kosten sogleich zu decken.
Welches Bedürfniß eine solche Herberge war, beweist wohl am besten der Zudrang, denn es haben in den ersten dreiviertel Jahren seit der Eröffnung „schon über 1000 Mädchen Quartier und Stellen gefunden“.
Da nun bei den obengenannten Preisen gerade nur die Kosten gedeckt werden, so ist es leicht begreiflich, daß durch die Kömpletirung der ganzen Einrichtung – es müssen nothwendig noch 12 Betten angeschafft werden – der Verein in sehr bedrängten finanziellen Verhältnissen ist, zu deren Erleichterung beizutragen vielleicht irgend ein edler Menschenfreund sich veranlaßt fühlt. Wenn ich aus den vielen Fällen nur zwei herausgreife und dieselben wahrheitsgetreu erzähle, so mag daraus erhellen, was in dem großen Treiben der Hauptstadt vor sich geht und welchen Gefahren ein Unkundiger und Unbemittelter trotz unserer trefflichen Polizei doch immer noch ausgesetzt ist.
Ein polnisches Mädchen, das kaum einige deutsche Worte sprechen kann, kommt vorigen Sommer mit ihrem Bündelchen nach Berlin, um sich einen Dienst zu suchen. Wenige Nickelstücke sind nur noch in ihrer Tasche. So tritt sie aus dem Bahnhof, sich verwundert umschauend. Ein Droschkenkutscher fragt sie, ob sie fahren wolle, und sie nimmt erfreut das vermeintlich gütige Anerbieten des fremden Herrn an und steigt ein. Auf die Frage des Kutschers, wohin sie wolle, antwortete sie: „In Stadt fahren.“ Die Droschke wird also gerade in die Stadt hineingelenkt. Als die Insassin aber auch hier keinen näheren Bestimmungsort angehen kann, wird es dem braven Rosselenker doch etwas unheimlich, er ersucht das Mädchen auszusteigen und seine Tour zu bezahlen. So schnell versteht man sich aber gegenseitig nicht. Während der
[233][234] Unterhandlung tritt ein menschenfreundlicher Briefträger heran und räth der Polin, der allmählich ein Verständniß über die Hilflosigkeit ihrer Lage aufgeht, das nahe Mägdehaus aufzusuchen, dann wäre sie gut aufgehoben. Und so geschieht es.
Und da steht sie nun, verlegen den Fußboden betrachtend, so bestäubt, daß ihre Gesichtsfarbe nicht zu erkennen ist. Der matte Blick scheint Hunger und Erschöpfung anzudeuten. Der erwähnte Herr Reischel, dessen Interesse bei der Arbeit gewachsen ist, sodaß er bis heute nicht nur die Oberleitung des Ganzen, sondern auch die Stellenvermittelung übernommeu hat, betrachtet sie aufmerksam und erkennt sofort die Situation.
„Bringen Sie das Mädcheu in den Waschraum, und wenn sie gesäubert ist, geben Sie ihr Kaffee und Brot!“ beordert er die Hausmutter.
Das Wort Kaffee scheint der Polin ein bekannter und lieber Trunk zu sein. Ein Freudenschimmer fliegt über ihr Gesicht und schnell thut sie, was ihr geheißen. Nachdem sie, nun gestärkt und mit sauberem Antlitz wieder erscheint, wird sie nach ihren Legitimationspapieren gefragt. Sie hat keine. Wo ist sie ortsangehörig? Sie kann gar nicht begreifen was damit gemeint ist.
„Nun, das werden wir schließlich auch noch herausbringen,“ meint der Vorsteher. Ist er doch schon gewohnt, für die Mädchen mit den Ortsbehörden zu verhandeln und nach endlosem Hin und Her seinen Zweck zu erreichen.
Unsere Polin findet bereits am andern Tage einen passenden Dienst, bezahlt ihre Schulden von dem Miethsthaler, und da sie ein kräftiges, fleißiges Mädchen ist, so findet sie ihr Brot, wie tausend Andere.
Ein zweiter Fall. Eine große, stattliche Münchnerin kommt Ende Juni vorigen Jahres nach Berlin, gleichfalls fremd, gleichfalls eine Stelle suchend. Als sie auf dem Bahnhofe umherschaut, wo sie wohl ihr Gepäck findet, gedenkt sie ihres Portemonnaies, das sie unvorsichtiger Weise in der Regenmanteltasche gehabt hat. Sie will es in die Hand nehmen, – es ist fort! – Ohne einen Pfennig steht sie nun da. Glücklicher Weise hat sie noch ihren Gepäckschein. Sie bekommt ihr Packet ausgeliefert und tritt nun äußerst bedrückt auf die Straße hinaus, als es gerade zu regnen beginnt. Zagend geht sie einige Schritte, als ein anständig gekleideter Herr mit einem Schirm an sie herantritt. Er fragt, ob sie hier fremd sei, ob er sie beschirmen dürfe und ihr sonst helfen könne?
Dem armen Mädchen erscheint es sehr tröstlich, daß sich Jemand ihrer annimmt; sie klagt ihr Leid, der Herr bedauert sie und verspricht, für ein Unterkommen zu sorgen, wenn sie ihm folgen wolle. Arglos geht sie mit. Nach wenigen Minuten tritt ein Mann rasch auf den Begleiter des Mädchens zu und ruft ihm barsch und drohend entgegen:
„Wie kommen Sie zu dem Mädchen? Wollen Sie mal gleich Ihrer Wege gehen und das Mädchen allein lassen!“
Eiligst entfernt sich der Beschützer; zitternd und aufs Höchste geängstigt steht unsere Münchnerin nun da, als der Neuankömmling erklärend sagt:
„Ich bin Kriminalbeamter, und jener Mensch ist einer unserer gefährlichsten Bauernfänger. Wie kommen Sie zu ihm?“
Weinend wird nun auch ihm das Leid geklagt, und der brave Polizist meint:
„Seien Sie froh, daß ich gerade des Wegs kam, sonst wären Sie verloren gewesen.“
Was nun beginnen in der großen, so gefährlichen Stadt?
„Gehen Sie ins Mägdehaus; man wird sich dort schon Ihrer annehmen,“ räth der Wächter der öffentlichen Ordnung freundlich. Und so geschah es denn auch. Das Mädchen merkte bald, daß sie dort von wohlmeinenden ehrlichen Leuten umgeben war, und söhnte sich schnell mit dem argen Berlin aus, als sie in kurzer Zeit einen Dienst erhielt.
Diese beiden Beispiele unter vielen ähnlichen mögen erläutern, wodurch das Mägdehaus sich von anderen gewöhnlichen Herbergen unterscheidet. Seine rothen Warnungstafeln auf vielen nord- und mitteldeutschen Bahnhöfen und in den Waggons vierter Klasse führen immer neue Gäste herbei. Möchte sich auch in gleichem Maße die Gunst und thätige Theilnahme der Edeldenkenden und Wohlhabenden einem Verein zuwenden, der so patriotische und ideale Zwecke verfolgt, wie der „Verein zur Hebung der öffentlichen Sicherheit“, dessen Vorsitzender, Dr. Otto von Leixner in Berlin, zur Empfangnahme von Spenden wie zu jeder Auskunftsertheilung bereit ist.
Unter der Ehrenpforte.
(Fortsetzung.)
Jungfer Rosine Külwetter wirthschaftete selbander mit einer Magd des Hauses in der großen Vorrathskammer hinter der Küche herum. Die Borde an den Wänden wurden geleert und dann abgestäubt und abgewaschen, denn in den letzten Tagen war Obst eingekocht worden und nun sollten hier die vielen frisch gefüllten Töpfe und Gläser – mit Vorrath bis auf den nächsten Herbst hin – ihren Einzug halten. Jedermann lobte es, daß Frau Külwetter die einzige Tochter allenthalben im Hause zugreifen ließ; schon als halbwüchsiges Mädchen war Rosine wenigstens eine scharfe Aufseherin des Gesindes gewesen, und ihre Mutter sagte wohl im Vertrauen: „Die Rosine paßt auf wie der Satan – die sieht es eher wie ich, wenn einmal zu viel draufgeht. Ich kann ruhig fort gehen, sobald ich die im Hause lasse ... Ihr solltet nur hören, Gevatterin, wie sie rapportirt, wenn ich nach Hause komme. Ja, ja – was ein Häkchen werden will – schon wie sie so hoch war“ – mit einer Handbewegung etwa drei Fuß über dem Boden – „hat sie angefangen.“
Den Mägden war die Wachsamkeit – um nicht zu sagen die Aufpasserei – Rosinens natürlich nicht eben so angenehm wie ihrer Mutter; sie wußten derselben aber nach und nach in ihrer Weise zu begegnen. „Der Jungfer, der muß man nur immer tüchtig um den Bart gehen und ihr sagen, was sie gerne hört,“ meinte eine von ihnen, eine verschmitzte Dorfdirne aus der Umgegend der Stadt. „Ich werde ganz gut mit ihr fertig, ich kenne sie. Bei der Arbeit thut sie, als wolle sie Bäume umreißen, aber sie macht sich doch nicht gerne die Finger naß.“
Natürlich brachten jene wirthschaftlichen Grundsätze ihrer Mutter Rosinen in sehr nahe Berührung mit dem Gesinde. Sie war zwischen den Mägden aufgewachsen und hatte an diesem Umgang von jeher Gefallen gefunden.
Auch heute ließen es sich jene Beiden, Rosine und das schon erwähnte Landmädchen, die Gertrud mit dem dicken rothen Gesicht und den kleinen Augen, recht wohl mit einander sein. Rosine that sich augenscheinlich bei der Arbeit nicht weh; sie hantirte in der Nähe des kleinen Fensters, welches, obwohl mit einem Drahtgitter versehen, doch einen Ausblick auf den Marktplatz gewährte, und da gab es fortwährend etwas zu beobachten.
„Laßt nur, Rosinchen, das mache ich schon allein,“ sagte die Magd jetzt zuthunlich, als Rosine mit einem kleinen Seufzer sich den Schemel zurecht rückte, um das oberste Sims mit ihrem Wischtuch erreichen zu können. Sie stieg hinauf und benutzte die Gelegenheit, hin und wieder einen Blick auf die Straße zu werfen, bis Rosine ihr das „Gaffen“ ziemlich mürrisch verwies. Aber Gertrud wußte sich zu helfen. „Mir war als säh ich – ja wahrhaftig, er ist’s, Rosinchen ... der Herr Georg – eben geht er über den Markt ...“
„Kommt er hierher?“ fragte Rosine, der schon die Rothe ins Gesicht gestiegen war.
„Er hat noch Einen bei sich ... den jungen Veit ... Da bleiben sie stehen und wollen Abschied von einander nehmen ... nein ... sie wenden um ... sie gehen zusammen die obere Gasse hinunter. Das garstige Mannsvolk ... Den Weg in den Rathskeller wissen sie immer zu finden – denn ich wette, von dort kommen sie eben! Er hätte sich wohl einmal wieder hier zeigen können!“
Rosine hatte mit einem Anschein von Gleichgültigkeit gegen einen Tisch gelehnt gestanden, die runden Arme übereinander [235] geschlagen. Jetzt aber richtete sie sich in die Höhe und stampfte mit dem Fuße auf, während ihr volles frisches Gesicht sich auffallend verdunkelte. Gertrud kam von ihrem Schemel herunter und trat näher. „Die Liese, das dumme Ding“ – eine Magd aus dem Nachbarhause – „meinte neulich, für Einen, der die Haustochter heirathen solle, mache sich der junge Herr doch auch gar so rar hier“ – sagte sie lauernd. „Und so ganz Unrecht hat sie nicht, Rosinchen.“
Rosinens große blaue Augen füllten sich bei diesen Worten mit zornigen Thränen, und sie ballte die Hände, ein Zeichen, daß ihre schwerfällige Natur, was diesen Punkt betraf, schon längst zur Empfindlichkeit aufgerüttelt war. „Er soll es mir noch entgelten,“ murmelte sie. „Wenn der öffentliche Verspruch nur erst gewesen ist ...“
An Meinungsverschiedenheit über die Mitgift konnte die Verzögerung nicht liegen. Rosine wußte aus gelegentlichen Aeußerungen ihres Vaters wie ihrer Mutter recht wohl, daß Ersterer Willens war, in Betreff ihrer Mitgift dem Bürgermeister weiter als irgend einem anderen Schwiegervater, der etwa in Betracht zu ziehen wäre, entgegen zu kommen. An den Külwetters lag es nicht, daß die Sache noch nicht weiter gediehen war. Und was die Bürgermeisterin betraf, so betrieb diese die Heirath, welche die beiden Familien verbinden sollte, schon seit Jahren, während ihr gestrenger Eheherr sich derselben wenigstens niemals abgeneigt gezeigt und unsere hübsche Rosine in der letzten Zeit mit unzweifelhaftem schwiegerväterlichen Wohlwollen behandelt hatte.
An wem also lag es, daß man noch nicht weiter war – von wem ging der geheime hemmende Einfluß aus? – Rosine, mit einem geringen Maße von Phantasie begabt, deren Einfluß die meisten Menschen in ihren Beobachtungen zu stören pflegt, und außerdem mit dem kräftigsten Egoismus ausgerüstet, sah vermöge dieser Eigenschaften in allem, was ihre eigenen Angelegenheiten betraf, weit schärfer, als es ihre Geistesgaben sonst vielleicht hätten vermuthen lassen. Und deßhalb irrte sich Georg, wenn er glaubte, Rosine Külwetter sei ganz zufriedeu mit ihm. War er zugegen und bezeigte sich galant und vertraulich, dann nutzte sie ihren heimlichen Groll aus, indem sie ihn reizte und beschäftigte und endlich dahin brachte, daß sein verwandtschaftlicher Abschiedskuß so feurig wurde, wie selbst sie es verlangen konnte. In seiner Abwesenheit aber konnte sie ihn beinahe hassen, noch viel mehr aber alles dasjenige, was, wie sie argwöhnte, ihn heimlich nach einer andern Seite hinzog und zu einem so säumigen Bewerber machte.
Jetzt preßte Rosine die frischen Lippen zusammen, und zwischen den Brauen grub sich eine tiefe Falte ein, wodurch sie so bitterböse aussehen konnte, wie es einem hellen Mädchengesicht nur selten möglich ist. Gleich darauf aber gab sie jeden Zwang auf und brach in lautes Weinen aus.
„Da haben wir’s,“ sagte Gertrud ... „der schlechte Mensch! Ich wußte wohl, daß Ihr schon lange was auf dem Herzen hattet, Rosinchen. Nur heraus damit ... macht Euch Luft!“
Zu einer Herzensergießung in Worten schien jedoch bei Rosinen noch kein übergroßes Bedürfniß vorhanden; sie fuhr nur fort, mit verzogenem Gesicht zu schluchzen, und stampfte gelegentlich mit dem Fuße. Jene sprach weiter:
„Man sollte es nicht für möglich halten. Eine Bürgerstochter wie Ihr ... ein Gesicht wie Milch und Blut, und alle Schränke voll – und da weiß der Herr nicht, ob er auch zugreifen soll, oder erst noch –“
„Das machen die wälschen Liebschaften,“ fuhr Rosine leidenschaftlich heraus. „Wäre er in Gottes Namen dort geblieben, anstatt uns hier zum Narren zu halten! Wer weiß, an was für eine schwarze Hexe er sich dorten gehängt hat. Ich wollte nur, ich dürfte so Einer einmal an das Gesicht“ – und Rosine spreizte kampfbereit alle zehn Finger ihrer kurzen, derben Hände aus – „oder ich könnte ihr ’was ins Waschwasser schütten –“
„Da braucht Ihr vielleicht nicht bis nach Wälschland zu gehen,“ stieß Gertrud heraus, dann aber schwieg sie mit einem Gesicht, als habe sie schon viel zu viel gesagt. Rosinens Thränen versiegten im Nu, und sie sah die Magd mit funkelnden Augen und erblaßten Wangen an. Als jene nicht weiter sprach, packte Rosine sie am Arm und schüttelte sie. „Willst Du gleich reden, unverschämtes Lügending!“ rief sie zornig.
Trudchen hörte diesen Zornesausbruch ziemlich gelassen an, strebte dann aber, ihren Arm von Rosinens Griff zu befreien, indem sie sagte: „Ihr seid nicht klug, Rosinchen! Gleich laßt mich los, oder ich sage kein Wort weiter. Was hat man wohl groß für Dank davon, wenn man zu Euch hält! Da fährt sie Einem um den Kopf mit spitzen Worten wie eine Hornisse ... laßt mich gehen – es ist Zeit, daß wir hier mit der Arbeit fertig werden.“
Jetzt zog Rosine andere Saiten auf und versprach sogar dem Mädchen den Strauß künstlicher Blumen, den sie auf dem letzten Rathhaustanze am Mieder getragen hatte. „Dann legt ihn nur gleich heraus, wenn Ihr über Euer Spind geht, sonst vergeßt Ihr’s doch wieder,“ schlug Trudchen vor. „Ihr braucht freilich die Blumen nicht mehr, die für unser Einen noch wunder was für ein Staat sind. Bis Ihr wieder zum Tanze aufs Rathhaus geht, auf die Fastnacht, da seid Ihr eine Braut und tragt das Schapel mit Gold und Silber ... denn es kann dem Herrn Georg mit der langen Weberstochter ja doch nimmermehr Ernst sein ...“
Die kleine Rache gelang; Rosine zuckte zusammen, als habe sie einen Stich empfangen. „Was ist mit der Weberstochter? Gleich sagst Du mir Alles, was Du weißt,“ zischte sie.
„So gar viel ist das auch nicht,“ meinte Gertrud, „aber man muß sich doch wundern, wenn man hört, wie oft der junge Herr sich dort unten herumtreibt. Daß er so ganz stillschweigend, wie heimlich, durch das Pförtchen in der Stadtmauer hereinkommt, das habe ich selber gesehen, als ich neulich in Bürgermeisters Garten war und der alten Kathrine die Kohlbeete umgraben half. Er wurde uns gar nicht gewahr, und ich sage zur Kathrine: ‚Ist denn das nicht Euer junger Herr? wo kommt denn der her?‘ ‚Ja,‘ sagt sie, ‚das möcht’ ich auch wissen; denn da draußen, jenseit der Stadtmauer, hört ja doch die Welt auf, da liegen nur noch die Bleicherwiesen. Gestern kam er auch des Wegs, und er muß das Pförtchen geschmiert haben; das knarrte sonst, daß man’s durch den ganzen Garten hörte!‘“
Rosine starrte mit verdüstertem Gesicht vor sich hin, dann sagte sie: „Ich hörte den Vater neulich sagen, daß der Oheim Tiedemars an dem fremden Volke, den Webersleuten, einen Narren gefressen habe; – jetzt, zum Einzuge der neuen Landgräfin wollte er ihnen auch etwas zuwenden. Der Vater schalt – das hergelaufene Pack brauche den alten Bürgern auch nicht die fürstliche Gnade vor dem Munde wegzuschnappen ... aber der Oheim Tiedemars habe immer seinen eigenen Kopf. Einen von den Betbrüdern, einen Alten, sah ich neulich selber in das Bürgermeisterhaus gehen ... man kennt sie ja gleich – an der Tracht.“ Sie stampfte mit dem Fuße. „Der Oheim hört und sieht nicht vor lauter Stadtregiment – er hat den Georg wohl gar selber zu dem Volk geschickt, damit ihn die freche Dirne nur recht beschwatzen kann.“
„So, wenn ihn sein Vater hinschickt, in Geschäften, dann braucht er wohl Abends um das Haus herum zu schleichen und am Fenster zu horchen, sodaß ihn der Wächter gerade für einen Landfahrer oder gar einen Dieb aufgreifen will!“ sagte die Gertrud. „Von wem ich das habe? das hat der Barthel Küfer drüben in der Schloßgasse mit eignen Augen gesehen, ja er hat noch dem Wächter, der den Bürgermeisterssohn durchaus hat packen wollen, ein Licht aufgesteckt, mit wem sie es eigentlich zu thun hätten. Ich kam gerade dazu, wie des Barthel’s Frau es der alten Schmidtin erzählte, und die Schmidtin sagte zu mir: ‚das schwatzt Sie aber nicht weiter, Gertrud, und macht Ihrer hübschen Jungfer das Herz nicht schwer! denn das Löffeln und Poussiren wird der Georg in Wälschland ja wohl aus dem Grunde gelernt haben, und wenn sie ihn nimmt, muß sie ihn nehmen, wie er ist!‘ Aber da hör’ ich die Frau Mutter kommen, Rosinchen ... laßt Ihr mich jetzt ausschelten, wie Ihr’s gewöhnlich thut, daß wir hier noch nicht weiter sind, so erzähl’ ich Euch mein Lebtag’ nichts wieder.“
Frau Külwetter trat gleich darauf ein und traf Tochter und Magd anscheinend in voller Thätigkeit, und da ihr Rosine weismachte, daß die oberen Simse schon gereinigt seien, so fand sie außer einigen Kleinigkeiten für jetzt nichts zu tadeln, und die beiden Mädchen konnten, nachdem sie wieder den Rücken gewendet, nachholen, was sie etwa bisher versäumt hatten. „Was braucht denn das Alles immer so aus denn Grunde gemacht zu werden,“ meinte Trudchen, indem sie rasch und oberflächlich mit ihrem Tuche über die Bretter fuhr ... „Es guckt ja doch Niemand in alle Ecken ... [236] wenn die Frau nur denkt, es wäre geschehen, so ist’s ebenso gut. Es ist Euch wohl in die Glieder gefahren, Rosinchen? bleibt nur sitzen, ich werde schon alleine fertig. Aber nehmt Euch die Sache nicht allzusehr zu Herzen ... Ihr bekommt ihn ja doch – und es ist doch ein gar zu schöner Mensch … Habt Ihr ihn erst, so könnt Ihr es ihm schon ein wenig eintränken …“
Rosine erwiderte auf alles dieses kein Wort; ihre Gewohnheit von Kind auf war, wenn ihr etwas Aergerliches widerfuhr, ein eigensinniges, verstocktes Schweigen gewesen, in dem sie manchmal auf die besten Worte nicht Red’ und Antwort gab … „Sie mault,“ nannten es die Mägde, und man wußte, daß alsdann nichts mit ihr anzufangen war. Gertrud sah von der Seite zu ihrer Jungfer hinüber, wie diese auf dem Schemel saß, die etwas breiten Schultern in die Höhe gezogen, die große vorliegende Stirn geneigt, den für das volle Gesicht fast zu kleinen Mund fest zusammengepreßt und mit jener bösen dunkeln Falte zwischen den Brauen – und sie dachte: wenn der Bürgermeisterssohn die erst einmal hat, so büßt er alle seine Sünden ab – sie wird’s ihm manch liebes Mal siedend heiß machen!
Das ganze Haus hatte an diesem Tage von Rosinens böser Laune zu leiden, merkwürdiger Weise aber schien sich dieselbe bis zum Abend völlig erschöpft zu haben. Georg Tiedemars kam nach dem Abendbrot auf ein Stündchen hinüber, und Rosine war so freundlich und zuthunlich gegen den „Herrn Vetter“, so ganz verwandelt, daß man in diesem hellen, lächelnden Mädchengesicht mit den kindlich runden Wangen, vom köstlichsten Weiß und Roth angehaucht, das verdunkelte böse Antlitz von vorhin, vor Leidenschaft erblichen, gar nicht wiedererkannt hätte. Georg fühlte sich freundlich angeregt durch ihr Behaben; mit dem heimlichen Besitz seiner köstlichen Liebe im Herzen war er so schon der ganzen Welt gut. Das arme Rosinchen – wenn sie wüßte! aber ein so einfaches, harmloses Ding ahnte dergleichen nicht, und das war gut, und später – in einer Zukunft, über deren Form oder Nähe sich Georg zur Zeit noch auf keine Vorstellungen einließ – sollte ihr ja auch seine brave, trockene, bürgerliche Liebe und Treue gehören und so sicher bei ihr verharren, wie sie ihm gewiß alle Mittag ein ordentliches Essen auf den Tisch bringen und die gute Mutter kleiner draller Jörgen und Rosinen werden würde. Dazwischen aber lag für ihn noch eine Spanne – ob kurz oder lang, darauf kam es gar nicht an, dieselbe war nicht mit dem gewöhnlichen Zeitmaß zu messen – unbeschreiblichen, unbegreiflichen Glückes … eines Glückes, das trunken machte. Und in den Zauberkreis dieser Glückszeit war er gestern eingetreten!
Das war es, was seine Stimme so sanft machte, seinen Augen ein so eigenes Leuchten verlieh, als er jetzt in der Dämmerung der tiefen Stube dicht neben Rosinen auf dem hölzernen Sitze an der von den Fenstern entferntesten Wand lehnte. Die beiden Alten saßen auch im Gemache, kümmerten sich aber um die jungen Leute nicht allzuviel. Das war ja Georg’s gutes Recht, daß er nahe zu Rosinen rückte und ihr allerhand zu sagen hatte, was nicht jeder zu hören brauchte, etwa wie ihre Augen alle Tage klarer und schöner würden und daß ihr Haar eine Farbe habe, um welche die schönen Damen im Land Italia sie bitterlich beneiden könnten, und andere dergleichen Neuigkeiten, wie sie Rosine nicht ungern hörte, trotz des heimlichen Grolles, dem dadurch ein Theil der ersehnten Nahrung entzogen wurde. Aber wenn Rosinens Gefühl für Georg der Art war, daß Aerger, ja Ingrimm und Verliebtheit sehr wohl in demselben nebeneinander bestehen konnten und der eine Bestandtheil nur immer mehr Kraft aus dem andern zog, so haßte sie dagegen um so nachdrücklicher und mit ungetheilter Kraft die dreiste, abgefeimte Verführerin Georg’s, denn als etwas Anderes hätte Jungfer Rosine sich die Weberstochter nicht vorzustellen vermocht.
Das Gespräch, welches bisher nur mehr eine in halblauten Worten hin- und herspielende Tändelei der Beiden gewesen war, wendete sich jetzt auf den demnächstigen Einzug der fürstlichen Braut. Am Eingange der Schloßgasse sollte ein Ehrenbogen errichtet werden. Dort würde der Rektor der gelehrten Schule, Doktor Avenarius, die hohe Frau mit einem lateinischen Carmen begrüßen, eine nicht unpassende Anerkennung des Umstandes, daß die Dame dieser klassischen Sprache kundig war – nach dieser gediegenen und etwas umständlichen Huldigung aber sollten junge hübsche Bürgerstöchter das fürstliche Paar mit Blumenketten umwinden.
„Was meint Ihr, Georg, unter den Blumenjungfern würde sich unser Rosinchen nicht schlecht machen, wie?“ krähte hier Herr Külwetter, von seinem Lehnstuhle am Tische, dazwischen.
„Nun, wenn man die Schönsten wählt, wird man an ihr gewiß nicht vorübergehen,“ sagte Georg.
„Sie nehmen aber zunächst nur die Zunftmeisterstöchter,“ erklärte Rosine und warf die Lippen auf.
„Wie, möchtest Du denn wirklich dabei sein, Rosine?“ fragte Georg lächelnd. Er hatte sich, ihre Hand in der seinen haltend, voll zu ihr herumgewendet. Sie antwortete, nach ihrer Art, nicht gleich, hatte die Augen gesenkt und das Kinn auf die Brust geneigt. „In einer Art von öffentlicher Komödie mit zu agiren – könnte Dir das gefallen, Rosinchen?“ fragte er.
„Nun, die Frau Landgräfin, oder die es sein wird, agirt ja auch mit und ist sogar die Hauptperson dabei,“ war Rosinens keineswegs ungereimte Entgegnung.
Georg lachte. „Wenn ich nun eifersüchtig wäre und es mir nicht behagte, daß mein schönes Bäschen an einem solchen Tage aller Blicke auf sich zöge?“ sagte er, sie betrachtend, indem er mit einem ihrer Zöpfe spielte. Während ihr unter seinem Blick das Herz klopfte, war Georg sich nicht ohne Behagen der inneren Freiheit bewußt, mit der er fortfahren konnte: „Nein, verhüte Gott, daß ich Dir die Freude verderbe, Kind. Und es müßte wunderlich zugehen, wenn des Bürgermeisters liebe Anverwandte nicht bei diesem Feste ihren Platz unter den Vertreterinnen der Bürgerstöchter finden sollte, dafern ihr Sinn darnach steht. Und daß Du Dich nur schön machst – aber es ist ja noch eine ganze Weile hin bis zum Einzuge … die Gewerke haben noch vollauf zu thun bis dahin …“
„Ja, und es wird allenthalben mehr Geld vergeudet, als nöthig ist,“ meinte Herr Külwetter. „Will sich doch sogar das lumpige Volk vor dem Thore, die fremden Weberleute, mit einem Geschenk an die Herrschaft breit machen! Da begreife ich Deinen Vater nicht recht, Georg! wo er nur den fremden Betbrüdern einen Vortheil zuwenden kann, da thut er’s. Glaub’ mir nur, es wird ihm von der Bürgerschaft mehr verdacht, als er selber meint.“
„Der Vater weiß, was er thut, Vetter Külwetter,“ nickte Georg zu dem Alten hinüber … „Ich würde mir an Eurer Stelle kein graues Haar darüber wachsen lassen. Seid Ihr einmal Bürgermeister, dann probirt nur gleich das Kunststück, es einem Jeden recht zu machen.“
„Wie spitz der Junge gleich wird,“ lachte Herr Peter Külwetter vor sich hin. „Ich Bürgermeister – damit hat es gute Wege … und es hat mir auch noch nie nach der Ehre gelüstet. Zum Stadtregiment gehören studirte Herren, wie Du ja jetzt auch einer bist, Georg – und wenn ein solcher räth und betreibt, was über den gewöhnlichen Verstand geht, nun so tröstet sich der Bürger damit, daß das alles wenigstens nach den Regeln juris geschieht und daß die Stadt die Ehre, einen gelehrten Bürgermeister zu haben, sich schon was kosten lassen kann!“
Das war eine der kleinen Tücken, wie sie viel gescheitere Leute, als er selber war, zu ihrer eignen Verwunderung von dem Männchen mit dem flachgedrückten Kopfe und der spitzen Nase immer einmal hinnehmen mußten. Georg hatte keine Lust, die meist wohl durchdachten, immer aber energischen und klugen Maßregeln seines Vaters gegen den Gevatter Külwetter ferner zu vertheidigen, und ließ ihm daher das letzte Wort, um so mehr als Rosine jetzt mit schmeichelnder Stimme begann: „Der Vater kann die fremden Weber nun einmal nicht leiden. Erzähl’ Du mir ein wenig von ihnen, Georg – sie sagen ja, Du seiest so oft dort unten zu finden … Ist es denn wahr, daß sie so wunderliche Bräuche haben – mit Essen und Trinken – einen Hasen hätte einmal eine von den Frauen mit Haut und Haaren abgesotten – Gemüse wüßten sie gar nicht zu kochen, das sei ihnen hier etwas Neues gewesen, und nun brächten sie es nur in Wasser gebrüht, so daß der Kohl gallenbitter schmeckt, auf den Tisch, und, pfui Teufel, ich möchte nicht dabei sein! Hunde und Katzen ließen sie, nachdem Einer vorgebetet, um Gotteswillen mit aus der eigenen Schüssel essen.“
Rosine hatte etwas ganz Anderes sagen wollen, aber die Bosheit war gewissermaßen mit ihr durchgegangen, und jetzt fühlte sie sofort etwas wie eine Entfernung Georg’s. War er wirklich von ihr fort gerückt, hatte er nur den Zopf, mit dem er [237] die ganze Zeit getändelt, aus der Hand gleiten lassen? Er sprach auch nicht gleich, und sie blickte zu ihm auf. Wie schade, daß es schon zu dämmerig war um zu erkennen, welche harmlose Miene Rosinchen trug! „Seid Ihr mir böse, Georg?“ fragte sie leise, und ihm war, als kichere sie dabei. Es war ein Scherz von ihr gewesen, das tolle Geschwätz über die Fremden, kein sehr zarter und ganz besonders wenig nach seinem Geschmack. Aber die Gründe für den letzteren Umstand kannte Rosine glücklicher Weise nicht. „Böse?“ wiederholte Georg daher trocken. „Warum sollte ich Euch böse sein, mein hübsches Bäschen? Um solchen Unsinn wirklich zu glauben, seid Ihr viel zu klug. Uebrigens habe ich niemals mit den Weberleuten gegessen – und wenn Euch daran gelegen ist, zu wissen, ob sie ihren Kohl sauer oder süß kochen, so müßt Ihr Euch an jemand Anders wenden.“
„Wie unfreundlich Ihr sprecht!“ sagte Rosine leise, und diesmal war sie es, die wieder ein wenig näher rückte. „Was kann ich dafür, wenn sich Jedermann über die fremden Hungerleider, wie sie hier sagen, lustig macht. Die Mutter meint, man müßte sich ja vor den Nachbarn fürchten, sonst ließe sie auch einmal ein Stück dort unten weben, wenn es ihr die Leute billig arbeiteten. Aber der Weg wäre so weit. Da habe ich gesagt, den Weg machtet Ihr oft genug, sie möchte Euch doch bitten, einmal eine von den Dirnen hierher zu schicken, daß sie das Garn abholt. Nicht wahr, den Gefallen thätet Ihr uns schon, wenn Ihr wieder einmal vors Thor geht – in Geschäften?“ fügte sie auf eine Bewegung Georg’s langsamer hinzu.
„Was Du alles von unsern Geschäften weißt, Rosinchen,“ sagte Georg leichthin, aber nicht ohne ein eben aufsteigendes unbehagliches Gefühl des Argwohns. „Meine Bekanntschaft in der Weberniederlassung ist kleiner, als Du meinst. Ich kenne kein Mädchen dort, welches herum geht und die Kundschaft bedient.“
„Nun, die Lange, die Dir damals in den Graben zu Hilfe gesprungen ist,“ fuhr hier Rosine unvorsichtig mit einem harten Auflachen dazwischen. „Du glaubst nicht, wie gerne ich das Wunder einmal sähe, Georg! Sie soll ja den Weg nicht umsonst machen ... sie mag ein paar Ellen von den geflickten Borden mitbringen, über denen, wie man hört, die Weiber dort Jahr aus Jahr ein sitzen. Da kauft man ein Stück, wenn man es auch nicht nöthig hat, nur damit sie ein paar Batzen mit heim trägt.“
Rosine hatte der Versuchung nicht widerstehen können, ihrer Zunge freien Lauf zu lassen, doch kam sie für heute nicht ins Klare darüber, ob sie sich oder der Nebenbuhlerin mehr bei Georg geschadet hatte. „Ihr wendet Euch an den Unrechten, Bäschen,“ sagte Georg kalt. „Ich kann Eurer Neugierde nicht dienen – und wenn Eure Mutter die Brabanter in Arbeit setzen will, so wird ihr der Weg, fürcht’ ich, nicht zu ersparen sein. Aber es ist spät geworden ... erlaubt, daß ich Euch eine gute Nacht wünsche.“
Wer weiß, ob er sie heute geküßt hätte. Aber indem sich Beide fast zugleich erhoben, fuhr Rosine unter einem leichten Ausruf mit der Hand nach ihrem Auge. Georg’s breite Krause hatte sie gestreift. „Hab ich Euch weh gethan, Bäschen?“ fragte er, natürlich zärtlich besorgt, indem er sich über sie beugte. Rosine antwortete nicht, sondern hing den Kopf und hielt die Finger über das Auge. Georg mußte ihr mit sanfter Gewalt die Hand wegziehen, wobei er mit den Fingern die Wange streifte, die sich wirklich wie ein Rosenblatt anfühlte. Gesprochen wurde von Rosinen wohlweislich kein Wort weiter, und doch bekräftigten ihre frischen Lippen auf eine überzeugende Weise ihre Verzeihung.
Denn mit einem Kunstgriffe, der wesentlich in ihrer Natur lag, hatte es Rosine dahin gebracht, daß es schien, als habe sie etwas zu vergeben, während sie doch die Angreiferin gewesen war. Georg verließ sie besänftigt. Sie war ein kindisches, liebes Ding und plauderte nach, was sie hörte. Das garstige kleine Nest von einer Stadt mit seinem Geklatsch! Es überflog den jungen Menschen heiß bei dem Gedanken, daß sein Verhältniß zu dem Weberhause ruchbar werden und ihn dem Gespötte aussetzen könnte. Er beschloß, vorsichtiger zu sein als bisher, und ein paar Tage verstreichen zu lassen, ehe er Hilden wiederzusehen versuchte.
Unsere Genußmittel.
Die „sociale Frage“, heute wohl die brennendste von allen, ist in der Hauptsache eine Magenfrage. Ganz natürlich daher, daß Nationalökonomen wie Socialpolitiker der Nahrungsmittelfrage eine große Wichtigkeit beilegen, wobei selbstverständlich die medicinische Welt, als die befugteste Richterin über den physiologischen Werth der Nahrungsmittel, eine bedeutende Stimme hat. All dies ist aber auch ein hinreichender Grund, um der hochwichtigen Frage ein allgemeines Interesse entgegen zu bringen.
Es ist bekannt, daß der menschliche wie der thierische Körper aus einer Anzahl organischer und anorganischer Stoffe besteht, die, aufgenommen, in einem fortwährenden Wechsel sich befinden, wieder ausgeschieden werden und dann durch neue ersetzt werden müssen. Dabei genügt es aber keineswegs, die einzelnen für die Erhaltung des Körpers nöthigen Nährstoffe rein in genügender Menge und in richtigem Verhältniß einzunehmen, in den meisten Fällen müssen vielmehr zusammengesetzte Nahrungsmittel, wie sie im Thier- und Pflanzenreiche gemischt vorkommen, dem Körper zugeführt werden, nur wenige reine Nährstoffe, wie Fett, Zucker, Kochsalz, sind gleichzeitig auch Nahrungsmittel.
Aber selbst die Nahrungsmittel allein genügen zur Ernährung des Meuschen nicht, und zwar desto weniger, auf einer je höheren, verfeinerteren Stufe der Kultur derselbe fleht. So muß die Nahrung, soll sie ihren Zweck erfüllen, aus den verschiedenartigsten Nährstoffen und Nahrungsmitteln mit Hinzufügung sogenannter Reiz- oder Genußmittel gebildet werden. Die Kochkunst, und wir haben dabei nicht nur die Küche des Reichen, sondern auch die des Armen im Sinne, hat danach eine wichtige Aufgabe. Sie hat, sagt von Voit in seiner trefflichen „Physiologie der Ernährung“, nicht nur die Nahrungsstoffe in eine solche Mischung zu bringen, daß der Organismus sich dadurch auf die beste Weise stofflich erhält, sondern auch die Materialien für die Verdauung vorzubereiten und die mannigfachen Genußmittel in richtiger Art und Folge hinzuzufügen, damit die Speisen mit Lust verzehrt werden und einen guten Ablauf der Vorgänge im Darme bewirken. Zu diesem Zwecke wird das Unverdauliche entfernt und das Brauchbare gehörig zubereitet, das heißt ihm eine Form und Beschaffenheit gegeben, daß es leicht durch Verdauungssäfte angegriffen und daher die Zeit der Verdauungsarbeit abgekürzt und der Darm möglichst wenig belästigt wird. Diejenige wohlschmeckende Nahrung, welche allen Anforderungen streng genügt, das heißt welche die für einen bestimmten Fall gerade erforderliche Menge der einzelnen Nahrungsstoffe in richtiger Mischung zuführt und dabei den Körper so wenig als möglich belästigt und abnützt, ist für diesen Fall die richtige Nahrung oder das Ideal der Nahrung.
„Der Mensch lebt nicht von Brot allein“. Dieses alte Sprichwort hat auch seine physiologische Begründung, und nicht ein Luxus ist es, noch mehr zu verlangen, sondern ein nicht abzuweisendes Bedürfniß des Organismus. Der Mensch müßte zu Grunde gehen, wenn seine Nahrung auf Eiweiß, Fett, Stärkemehl, Wasser und Aschebestandtheile beschränkt würde, auf jene Stoffe, die allerdings die Zusammensetzung des Körpers ausmachen, aber niemals allein genügen würden, denselben zu bilden. „Zur Aufnahme und Verdauung der Nahrung gehört mehr, als ein einfaches Verschlucken der zur Erhaltung des Lebens nöthigen Stoffe; wie jede Thätigkeit des Körpers muß auch das Geschäft der Aufnahme der Speise mit einer angenehmen Empfindung verknüpft sein.“ Für jede Funktion unseres Organismus bedarf es einer Anregung, eines Reizes, und wie für die höheren Sinne das Schöne, so ist für die niederen das Angenehme Bedürfniß, um anregend, reizend zu wirken.
Derartige Anreger für die Verdauung und Ernährung sind nun die sogenannten Genußmittel; sie dienen nicht unmittelbar zur Bildung des Körpers, sie sind keine Gewebe bildenden Stoffe, wie die Nährstoffe, jedoch von nicht geringerer Bedeutung und ebenso nöthig zur Erhaltung des Körpers wie diese. Man hat in einem sehr treffenden Vergleiche die Wirkung der Genußmittel mit der der Schmiere an den Maschinen verglichen aus der weder die Maschinentheile hergestellt sind, noch die Kraft für die Bewegung derselben abstammt, die aber den Gang leichter gestaltet. Oder man verglich sie mit der Peitsche, welche das arbeitende Pferd zu größeren Leistungen anspornt, ohne ihm eine Kraft mitzutheilen. Auf eine solche Weise leisten auch die Genußmittel für die Ernährung und für andere Vorgänge im Körper wichtige und unentbehrliche Dienste; sie geben uns nicht wirkliche Kraft, sondern nur das Gefühl von Kraft durch die Einwirkung auf das Nervensystem.
Solche Genußmittel finden sich nun theils natürlich in geringen Mengen den Nahrungsmitteln beigemengt, theils können sie denselben künstlich hinzugefügt, theils aber auch selbständig genossen werden, wie Kaffee, Thee, Kakao, Tabak, Wein, Bier, Branntwein u. dergl. m. Wenn auch die letzterwähnte Klasse in gewisser Beziehung zu den Luxusgegenständen zählt, die wohl entbehrt werden können, so kann man dies doch keineswegs von den erstgenannten Genußmitteln behaupten, für welche das wohlbegründete Urtheil über jene zu einem unberechtigten Vorurtheil geworden ist. „Eine Speise ohne Genußmittel,“ bemerkt von Voit sehr richtig, „ein geschmackloses oder uns nicht schmeckendes Gericht wird nicht ertragen, es bringt Erbrechen und Diarrhöen hervor. Die Genußmittel machen die Nahrungsstoffe erst zu einer Nahrung; nur ein gewaltiger Hunger steigert die Begierde so sehr, daß die Genußmittel übersehen werden, ja daß sonst Ekelhaftes angenehm erscheint.“
Zu einem der einfachsten und besten Genußmittel gehört nun eine starke und warme Fleischbrühe. Dieselbe bereitet, wie von Voit ganz treffend bemerkt, nachdem sie zuerst durch die schmeckenden und riechenden Extraktivstoffe Geschmacksempfindungen hervorgerufen hat, den Magen Gesunder wie Kranker auf die mildeste Weise für das Verdauungsgeschäft vor: die Rekonvalescenten würden die gewöhnlichen Speisen nicht ertragen, wenn ihr Magen nicht vorher für die Absonderung von Saft und die Aufsaugung wieder eingerichtet worden wäre. Die Fleischbrühe hat aber auch allgemein belebende Wirkungen, sie regt nämlich auch die Herzthätigkeit an und macht die Herzschläge zahlreicher und stärker, in Folge davon auch den Blutumlauf lebendiger. Die vortreffliche Wirkung einer guten Fleischbrühe ist durch tauseudfältige Erfahrung seit Langem vollkommen sichergestellt, sie läßt sich nicht bestreiten; täglich erkennen wir ihren Werth, besonders an der Erquickung, die sie dem schwachen Rekonvalescenten oder dem müden Wanderer bringt. Dieser Werth wird dadurch, daß man Fleischbrühe nicht zu den Nahrungsmitteln, sondern zu den Genußmitteln zählt, nicht im Mindesten geschmälert.
Nicht nur dem Bauer, wie Heinrich IV. von Frankreich wollte, sondern einem Jeden wäre daher sonntägig ein Huhn zu einer guten Fleischbrühe im Topfe zu wünschen. Wie so vieles Andere würde auch dies für alle Zeiten ein frommer Wunsch bleiben, wenn nicht die Wissenschaft, so oft als ideal und nutzlos verschrieen und gerade von denen, welchen sie die größten Wohlthaten erweist, auch hier Helferin in der Noth wäre.
Die durch Liebig bewirkte Herstellung des Fleischextraktes war eine der Menschheit bewiesene Wohlthat, wenn auch der große Chemiker von seiner ursprünglichen Ansicht, ein „Nahrungsmittel“ hergestellt zu haben, wieder zurückkommen mußte, weßhalb aber die Erfindung nichts an ihrem Werthe verliert. Sie ist ein Genußmittel, bestehend aus den Extraktivstoffen und in Wasser löslichen unorganischen Salzen des Fleisches, welche eigentlich nichts Anderes, denn eine verdichtete Fleischbrühe bilden.
Es ist ein Triumph der deutschen Wissenschaft wie der Industrie, die ungezählten Rinderheerden der neuen Welt der alten dienstbar gemacht zu haben. Wenn irgendwo die Menschheit für eine geleistete Wohlthat nicht undankbar gewesen ist, so ist es hier der Fall, sie hat den Werth der Gabe erkannt und sich nicht ablehnend gegen dieselbe verhalten, sondern dieselbe zu würdigen verstanden, wie die Millionen Kilo von Fleischextrakt beweisen, die alljährlich verbraucht werden, sodaß sich eine besondere Küche darauf gegründet hat. Nicht nur für Zucht- und Arbeitshäuser, für Versorgungsanstalten und Krankenhäuser ist das Fleischextrakt von unschätzbarem Gewinn, sondern auch für jeden Haushalt, und gar manche Familie müßte der Fleischbrühsuppe entbehren, wenn sie dieselbe nicht durch Liebig’s Extrakt, das auf die Erfindung von Parmentier und Proust zurückzuführen ist, auf so billige und bequeme Weise herstellen könnte.
[239] Wenn auch Liebig vorzugsweise die Anregung zur Bereitung des Fleischextraktes, das nach ihm benannt worden ist, gegeben hat, so hat doch eigentlich die That der Herstellung im Großen die Begründung einer eigenen Industrie, ein anderer Deutscher, Giebert, vollbracht. Was aber deutsches Geisteskapital geschaffen, damit haben vorzugsweise fremde Hände gearbeitet und den Gewinn davon in ihre Tasche gesteckt. Das Werk, zu dem deutsche Gelehrsamkeit die Anregung gegeben, das deutsche Arbeitskraft ausgeführt, haben Ausländer sich angeeignet und in der „Liebig Extract of meat Company“ in Fray Bentos in Uruguay sich zu Nutzen gemacht.
Aber deutsche Umsicht und Einsicht, deutsches Wissen und deutsche Thatkraft sind im Begriff, das Verlorene zurückzugewinnen, und haben bereits ein gut Theil sich wieder angeeignet, nicht allein zum Vortheil des deutschen Kapitales, sondern auch zu Nutz und Frommen der Konsumenten. Ein tüchtiger deutscher Gelehrter, gegenwärtig der gründlichste Kenner der Fleischextraktbereitung, der erfahrenste Praktiker auf dem betreffenden Gebiete, Professor Kemmerich in Santa Elena in Argentinien, hoch geachtet vom verstorbenen Liebig und einstmals auf dessen Empfehlung mit der chemischen Leitung der Fabrik in Fray Bentos betraut, hat die Industrie der Fleischextraktbereitung in der erfreulichsten Weise weiterentwickelt, nachdem er sich zuvor schon die vollste Zufriedenheit seines Lehrers erworben hat, wie aus Liebig's eigenem Munde hervorgeht, der sich in zahlreichen Briefen anerkennend über Kemmerich’s Arbeiten auf dem betreffenden Gebiete geäußert hat.
Liebig’s großer Name hatte das Fleischextrakt mit einem solchen Heiligenscheine umkleidet, daß man es für durchaus vollkommen wähnte, jeder Verbesserung überhoben. Trotz dieses fast unbesiegbaren Vorurtheiles hat Kemmerich den Muth gehabt, der übertriebenen Einbildung entgegenzutreten und den Wahn gründlich zu zerstören. Als erste lebende Autorität auf dem Gebiete der Fleischextraktbereitung hat er, von einer deutschen Gesellschaft dazu in den Stand gesetzt, mit durchweg neuen von ihm verbesserten Maschinen in einer der Fabrik von Fray Bentos in jeder Beziehung ebenbürtigen Anlage zu Santa Elena am Paraná in Argentinien den Beweis geliefert, daß man unter Benutzung der in zwanzig Jahren gesammelten reichen Erfahrungen noch etwas viel Vollkommeneres an Gehalt und Geschmack herstellen kann, als es nach der alten Methode möglich war.
Hoffen wir aber, daß man, trotz des bis jetzt Erreichten, doch noch nicht glauben möge, damit genug gethan zu haben, und daß man auf der Bahn des Fortschrittes wie bisher fortfahren möge, um ein noch besseres und billigeres Produkt herzustellen. Dr. O.
Blätter und Blüthen.
Die Korvette „Alexandrine“, welche am 7. Februar d. J. zu Kiel vom Stapel gelassen wurde, gehört dem neueren Schiffstypus an, der den Namen der verbesserten eisernen Glattdeckkorvetten trägt und der erst seit einigen Jahren in der deutschen Kriegsmarine eingeführt wurde. Die gewaltigen Panzerkolosse, welche die Hauptstärke unserer Kriegsflotte bilden, stehen in der Geschwindigkeit den Kreuzerschiffen anderer Nationen und den großen Handelsdampfern so sehr nach, daß sich Ende der siebziger Jahre das dringende Bedürfniß herausgestellt hat, unsere Seemacht durch neue Fahrzeuge zu verstärken, die mit anderen Flotten nach der genannten Richtung hin zu rivalisiren vermöchten. Zu diesem Zwecke erbaute man im Jahre 1880 die Glattdeckkorvetten „Carola“ und „Olga“, und dann die Korvetten „Marie“ und „Sophie“, die im Jahre 1881 den Stapel verließen. Die sorgfältige Beobachtung der Leistungsfähigkeit dieser Schiffe auf ihren Fahrten wies jedoch einige Unvollkommenheiten in der Konstruktion nach, die nunmehr bei der Korvette „Alexandrine“ beseitigt werden sollten. Die Schiffe dieser Klasse sind aus bestem Eisen, zum Theil aus Bessemerstahl gebaut und mit ostindischem Teakholz bekleidet. Ihre Maschinen haben 2400 Pferdekräfte, und ihre Schrauben sind zum Aufwinden eingerichtet, sodaß dieselben bei günstigem Wetter außer Dienst gestellt werden können. Jedes der Schiffe führt zwölf 15 Cmtr.-Geschütze, die sämmtlich auf dem Deck placirt sind. – k.
Der Kinder Osterfest. (Mit Illustration S. 233.) Wie Weihnachten, so ist auch Ostern ein Freudenfest für die Jugend geworden, welche an beiden Tagen Geschenke einheimst. Bekommen im Norden unseres Vaterlandes am ersten Ostertage die Kinder, wenn sie in der Frühe mit ihren vorher im Zimmer mühsam zum Grünen gebrachten Birkenreisern zu Bekannten „schmackostern (mit den Ruthen die womöglich im Bette Ueberraschten schlagen) gehen, ihren Lohn in gefärbten oder süßen Ostereiern, Zuckerlämmchen u. dergl., so bringt im Süden der „Osterhase“ seine reichen Gaben unaufgefordert ins Haus. Welch ein Jubel herrscht in der kleinen Welt, wenn die sorgfältig versteckten Ostereier gefunden werden, wie glücklich wird der süße Osterhase oder das Osterlamm mit seiner Kreuzesfahne und dem Heiligenscheine an das pochende Kinderherz gedrückt, wie stolz werden gegenseitig die Schätze gezeigt und ausgetauscht, und wie geschickt, wie verschmitzt versteht es mancher, beim „Klopfen“ mit der Spitze seines Eies das des Gegners zu zerbrechen, letzteres dann als Gewinn einsackend. Ja, Osterzeit fröhliche Zeit, und wenn die Weidenkätzchen, die „Palmen“ der Kinder, ihr silbergraues Sammetkleid angelegt haben, dann erschallt auch bald die echte Schalmei des Frühlings, die Weidenpfeife, mit ihren jubelnden Tönen in Wiese und Busch, dann ist der Winter geschlagen, dann feiert die Natur Auferstehung. – r.
Was soll der Junge werden? Diese Frage tritt besonders zu Ostern an viele Eltern heran, wo nach der Konfirmation die Wahl des Berufes der Söhne entschieden sein muß. So weit es sich hier in erster Linie um die gewerblichen Berufsarten handelt, wird die Beantwortung der genannten Frage durch zwei neuerschienene Bücher zu erleichtern gesucht, die deßhalb nicht wenigen Eltern und Vormündern willkommen sein dürften. „Was soll der Junge werden? Ein Rathgeber von A. von Fragstein“ (Berlin, L. Oehmigke’s Verlag) ist der Titel des einen, „Die Berufswahl unserer Söhne. Von Ernst Rudolph“ (Wittenberg, R. Herosé) derjenige des andern Werkchens. In beiden wird nicht nur die Frage erörtert: was soll der Junge werden? sondern es wird auch gefragt: was kann und was will er werden? In zahlreichen Abschnitten gelangen dann die einzelnen Berufsarten zur Besprechung, deren besondere Vorzüge oder Nachtheile in objektiver Beleuchtung hervorgehoben werden. Das Fragstein’sche Buch ist namentlich Allen, denen für die Berufswahl nur noch kurze Zeit zur Verfügung steht, zu empfehlen, während das Rudolph’sche besonders dort am Platze ist, wo die Wahl eines Berufes durch Schule und häusliche Erziehung langer Hand vorbereitet wird.
Diesen beiden Werken schließt sich ein älteres bewährtes Buch „Die Berufswahl im Staatsdienste“ von A. Dreger (Leipzig, C. A. Koch’s Verlagshandlung [J. Sengbusch]) an. Dasselbe bietet eine Zusammenstellung der wichtigsten Vorschriften über Annahme, Ausbildung, Prüfung, Anstellung und Beförderung in sämmtlichen Zweigen des Reichs- und Staats-, des Militär- und Marinedienstes dar, sowie die Vorschriften über die wissenschaftlichen Erfordernisse, die Ausbildung und Prüfung der
[240] Aerzte, Apotheker, Thierärzte und Zahnärzte, als auch der Maschinisten und Steuerleute in der Handelsmarine. – Alle drei Bücher werden einen willkommenen und nothwendigen Rathgeber für alle die Eltern bieten, welche vor die Entscheidung der obigen Frage gestellt sind. – th.
Theodor von Frerichs. †. Die Berliner Universität hat den Verlust einer ihrer stolzesten Zierden, die deutsche Medicin den Verlust einer ihrer größten Autoritäten zu beklagen. Der berühmte Arzt, der so viele Opfer dem frühzeitigen Tode entrissen, ist selbst von dem unerbittlichen Schicksal ereilt worden: Theodor von Frerichs ist am 14. März an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Freilich hat er ein hohes Alter erreicht, in dem die Todesstunde den Meisten zu schlagen pflegt, und doch erschien Vielen die Trauerkunde unverhofft, denn Frerichs stand noch auf dem Gipfel seines Wirkens und Schaffens. Erst im vorigen Jahre feierte er das fünfundzwanzigjährige Jubiläum seiner akademischen Lehrthätigkeit, und kaum drei Jahre sind verflossen, da er den Kongreß für innere Medicin zum ersten Male nach Wiesbaden berief und den Aerzten einen neuen segensreichen Mittelpunkt zum Austausche ihrer Erfahrungen und Kenntnisse schuf.
Am 24. März 1819 zu Aurich geboren, widmete Frerichs sich in Göttingen und Berlin medicinischen Studien, und nachdem er die weite Welt bereist hatte, um seine Kenntnisse zu erweitern, habilitirte er sich zunächst als Privatdocent in Göttingen. Von hier folgte er einem Rufe nach Kiel und ging im Jahre 1851 nach Berlin, wo er als Professor der Pathologie und Kliniker bald die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt auf sich lenkte. Nach Schönlein’s Tode wurde ihm in Berlin die Professur für innere Medicin und die Direktion der Charité im Jahre 1859 übertragen. In dieser Zeit entstand sein bedeutendstes Werk „Klinik der Leberkrankheiten“, welches sofort in mehrere fremde Sprachen übersetzt wurde und seinen Ruf auch im Auslande begründete. Tausende von Kranken aus aller Herren Ländern suchten bei Frerichs Rath und Hilfe, und er war ein wahrer Wohlthäter der Menschheit, dem für lange Zeiten in den Herzen Vieler ein dankbares Andenken gesichert bleibt. – i.
Spaziergang vor dem Thor. (Mit Illustration S. 229.) Wer möchte es wagen, dieses lebensvolle Bild besser erklären zu wollen, als der Dichter es gethan, dessen Gestalten der Künstler uns vorführt? Uns erfreut der Anblick des Kunstwerkes um so mehr, je mehr der lieben alten Bekannten aus Goethe’s herrlicher Dichtung wir in der bunten Menge begegnen. Goethe’s Meisterschaft in der Behandlung des Volkslebens hat das Erquicklichste in jener Scene des Faust geschaffen, die er „Vor dem Thor“ überschreibt und deren Gesammtbild er den Faust in den Versen schildern läßt:
„Aus dem hohlen, finsteren Thor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern;
Sie feiern die Auferstehung des Herrn;
Denn sie sind selber auferstanden,
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern – –
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern – –
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht. – –
Ich höre schon des Dorfes Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet Groß und Klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“
Und sehen wir uns in der Menge der Spaziergänger um, so erkennen wir sofort die schmucken „Bürgermädchen“, denen der eine „Schüler“ zustrebt, auf die „Mägde“ zürnend, denen der andere der „schönen Knaben“ nachläuft. Die Kinder jubeln den stattlichen „Bürgern“ voraus, die über „Krieg“ und möglichst fernes „Kriegsgeschrei“ politisiren. Und dies Alles zeigt Faust seinem pedantischen Wagner, dem der Ausdruck der Volksfreude ein „verhaßter Klang“ ist.
Wie tief hat Goethe in die deutsche Volksseele geblickt und welche Schätze aus diesem ewig frischen Born gehoben! Wenn erst dieses Volk selbst ihn kennen und schätzen gelernt hat, wird die Volksbildung einen großen Schritt vorwärts gethan haben. F. H.
Die Kosmetik des elektrischen Lichtes. Die Damenwelt, welche das Sonnenlicht haßt, da es das Gesicht mit kräftigen Farben „verunstaltet“ und den zarten rosenrothen Anflug der weißen Wangen durch bäuerliches Roth ersetzt, wird wohl dem elektrischen Lichte ewige Feindschaft schwören, wenn sie erfährt, daß dieses in der kosmetischen Wirkung sogar der Sonne über ist. Die Gelehrten haben es ja entdeckt: schon das Licht einer elektrischen Lampe, dessen Stärke nur 1000 bis 2000 Kerzen beträgt, verändert unsre Gesichtsfarbe nach einer Stunde, und Lampen von 10000 bis 20000 Kerzen sollen in kurzer Zeit die Haut intensiv röthen. Wenn die elektrische Lichtfluth in den Theatern noch mehr zunimmt, so wird vielleicht noch eine neue Krankheit entstehen: „elektrische Sprossen“ als Pendant zu den berüchtigten „Sommersprossen“. Doch trotz der genannten Entdeckung steht noch die Gefahr jener Lichtfluth im weiten Felde. Die Damenwelt kann ruhig sein, denn sie wird genugsam geschützt durch den sparsamen Sinn der Theaterdirektionen. – i.
Von des deutschen Reiches Westmark, aus Metz, kommt uns eine Bitte zu, der wir hier gern Raum gewähren. Der dortige Turnverein, der als ein Vorposten des Deutschthums auf neuerworbenem Reichsgebiete erfolgreich bemüht ist, ein versöhnendes Verbindungsglied zwischen den alt- und neudeutschen Bestandtheilen der Bevölkerung Lothringens zu werden, entbehrt einer eigenen Turnhalle. 1872 gegründet, hat der Verein bis jetzt mit den schwierigsten Verhältnissen zu kämpfen gehabt, bald mußte ein Schuppen, bald auch nur, selbst im Winter, ein offener Hofraum als Turnplatz genügen; erst in den letzten Jahren gelang es ihm, für drei Wochenabende je einundeinhalb Stunden das nicht heizbare und nur zu Militärzwecken eingerichtete Turnlokal der Kriegsschule zu miethen, doch kann dieses Verhältniß von der Militärbehörde jederzeit gelöst werden und der Verein stände dann plötzlich ohne turnerisches Heim. Unter diesen Umständen kann das Turnen sich nur mühsam entwickeln, und natürlich leidet der patriotische, echt nationale Zweck vornehmlich darunter. Metz dem Deutschthum gewinnen zu helfen, der deutschen Turnsache in Lothringen den Weg zu bahnen, die Bildung neuer Turnvereine anzuregen und zu fördern (in Lothringen wurden in den letzten Jahren in Ars, Diedenhofen, Forbach und Saargemünd Turnvereine gegründet), das gehört mit zu dem angestrebten Ziele. 50000 Mark ungefähr sind erforderlich für den Bau einer Turnhalle, nur ein geringer Theil dieser Summe ist erst vorhanden. Es muß daher die werkthätige Beihilfe aller Gleichgesinnten angerufen werden. Möge die Bitte nicht ungehört verhallen, auch die geringste Gabe wird willkommen sein. Geldsendungen sind an C. Jonas, kaiserl. Kassen-Rendant, in Metz zu richten. – r.
Ein hübsches Qui pro quo. Die „Deutsche Studentenzeitung“ hatte eine Preiskonkurrenz für das beste Studentenlied ausgeschrieben, und den ersten Preis, einen vom Lahrer „Allgemeinen deutschen Kommersbuch“ gestifteten silbernen Pokal, erwarb ein Gedicht „Am Rhein“ von F. Schanz Dieser Dichter nun ist unsere geschätzte Mitarbeiterin Frida Schanz, an deren zarten lyrischen Poesien sich unsere Leser schon erfreut haben.
Und so werden denn in Zukunft Füchse und bemooste Häupter mit ihren alten Herren bei Kommersen einen „cantus steigen lassen“, den ihnen – eine wahrhaft poetische Fügung Äpoll’s – eine deutsche Jungfrau schenkte. – r.
Nachklänge der Hygieine-Ausstellung. Ueber die allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygieine und des Rettungswesens, die im Jahre 1883 in Berlin stattgefunden hat, wird von Dr. Paul Börner ein wissenschaftlicher Bericht herausgegeben, der sehr interessant zu werden verspricht. Soeben sind Vorwort und Einleitung zu demselben im Verlage von S. Schottländer in Breslau erschienen. – i.
Nochmals eine humoristische Notenzeichnung. (Mit Abbildung.) Die originelle Notenzeichnung J. J. Grandville’s „Barcarole“, die wir in Nr. 1 dieses Jahrganges gebracht haben, hat einen so großen Beifall vieler unserer Leser gefunden, daß wir, um ihren Wunsch zu erfüllen, heute eine zweite Zeichnung nachfolgen lassen. Auch diese „Ronde-Tarantella“ ist ein kleines Meisterstück und ebenso leicht zu enträthseln, wie der erste musikalische Scherz. – k.
Auflösung des Zweisilbigen Räthsels in Nr. 13: Diebstahl.
Kleiner Briefkasten.
J. M. in Dresden. Ein ganzer Stoß von Zuschriften liegt vor uns, welche in gleichcr Weise wie die Ihrige der Entrüstung über dieses „Heldenstück“ Ausdruck verleihen. Der Angriff steht tief unter dem Niveau aller anderen in der letzten Zeit gegen uns gerichteten, und wir können uns nicht entschließen, in der „Gartenlaube“ auch nur ein Wort auf denselben zu erwidern.
Inhalt: Osterzeit. Gedicht von Hermann Lingg. Mit Illustration S. 221. – Die Frau mit den Karfunkelsteinen. Roman von E. Marlitt (Fortsetzung). S. 222. – Frühlingsglaube. Illustration mit Gedicht von L. Uhland. S. 224 und 225. – Zum sechszigjährigen Professoren-Jubiläum Leopold von Ranke’s. Von Max Lenz. S. 227. Mit Portrait S. 228. – Eine Mägdeherberge in Berlin. Von Frau Tiburtius-Hirschfeld (Berlin). S. 232. – Unter der Ehren-Pforte. Von Sophie Junghans (Fortsetzung). S. 234. Mit Illustration S. 237 – Unsere Genußmittel. I. Fleischbrühe und Fleischextrakt. Von Dr. O. S. 238. – Blätter und Blüthen: Die Korvette „Alexandrine“. Mit Abbildung S. 239. – Der Kinder Osterfest. S. 239. Mit Illustration S. 233. – Was soll der Junge werden? S. 239. – Theodor von Frerichs. †. S. 240. – Spaziergang vor dem Thor. S. 240. Mit Illustration S. 229. – Die Kosmetik des elektrischen Lichtes. – Von des deutschen Reiches Westmark. – Ein hübsches Qui pro quo. – Nachklänge der Hygieine-Ausstellung. – Nochmals eine humoristische Notenzeichnung. Mit Abbildung. – Auflösung des zweisilbigen Räthsels in Nr. 13. – Kleiner Briefkasten. S 240.