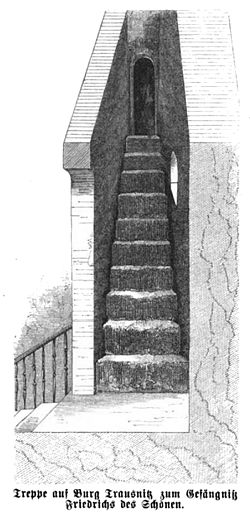Die Gartenlaube (1868)/Heft 36
[561]
| No. 36. | 1868. | |
„Gerechter Gott!“ rief Karl fassungslos aus, „so sind wir Alle betrogen! Annette – Mein Kopf, mein Kopf! – Was ist geschehen, daß dieses Bekenntniß – daß diese Stunde – –“ Er sah und hörte nicht mehr, es tanzte ihm vor den Augen. Er lehnte sich an den Tisch; „Annette,“ hob er wieder an, „warum – warum gaben Sie ihm Ihre Hand? Warum erfuhr ich es erst, als Alles zu spät war?“
Annette antwortete nicht, sie setzte sich langsam wieder nieder und saß aufrecht da, aber all ihr Blut schien sich entfärbt zu haben und ihr Busen flog. „O mein Schicksal!“ sagte sie endlich, und ihr Gefühl brach ihr über die Lippen, „so täuschte sie mich, so hat sie mich betrogen!“
„Wer hat Sie getäuscht?“ rief Karl mit überlauter Stimme. Sie sah voll Angst zu ihm auf, ihr Blick flehte ihn an, sich und sie nicht durch so laute Töne zu verrathen. „Ich habe Ihrer Tante geglaubt,“ flüsterte sie, „der Demoiselle Merling – sie sagte mir, daß Sie mit keinem Gedanken – daß Sie mich nur wie eine Schwester – –“ Die Zunge versagte ihr, und ein lautes Weinen drang ihr ans der Brust.
Karl stand in allen Gliedern erschüttert da, von dieser Entdeckung betroffen. Er ergriff endlich Annettens Hand, um ihr gemeinsames Schweigen wenigstens durch eine Bewegung zu unterbrechen; er drückte sie trostlos, ließ sie wieder fahren, und plötzlich bestürzt wich er einen Schritt zurück, als hätte er fremdes Eigenthum angerührt. Die widersprechendsten Gefühle, schaudernde Wonne und freudetrunkene Verzweiflung warfen sich auf sein Herz. „Annette!“ sagte er endlich mit zerschmelzender Stimme, „wie war es möglich? Wie konnten Sie so schnell an mir verzagen?“ Er beugte sich über sie, und der unendliche Schmerz, der um seine Lippen lag, drang ihr in die Augen.
„O meine Eltern!“ weinte sie, „– mein Vater – sie Alle drängten so sehr – und ich, in meiner Einsamkeit, in meinem Jammer – ich hoffte auch es zu überwinden, zu vergessen – aber niemals, niemals! – Niemals!“ wiederholte sie in trostlosem Schluchzen und warf sich in’s Sopha zurück, um dieses Bekenntniß und ihre aufglühende Scham in den Kissen zu begraben.
„Stehen Sie auf, Annette,“ sagte Karl erschüttert und suchte sich zu fassen. „Richten Sie sich auf, trocknen Sie Ihre Thränen; Wilhelm, Wilhelm wird kommen! So gilt es denn also, sich zu trennen, Annette, sich für immer zu trennen. Es ist ein trauriges Loos, – weinen Sie nicht, Annette! Wenn Ihre Thränen Sie verrathen, so ist’s auch um Wilhelm geschehen; lassen Sie ihn nicht erfahren, wie unglücklich wir sind wir und er. O mein Gott!“ Er horchte wieder, ob der Bruder noch nicht komme, aber Alles war still. Annette hatte sich aufgerichtet, die letzten Thränen flossen ihr noch über die Wangen. „Ich will Ihnen etwas geloben, Annette!“ fuhr er mit düsterem, melancholischem Lächeln fort, „aber ich weiß nicht, ob ich es halten werde. Ich will Sie nur wie meine Schwester lieben, – ich will’s versuchen. Vielleicht, daß es mit der Zeit gelingt, wenn man’s bei Zeiten beschließt! Geben Sie mir die Hand, Annette – meine theure Annette. Geben Sie mir Ihre schwesterliche Hand.“ Er hatte sich ihr mit ruhiger Miene, in stiller Wehmuth genähert; er fühlte die warme Hand, weich wie Sammet, in der seinen, ihr feuchter Blick voll elender, selbstvergessener Liebe flog zu ihm hinauf, – seine Sinne, seine Gedanken verwirrten sich. Mit einem bangen Seufzer zog er ihre Hand an seine Brust, zog sie selber nach, und wie Sterne, die unwiderstehlich zusammenfallen, lagen sie sich in den Armen.
Ein dumpfes Geräusch nahe der Thür, die zum Vorplatz führte, schreckte die Unglücklichen auf. Es klang wie ein Fall, doch mit schwachem, gedämpftem Ton. Annette flog zurück, ihre Lippen glühten, ihre Augen sagten mit einem Blick ihr ganzes Entsetzen über das, was sie gethan. Sie starrte Karl in’s Gesicht, und die Beiden standen sich in schrecklicher Verstörtheit gegenüber. „Annette!“ murmelte Karl fassungslos, legte sich die Hand vor die Stirn und horchte hinaus. Endlich, da es draußen still blieb, trat er an die Thür; „wer ist da?“ fragte er laut. Es kam keine Antwort Er faßte sich ein Herz, die Thür zu öffnen, indessen draußen auf dem Flur war nichts Lebendiges zu sehen. Er kam zurück; Annette, leichenblaß, fragte ihn mit den Augen. „Nichts,“ antwortete er und schüttelte den Kopf. „Ich glaubte da draußen etwas gehört zu haben, was - was in mir selbst war! – O Annette, wohin ist es mit uns gekommen! So sollte dieser Tag enden, an dem ich meine Ruhe wiederzufinden hoffte! – Fasse Dich, – nun ist ja Alles vorbei - Alles entschieden. Du wirst mich nicht wiedersehen, ich versuch’ es wieder draußen in der Welt, ein Vorwand wird sich ja finden. Sei stumm gegen ihn, Annette, laß ihm, – was er noch hat. Was hilft es, die Hände ringen, fasse Dich und vergieb mir!“
Er starrte sie mit Augen voll Verzweiflung an, es trieb ihn, vor ihr hinzustürzen, aber ein Rest von Besinnung hielt ihn zurück. Von der Thür her, die in die inneren Gemächer führte, [562] glaubte er Schritte herankommen zu hören, er winkte Annetten, deren Züge noch ihr ganzes Schicksal verriethen, und um sich selber zu fassen, trat er an’s Fenster und sah in die inzwischen dunkel gewordene Nacht hinaus.
Wilhelm öffnete die innere Thür; hinten ihm, im großen Saal, war es hell, die Kerzen brannten auf den Spiegeltischen, und rückwärts sah man noch in andere erleuchtete Räume hinein.
Er selber hielt in jeder Hand ein paar Flaschen zwischen den Fingern. Sein überaus blasses Gesicht flackerte von unruhiger Heiterkeit, und er blickte die Beiden an, wie wenn er sie eben über dem Gähnen ertappt hatte. „Es scheint, Ihr unterhaltet Euch schlecht,“ sagte er mit lauter, gesteigerter Stimme, „wahrscheinlich“ - indem er die Flasche hob – „weil es am Besten gefehlt hat? Aber jetzt zum Abendessen, zum Wein; ich habe im Clavierzimmer decken lassen, vielleicht läßt Karl nachher unser altes Spinett noch einmal arbeiten, ehe es abgedankt wird, und spielt uns ein paar von meinen alten Leibstücken. Kommt!“ sagte er, ohne sie weiter anzusehen, und ging voran, durch den hellen Saal auf das Clavierzimmer zu. Annette, in unbeschreiblicher Erregung, folgte ihm langsam, Karl schritt stumm hinterdrein. Drinnen war auf der kleinen Tafel Alles aufgetragen, was die ländliche Speisekammer nur irgend enthielt; die alte Wirthschafterin, die Mägde liefen ab und zu, es sah aus, als sollte ein großes Fest gefeiert werden. Nun stellte Wilhelm auch die Flaschen auf den Tisch, und in dem Augenblick rannen ein paar rothe Tropfen unter seinem Haar hervor und fielen auf die weiße Decke. „Was ist das?“ fragte Karl, indem er erschrocken näher trat, „Wein oder Blut?“
„Blut, Blut!“ erwiderte Wilhelm mit wilder Laune, indem er sein Taschentuch an die rechte Schläfe hielt; „Bruderblut, Karl! Ich habe einen kleinen Fall gethan – drunten im Keller. Ich wollte selber hinunter, weil ich die besten Sorten unter besonderem Verschluß habe, und auf den feuchten, schlüpferigen Stufen glitt ich aus –“
„So solltest Du Dich waschen,“ unterbrach ihn Karl, „und jedenfalls solltest Du mich nach der Wunde sehen lassen –“
„Nichts da! Nichts da!“ riefs Wilhelm mit gewaltsamem Lachen aus und trat einen Schritt zurück. „Eine ganz kindliche Schramme, weiter nichts. Das Beste ist, die paar rothen Tropfen sogleich wieder zu ersetzen.“ Und damit öffnete er eine der Flaschen, füllte die Gläser hastig mit dunklem Wein und goß das seine auf der Stelle hinunter. „Auf recht – glückliche Tage!“ setzte er hinzu und füllte sein Glas von Neuem, um mit Annetten und dem Bruder anzustoßen. „Auf fröhliche Nachbarschaft, Karl!“ Er trank aus, schenkte wieder ein, stürzte es hinunter und stellte dann das Glas mit einer so hastigen Bewegung auf den Tisch, daß es zerbrach. „Wer ist abergläubisch?“ sagte er und lachte und rief der eben hinausgehenden Dienerin nach, ihm ein anderes Glas zu bringen. „Iß und trink, Karl! Stärke Dich, Du siehst nicht gut aus, – die lange Reise steckt Dir in den Gliedern. Wir wollen Dich heute nicht lange festhalten; Ausschlafen thut Dir noth, aber auch Essen und Trinken!“ Er fuhr mit den Händen auf dem Tisch herum, um ihm Alles zu reichen, nöthigte ihm jede Speise auf, pries sie ihm an und stürzte unterdessen Glas aus Glas hinunter. Annette sah ihm in heimlichem Bangen zu.
Endlich, als die unerträgliche Tafelstunde vorüber war und die Mägde den Tisch wieder abgeräumt hatten, ging Wilhelm mit großen Schritten im Zimmer umher, versuchte zu singen, lachte selber laut darüber auf, ergriff dann auf einmal Karl, der bei der Berührung zusammenfuhr, am Arm, um ihn ohne Worte an das Spinett zu ziehen. Er schlug die großväterisch alten, vergilbten Noten auf, die Karl in ihrer Knabenzeit ihm so oft zu seiner Erbauung vorgespielt hatte, und drückte ihn auf den Sessel nieder. Es waren feierliche Kirchenmelodien, im alten Stil, auf das Spinett übertragen. Karl setzte sich hin, im Innersten aufgelöst, und mit unsicheren Händen fing er an zu spielen. Sowie er begonnen hatte, wandte Wilhelm sich ab und ging in den Saal hinaus. Annette hörte seine leisen, langsamen Schritte auf und nieder. Sie hatte sich an das Fenster gesetzt, wo üppig niederhängender Epheu sich mit ihren Locken mischte; sie sah in die Nacht hinaus und lauschte, sie blickte zu Karl hinüber, der ihre Augen vermied, ein unendliches Wehgefühl hob ihre Brust, und die bittersten Thränen flossen ihr über die Wangen.
So hatten sie sich eine Weile gegenüber gesessen, als Karl plötzlich mitten in einer Melodie, wie von einem Geist ergriffen, abbrach und in die Höhe fuhr. Er warf sich das verwilderte Haar aus der Stirn, legte sich die rechte Hand über die feuchten Augen, die andere auf’s Herz, er schien in fürchterlicher Bewegung zu sein. „Annette!“ sagte er mit halblauter Stimme, „leben Sie wohl!“ Ein letzter Blick begleitete diese Worte, der ihr durch die Seele ging; dann kehrte er sich ab und trat in den Saal hinaus. „Wilhelm!“ sagte er laut. Die Lichter waren ausgelöscht, aber in dem Halbdunkel erkannte er, daß der Raum leer war, daß sich der Bruder entfernt hatte. Er durchschritt den Saal, trat auf den Flur, rief seinen Namen, und da er nichts von ihm sah noch hörte, auch kein Anderer statt seiner kam, so stieg er die Treppe hinan, um, einer Ahnung folgend, ihn in seinem eigenen Zimmer aufzusuchen. Er kam an die Thür und glaubte drinnen Geräusch, glaubte halblaut gesprochene Worte zu hören. Mit zitternden Fingern klopfte er; Niemand rief „Herein!“ Nun versuchte er zu öffnen, aber die Thür war verschlossen. „Wilhelm!“ rief er; „Wilhelm!“ es kam keine Antwort. „Wilhelm!“ wiederholte er mit lauter, ängstlicher Stimme.
Nun endlich antwortete es von drinnen: „Was willst Du?“
„Ich bitte Dich, öffne mir!“ erwiderte Karl und pochte von Neuem. „Oeffne mir, Wilhelm, in des Himmels Namen!“ Auf diese Worte rührte es sich drinnen, der Schlüssel drehte sich im Schloß, und indem Karl sogleich die Thür mit den Händen aufstieß, trat er hastig hinein.
Es war dasselbe Zimmer, in dem sie Beide als Knaben miteinander gehaust hatten; noch hing das Bild ihrer Mutter an derselben Stelle, an der es damals gehangen, noch standen dieselben alten, verschossenen Polsterstühle in den Winkeln umher. Auf einem von ihnen, neben der Thür, saß Wilhelm regungslos und sah den Bruder wie ein Abwesender an. Eine Pistole lag neben ihm auf dem Tisch in der Ecke. Er hatte ein Blatt Papier im Schooß, einen Stift in der Hand, als hätte er eben schreiben wollen. Diese Anstalten, dieser Anblick des Bruders und die Erinnerungen, die der Raum im ihm wachrief, erschütterten Karl vollends bis in’s Mark. Es flirrte ihm vor den Augen. Er lehnte sich gegen die Thür. „Was wolltest Du, Wilhelm?“ brachte er mit Mühe über die Lippen. „Was wolltest Du mit der Pistole dort? Treibt es Dich, auch zu sündigen, so wie ich an Dir gesündigt habe?“
„Was hättest Du an mir gesündigt?“ fragte Wilhelm, indem er des Bruders Augen vermied, und suchte ungläubig zu lächeln.
„Was ich an Dir gesündigt habe?“ erwiderte Karl und lehnte seinen Kopf gegen die Wand. „Ich liebe Deine Frau wie ein Wahnsinniger; ich hab’ es ihr gesagt, ich habe sie geküßt; – das ist es, Wilhelm, was ich Dir gethan habe. Um Dir das zu sagen, kam ich her; mit einer Lüge wollt’ ich nicht von Dir scheiden. Aber ich sehe nun, Du hast Alles gewußt. Du bist nicht auf den Kellerstufen gefallen, Wilhelm, sondern auf dem Flur an der Thür. Du bist dann heraufgegangen, um Dir das Leben zu nehmen. Auf diesem Blatt da hast Du uns sagen wollen, sinnloser Mensch, daß Du um unserer Schuld willen Dich in den Tod gestürzt hättest.“
Wilhelm erwiderte nichts und stierte mit ödem, verschlossenem Gesicht vor sich hin. Seine weiße Stirn röthete sich heftig, die Wunde unter seinem Haar fing wieder an zu fließen, und wie blutige Thränen rannen ihm die Tropfen langsam an der Wange herab. Karl, sowie er das sah, von einem Schauder geschüttelt, griff nach einem Schwamm, der nicht weit von ihm auf Wilhelm’s Waschtisch lag, tauchte ihn in Wasser und eilte auf den Bruder zu, um das Blut zu stillen. Er hob das Haar hinweg, eine kurze, schmale Wunde erschien, nur das wilde Pochen des Herzschlags schien die quellenden Tropfen hervorzutreiben. Er drückte das kühlende Wasser auf die heiße Stelle, wusch ihm das Blut von der Schläfe, von der Wange und füllte den Schwamm von Neuem, um den tröpfelnden Purpur aufzufangen. Wilhelm ließ Alles mit sich geschehen, ohne sich zu rühren.
„Warum hast Du Dich so gar nicht drum gekümmert?“ sagte Karl mit sanftem Vorwurf.
„Wozu auch!“ erwiderte Wilhelm und starrte noch immer in die leere Luft.
„Setze Dich!“ fing Karl nach einer Weile wieder an, „ich [563] glaube, Du zittert,“ und führte ihn an den alten Divan unter der Mutter Bild. „Ruhe Dich aus!“ Wilhelm setzte sich still. Bruder! Bruder!“ rief Karl endlich mit dem hervorbrechenden Ton der bittersten Verzweifelung, „wie soll das enden? Was soll aus uns werden, wenn wir so auseinandergehen? Wenn ich – wenn ich unser Aller Leben zerstört habe? – Wilhelm, Wilhelm, – ich kann nicht ohne Dich leben! Und nun soll ich von dannen gehen wie ein Missethäter, um mir ewig zu sagen, daß ich dem theuersten, geliebtesten Menschen das Herz gebrochen! Und ich soll Dich verlassen – Dich verlassen! Wilhelm, ich kann’s nicht!“
Er hatte die beiden Hände seines Bruders ergriffen; mit einem Blick voll trostloser, unendlicher Liebe sah er ihn an, und ohne Thränen in den Augen fing er an wie ein Kind zu schluchzen. Wilhelm sprang auf und stürzte ihm an die Brust. „Karl, liebst Du mich noch?“ rief er außer sich; „liebst Du mich wirklich? O mein Bruder, mein Bruder!“ Er umschlang ihn, als dürft’ er ihn nie wieder aus den Armen lassen, er küßte ihn auf die Wangen, auf die Lippen, er streichelte ihn, vor Glückseligkeit seufzend, und umschlang ihn von Neuem. „O Karl, Karl, was denkst Du! Du ein Missethäter? Du hättest die Schuld? Während ich Dir Dein Glück gestohlen habe – Dir und ihr und nie, nie mehr ruhig werden kann! Und doch liebst Du mich noch!“ Er sah ihm mit nassen, aber strahlenden Augen so nah in’s Gesicht, daß sie sich fast berührten, küßte ihn wieder und gab ihm die liebkosendsten Namen. „Ich weiß Alles, Karl“ flüsterte er an ihn hin. „Ja, ich habe gehorcht. Es ließ mir erbärmlichem Menschen keine Ruhe. Ich weiß, daß Tante Merling – O Karl, dieses Weib! Und in ihre Hände hatt’ ich meine Sache gegeben! Und als Du nun die alten Lieder spieltest, – da hielt ich es nicht mehr aus. Ich meinte, Du müßtest mich hassen – ich wollte Dich nicht wieder sehen ich dachte mir: wenn Du nur todt wärst und sie Beide weinten über Deiner Leiche und könnten sich dann befreit in die Arme sinken und Dich begraben, vergessen! – Aber sei ruhig, Karl; daran denk’ ich nicht mehr! Du hast mich noch lieb, und nichts, nichts ist verloren! Wenn Du mir nur vergiebst – In diesem Zimmer hier, weißt Du noch? haben wir uns als Knaben ewige Liebe geschworen; hier sind wir groß geworden, Karl – und haben Altes getheilt – und uns nie getrennt, als dieses eine Mal nach der unseligen Hochzeit – und Du hast Recht, wir können uns nicht verlassen.“
„O Bruder,“ sagte Karl mit dumpfer Stimme, „was sollen wir thun?“
„Ich will es Dir sagen, Karl,“ erwiderte Wilhelm und legte ihm die Hand auf die Schulter, „mir ist ganz klar, was wir thun sollen! Weißt Du noch, wie wir damals bei der alten Merling das Gespräch über die Ehe hatten und was Du Alles gesagt hast? und wie Du den Fall erzähltest von dem unglücklichen Menschen, der ein Mädchen heirathete, das einen Andern liebte? Da fragtest Du noch Annette, was sie in solchem Fall für das Rechte hielte und ob es besser wäre, drei Menschenherzen durch die Regel zu brechen, als durch die Ausnahme zu retten? Weißt Du das noch? Und wie drauf Annette antwortete, daß der Mensch dazu da sei, alle Schickungen Gottes mit Ergebung zu tragen? Aber was heißt das, Karl? Sagt man das nicht so oft, nur um sich vor einem neuen, schweren Entschluß zu retten? Und, wie Du ihr damals mit Recht zur Antwort gabst: ,Wenn wir eine Thorheit begangen haben, muß denn das immer Gottes Wille sein?’ O Karl, wie ein rechter Knabe bin ich in dieses Unglück hineingerannt; ich hatte keinen, keinen Begriff davon, was es heißt, einen Bund für’s ganze Leben zu schließen! Aber Gott sei Dank, noch ist ja nicht Alles verspielt; noch kann ich ein Mann werden, und noch kann ich es gut machen!“
Er sagte das, während ihm die Lippen vor Bewegung bebten, ließ, mit einem Blick voll der innigsten Liebe, Karl’s Schulter los und trat einen Schritt zurück. „Was wolltest Du thun?“ fragte Karl ihn gerührt und folgte ihm mit den Augen. Wilhelm trat an den Schreibtisch. „Du bist so viel klüger als ich,“ antwortete er in Thränen lächelnd, „aber das siehst Du nicht ein!“ Und indem er sich in seiner hastigen Weise setzte und nach der Feder griff: „Lieber Karl, willst Du nicht so gut sein und mir das Blatt Papier da herüberreichen?“
„Was soll das?“ stammelte Karl und gab es ihm hin.
„Laß mich, laß mich nur!“ erwiderte Wilhelm und begann schon in seiner gleichmäßigen, großen Handschrift zu schreiben. „Ich bin nicht eher ruhig, als bis es gethan ist! War ich damals so rasch, warum soll ich heute nicht noch rascher sein!“
„Allmächtiger Gott!“ rief Karl aus und trat an ihn heran, „errathe ich, was Du willst? Wilhelm, bist Du von Sinnen?“ Und er beugte sich über das Blatt und las den Anfang, und nahm dem Bruder die Feder aus der Hand. „Du bist außer Dir!“ sagte er. „Du willst Dich wieder übereilen wie damals; Du willst ebenso unbedacht lösen, wie Du geknüpft hast.“
Wilhelm stand auf und schüttelte den Kopf. „O nein, glaube das nicht. Ich bitte Dich“ und er ergriff seine Hand – „beirre mich nicht; rede mir nicht ein! Ich weiß, daß ich das nicht für Annette fühle, was Du für sie fühlst. Ich kann ohne sie leben – Du nicht. Dein Herz – Dein Herz, Karl, ist viel größer als meines; in meinem flackert es mehr – Deins verzehrt sich. Ich hab’s ja vorhin da drunten angehört, wie Du fühlst, wie Du bist. Sage kein Wort mehr! Ich liebe keinen Menschen auf der Welt so sehr, wie Dich, und ich will Alles verlieren, wenn ich Dich behalte.“
Karl erwiderte nichts, er warf sich dem Bruder an die Brust und hielt ihn lange umschlungen. Ihre überfüllten Herzen schlugen in der heftigsten Bewegung gegen einander. „Geh’ nun, laß mich allein!“ stieß Wilhelm endlich hervor. „Geh’ heim lege Dich schlafen! Und wenn Du nicht willst, daß ich wieder zu jener – Pistole greifen soll, so widersprich mir nicht mehr, so laß mich thun, was ich Dir schuldig bin, was ich mit Seligkeit thue, um Dir und ihr und mir das Leben zu retten.“
„O Bruder!“ stammelte Karl, küßte ihn auf den Mund und wankte zur Thür. Wilhelm geleitete ihn, einen Arm um seinen Leib geschlungen, und führte ihn hinaus’. Dann trennten sie sich mit herzlichem Gutenacht. Eine Weile hörte Wilhelm noch die verhallenden Schritte; als es endlich ganz stille war, kehrte er in sein Gemach zurück, mit zufriedenem Antlitz, mit einem unbeschreiblichen Feuer in den Augen, und setzte sich wieder auf seinen Platz und schrieb. Die Wanduhr hinter ihm schlug Mitternacht, als er die letzte Zeile vollendet hatte und sich erhob. Er ging eine Weile ruhelos im Zimmer umher; endlich trieb es ihn hinaus, er öffnete die Seitenthür, die in die anstoßenden Gemächer führte, er schritt durch das erste hindurch und stand im zweiten, in seinem und Annettens Schlafgemach, vor dem Bett seiner Frau.
Annettens Licht brannte noch; sie lag in dein großen Himmelbett, bei offener Gardine, den Kopf auf den Arm gestützt, und starrte ihm mit wachen Augen entgegen. „Du schläfst noch nicht?“ sagte er sanft und setzte sich neben sie auf das weiße Linnen. Sie schüttelte bang den Kopf. „Annette!“ fuhr er fort, „willst Du mir verzeihen, daß ich Dich unglücklich gemacht habe? So wahr ich lebe, Annette, ich habe es nicht gewollt. Sieh’ mich nicht so verwundert an; ich weiß, wie es steht. Ihr liebt Euch, Gott hat Euch für einander geschaffen; willst Du mir nun die Liebe thun, Annette, und mir mein Wort wieder zurückgeben? Ich muß Dir bekennen,“ und er blickte mit wehmüthig scherzenden Augen in die ihren – „ich habe nicht mehr Herz genug für Dich, um Dein Gatte zu sein; nur noch Herz genug für einen Bruder, und der könnte ich Dir ja werden. Es hat sich diesmal Alles so seltsam gefügt, Annette; Du glaubtest, Karl habe Brudergefühle für Dich, ich glaubte, ich müßte Dich um jeden Preis zur Frau haben – und umgekehrt wäre Alles in Ordnung gewesen! Ich bitte, unterbrich mich nicht; laß mich ausreden, schweige noch ein wenig. Da drinnen in meinem Zimmer, Annette, liegt meine Bitte an den Landesherrn und Landesbischof um Dispens, um Lösung unserer Ehe. Wir haben zwar keinen andern Grund, uns zu trennen, als daß wir Drei uns zu lieb haben, um uns zu Grunde zu richten, und die Welt erkennt ja eigentlich dergleichen Gründe nicht an, aber ich glaube, Annette, sie werden da oben in der Residenz gnädig gegen uns sein! Wenn Du mir einwilligst, – ich habe schon Mittel, unsere Sache zu betreiben. Ich fahre dann selber hin, mein Papier in der Tasche, um mit Allem, was helfen kann, für uns zu wirken. Und wenn sie dann endlich in ihrer Weisheit begreifen, daß es gut ist, uns von einander zu trennen und wenn Du dann frei bist, meine arme Annette, die Du so geduldig und so unaussprechlich viel gelitten hast – und wenn Ihr mir dann auch das Letzte noch zu Liebe thut, was ich von Euch verlange, und meine unglückselige Thorheit wieder gut macht [564] und an demselben Altare Euch verbindet, wo wir Beide damals uns so grausam versprachen –“ Er schwieg, seine Erinnerungen an jenen Tag überfielen ihn mit aller Gewalt, und seine Augen schlossen sich mit schmerzlichem Zittern.
„Wilhelm,“ sagte Annette und faßte seine Hand, „was sprichst Du nur Alles, was ist Dir?“
Sie hatte sich völlig aufgerichtet und sah ihn großäugig und erröthend an.
„Ich habe Dir gelobt, Dich glücklich zu machen,“ erwiderte er, indem er die Augen wieder voll Empfindung aufschlug, „und das will ich nun halten. Und was die Welt auch dazu sagen mag, Annette, – wir Drei wissen ja, daß es sein muß, und das ist uns genug. Wie wir dann dereinst mit einander leben wollen, Annette! Du und er, und ich hier Euer Nachbar, Euer Bruder! Wie die Welt uns dann beneiden soll! – Ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden, Annette. Es thut noch ein wenig weh, – aber das würzt mir meine Freude, das macht sie mir wunderbar süß. Hier hast Du meine Hand, Schwester: ich gelobe Dir meine brüderliche Liebe. Gute Nacht! – Dieses Zimmer betrete ich nun nicht mehr!“ setzte er mit sanftem Lächeln hinzu und stand auf. „Gute Nacht, meine Schwester!“
Er hob ihre kleine Hand an seine Lippen und küßte sie, Annette aber, in fassungsloser Rührung, ergriff die seine, zog sie an ihre Brust und bedeckte sie mit ihren Küssen und Thränen.
„Genug, genug!“ sagte er verwirrt und zog sie zurück. „Es war ein wunderliches Schicksal, Annette! Es war“ – und er lächelte sie wieder an – „es war eine recht acute Ehe; die zweite, liebe Annette, soll desto chronischer werden! – Gute Nacht; fasse Dich bis morgen! Ich werde da drinnen auf meinem Divan noch ein wenig ruhen; in aller Frühe geht’s fort. Du weißt, ich muß Alles geschwind, Alles eifrig betreiben; diesmal, denk’ ich, wird der Himmel es segnen.“
Er machte sich von ihr los, da sie seine Hand von Neuem in der ihren hielt, und ging eilig hinaus. Annette sah ihm nach, und ihre Thränen flossen von tausendfachen Gefühlen.
Wie lange nach dieser ereignißvollen Nacht – zu großem
Erstaunen der Welt – die öffentliche Trennung der Vermählten
erfolgte, weiß ich nicht zu sagen, nur, daß sie wirklich erfolgte.
Was ich hier erzählt habe, ist eine wahre Geschichte; ohne Zweifel
nicht in jeder Einzelheit getreu, in allem Wesentlichen aber wirklich
erlebt. Annette und Karl schlossen nach einiger Zeit ihre neue
Ehe; indessen, wie man sagt, nicht eher, als bis sie Wilhelm in
jedem Sinne getröstet sahen und er eine andere Lebensgefährtin
gefunden hatte, die er gefahrlos und mit ruhigem Herzen lieben
konnte. Seit dieser Zeit kehrte die ganze Ruhe und Glückseligkeit
ihres brüderlichen Beisammenlebens zurück, und in der Gegend,
in der ihre nachbarlichen Güter lagen, ist es noch heute nicht vergessen.
Es mag unnütz sein, zu erwähnen, daß Demoiselle
Merling auf den neuen Hochzeiten nicht zugegen war und daß
sich Annette zwar nach einiger Zeit, Wilhelm aber nie wieder
mit ihr versöhnte. Der Ehe Karl’s und Annettens aber entsprang
eine Reihe blühender Nachkommen, die fast alle noch leben und
gedeihen und die sich des Glücks und der unerschöpflichen Liebe
ihrer Eltern erinnern.
Skizzen aus dem Land- und Jägerleben.
Vor einigen Jahren hielt ich mich während einer Studienreise mehrere Monate in dem kleinen reizend gelegenen Landstädtchen H. auf und machte hier gelegentlich die Bekanntschaft eines wackeren Grünrocks, in dessen benachbartem Bergrevier ich manche frohe Stunde verlebte. Der alte Revierförster huldigte allerdings mehr dem Sylvan, als der Diana, allein unter seinem Dienstpersonal befand sich ein äußerst tüchtiger Jäger und Rauchwerksfänger in der Person eines alten Waldschützen, welchem denn auch die Leitung sämmtlicher Jagdangelegenheiten vollständig überlassen blieb. Letzterer übersandte mir nun eines Tages nachstehendes wundersames Schriftstück:
In Aller Eile setze ich mich hin, weil die Polenfrau sogleich hier vorkommen wirt und der Herr Revierferster es mir aufgetragen hat, indem er zur Okziohn (Holzauction) muß. Nehmlich die große Delle (Schlucht) am Kahlen berge soll heute Abend sechs Uhr mit Schizzen umstellet werten, indem sich Widder eine Wilde kazze dorten gezeicht hat und unser Vorgesetzter in der Sichern Erwartunge ist, daß Ew. Wohlgeb. auch darbei sein werten.
Im Auftrage dessen Curt Halsgebinde, Waldschütz.“
Trotz der drückenden Hitze machte ich mich gleich nach Tisch auf den Weg. Die Junisonne sandte ihre glühenden Strahlen unerbittlich herunter auf die staubige, blendend weiße Chaussee, kein Lüftchen regte sich, kein lebendes Wesen war in den weiten Kornfeldern zu erblicken, nur ein paar Krähen hockten unbeweglich mit halbgeöffnetem Schnabel im hohen Wiesengrase. Auch im Kiefernwald weiter unten, auf dessen glattem, tangelbedecktem Boden der unbarmherzige Zahn der Schafe bereits die letzte Spur jedes grünen Hälmchens vertilgt hatte, war die Gluth entsetzlich. Doch endlich ist auch diese Feuerprobe unserer Jagdpassion glücklich überstanden; schon blinkt hier und da zwischen den grauen Stämmen frisches Grün hervor, und aufgehängte Strohbündel – die sogenannten „Hegewische“ – bezeichnen die Grenze der Schaftrift. Vor uns eine üppige Buchenschonung, in deren kühlem Schatten die Turteltauben gurren; drüben zeigt sich bereits das gastliche Försterhaus mit seinen Hirschgeweihen und grellgrünen Fensterläden. Eine ungeheure Rauchwolke wirbelt soeben aus dem Schornsteine in die blaue Sommerluft empor und verkündet, daß die Frau „Revierförsterin“ mit gewohnter Energie die Vorbereitungen zum Kaffee begonnen hat.
Bald sitzen wir am sauber gedeckten Gartentisch unter schattigen Obstbäumen, über uns Schwalbengezwitscher und ringsum das tausendstimmige Gesumme des Bienenschwarmes. In einem Nachbarhäuschen jenseits des Zaunes erhebt sich ein lauter Wortwechsel, der alte Curt Halsgebinde zankt sich mit seinem Sohne Heinrich. Der Revierförster steht endlich auf, um Frieden zu stiften, und wir erfahren nun beiläufig von der gesprächigen Hausfrau, daß besagter Heinrich etwas dämlicher Natur sei und durch angebornes Ungeschick jede Jagd verderbe, bei welcher er irgendwie betheiligt wird. Ihr Mann habe nun leider die fixe Idee, aus dem Jungen trotz alledem noch einmal einen tüchtigen Waldpfleger zu erziehen; sonst hätte der Curt ihn schon längst aus dem Hause geschickt.
Die sinkende Sonne mahnt zum Aufbruch; am Gartenthore harren bereits die beiden Forstgehülfen nebst dem alten Curt, sein Sohn trägt statt des Gewehrs ein mächtiges Tellereisen, in welchem die Wildkatze sich über Nacht fangen soll, falls der Anstand erfolglos bleiben sollte. Nach halbstündigem Steigen und Klettern befinden wir uns auf dem Gipfel des Kahlenberges. Heinrich erhält die gemessene Weisung, sich hier am Rande der Dickung so lange ruhig zu verhalten, bis er durch einen Jagdpfiff benachrichtigt werde, wohin er das Tellereisen zu tragen habe. Wir steigen bergab über eine völlig kahle, mit losem Steingeröll übersäete Fläche, ein wahres Steinmeer, aus welchem nur hier und da ein alter Eichenstumpf seine weißgebleichten Aeste gespenstisch zum Himmel emporstreckt. Am Rande der sogenannten „Delle“ – einer engen Schlucht mit steil abfallenden Klippenwänden – stellen die Schützen sich in gemessener Entfernung auf und harren nun lautlos auf das Erscheinen der Wildkatze. Die Wildkatze, früher wohl in allen Wäldern Deutschlands heimisch, kommt jetzt bekanntlich nur noch in den unzugänglicheren Theilen unserer Gebirgswaldungen vor und ist, wo sie sich zeigt, eine höchst gefährliche Feindin des Wildstandes. Deshalb stellt ihr der Jäger in jeder Jahreszeit eifrigst nach, sucht ihrer indeß seltener durch Schußwaffen, vielmehr
[565][566] meist in Fangeisen habhaft zu werden. Außerordentlich gewandt im Klettern und Springen, stürzt sie sich von den höchsten Bäumen auf ihre Beute – Eichhörnchen, Wildgeflügel, Hasen, ja selbst ältere Rehe – herab, schlägt ihre Fänge dem erkorenen Opfer in’s Genick und zerbeißt ihm mit scharfem Zahne das Rückgrat. – Die Sonne ist bereits hinter dem Hügelkamm verschwunden, nur die höchsten Tannenwipfel des Kahlenberges erglühen noch im röthlichen Licht, da sehe ich drüben, jenseits der Delle, ein kleines rauchhaariges Geschöpf langsam, wie kreuzlahm, zwischen den Steinen herumkriechen, um im nächsten Augenblicke wieder zu verschwinden. Unten im Thal läßt sich das anhaltende, verrätherische Geschrei eines Hehers vernehmen, er muß ein Raubthier – wahrscheinlich die alte Wildkatze – bemerkt haben. Dann ist wieder Alles still. Vergebens spähe ich lange die ganze Fläche auf und ab, endlich zeigt sich weiter oben, außer Flintenschußweite, ein beweglicher, dunkler Klumpen. Mit Hülfe meines Fernglases erkenne ich deutlich die alte Wildkatze, welche sich mit zwei bis drei jungen Kätzchen spielend herumbalgt und ihnen den zugetragenen Raub – ein junges Eichhörnchen – scherzend vorenthält.
Wäre ich allein gewesen, so würde ich sofort versucht haben, die alte Katze durch Nachahmung des Mäusepfeifens heran zu locken. Allein der alte Curt war ein Meister im „Reizen“, und da er die Katzen von seinem Stande jedenfalls bemerkt haben mußte, so wollte ich ihm nicht vorgreifen und hoffte von Secunde zu Secunde seine berühmte „Hasenquäke“ oder das unvergleichliche „Vogelgeschwirr“ erschallen zu hören. Aber Curt rührte sich nicht, und feierliche Stille herrschte nach wie vor in der Steinwüste.
Horch! – was war das? – singt dort oben Jemand? – Ja, wahrhaftig! jetzt schallt es in leisen langgezogenen Tönen, allmählich zum Forte übergehend, von dem Kahlenberge herunter:
Die ganze Katzengesellschaft war natürlich im Handumdrehen verschwunden; noch einmal tauchte die Alte für einen Moment zwischen dem Geröll lauschend hervor – da krachte des Revierförsters Büchsflinte, allein die Kugel schlug klatschend auf einen Stein. Verdrießlich brummend warf er das Gewehr über die Schulter und ging heimwärts. Ich folgte, um nicht Zeuge der Scene zu sein, welche sich alsbald zwischen dem alten Curt und seinem Sohne – denn dieser war der unglückliche Sänger – entspinnen mußte.
Ich übernachtete im Forsthause, mein Vorschlag jedoch, am nächsten Morgen den Anstand an einem andern Punkte des Kahlenberges zu wiederholen, fand keinen Anklang. Der Revierförster meinte, es sei ein halsbrechendes Unternehmen, den Berg im Dunkeln vor Sonnenaufgang hinunter zu klettern. So wanderte ich denn nach dem Frühstück, da ich eben nichts Besseres zu thun wußte, mit Curt hinaus, um nach dem Eisen zu sehen, welches er gestern Abend noch auf den Hauptpaß eines alten Fuchsbaues gelegt hatte. Er war fest überzeugt, daß die Katzen sich dorthin geflüchtet hatten und daß wenigstens eine von ihnen sich gefangen haben würde.
Der erwähnte Bau war an einem steil abfüllenden Hange belegen; Curt kletterte zuerst hinunter und verkündete bald mit triumphierender Stimme, daß das Eisen tief in die Hauptröhre hineingezogen sei und hier so fest wie eingemauert sitze. – Der unvermeidliche Heinrich eilte nun schleunigst hinzu und stellte sich nach Anweisung des alten Curt schlagfertig mit gehobenem Knittel auf, um die Wildkatze beim ersten Erscheinen sofort unschädlich zu machen.
Der Alte zog aus Leibeskräften, endlich konnte er die Schlagfeder des Eisens ergreifen – noch ein Ruck – da fuhr neben dem Eisen die zornige Katze hervor – nieder sauste Heinrich’s Knittel und quetschte – die beiden Fäuste des alten Curt! Das Eisen loslassend, schlug dieser mit einem unterdrückten Schmerzensschrei hintenüber und kollerte, Eisen und Katze hinterdrein, den abschüssigen Hang hinunter. Alle Drei verschwanden unten im dichten Erlengebüsche. Als ich, mühsam von Stamm zu Stamm kletternd und rutschend, endlich unten angelangt war, fand ich zunächst das leere Tellereisen! Es war zwischen zwei Erlenstämmchen hängen geblieben, und die Wildkatze hatte sich aus der Klemme gerissen, ehe Curt sich wieder aufraffen konnte. Vergebens suchte ich das nächste Terrain ab – die Katze war verschwunden. Als ich zurückkehrte, saß der alte Curt noch immer am Graben und kühlte seine zerschundenen Hände im Wasser. Neben ihm lag der Jagdranzen, aus welchem er in regelmäßigen Pausen eine Branntweinflasche hervor langte und nebenbei seinen „Heinrich“ verfluchte. Dieser hatte es für’s Gerathenste gehalten, mit dem Alten heut’ gar nicht in nähere Berührung zu kommen, und war still nach Hause gewandert.
Die Katzen mußten diese unfreundliche Behandlung ebenfalls übel aufgenommen haben, sie wurden nicht wieder am Kahlenberge gesehen und waren jedenfalls über die Grenze in ein benachbartes Revier gewechselt. In späterer Zeit meldete mir indeß der Revierförster beiläufig, daß im Laufe des folgenden Winters nach und nach vier Katzen im Revier geschossen und gefangen seien, darunter ein kolossales weibliches Exemplar mit Spuren einer früheren Verletzung am linken Hinterlauf. Curt habe dieselbe sofort als „die Seinige“ angesprochen.
Der Reformator der Erziehungslehre.
Im Jahre 1800 wurde Pestalozzi von der helvetischen Regierung das damals freistehende Schloß zu Burgdorf am Eingang des Emmenthals eingeräumt; hier begründete er mit mehreren jungen Lehrern zunächst seine Erziehungsanstalt, der bald von allen Seiten Zöglinge zuflössen. Mit seinen Gehülfen lehrte hier Pestalozzi nicht aus Büchern, sondern aus den in ihnen selbst erzeugten Bildungs- und Lehrmitteln. Ihr großes, immer offenes Buch war die sie umgebende Natur und der im Menschen waltende, in Sprache, Zahl und Form sich offenbarende Geist. Später erst entstanden aus den durch solchen Unterricht gesammelten Grundsätzen und Erfahrungen die ersten Versuche einer Anschauungslehre der Sprache, der Zahl und des Raumes (der Form und Größe) in den ersten Pestalozzi’schen Anschauungstabellen und Elementarbüchern.
Ueber die Anwendung dieser Grundsätze giebt ein mit eines Lehrers Hülfe auf dem Schlosse zu Burgdorf geschriebenes Buch Pestalozzi’s „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“ nähere Auskunft, sowie das 1803 erschienene „Buch der Mütter“. Das erstere namentlich ist ein Geisteskind, welches, obwohl ganz anders geartet, als das Buch „Lienhard und Gertrud“, doch als Volksbuch in gewisser Hinsicht ein Seitenstück zu diesem bildet. Es enthält eine am Neujahrstag 1801 begonnene Reihe von Briefen an seinen Freund Geßner in Bern, in denen er die Kunst der Veredlung des Volkes in die Hand der Mütter legen und den Versuch machen wollte, diesen Anleitung zu geben, wie sie ihre Kinder selber lehren könnten. Denn in der That galt ihm sein jetziges Erziehungshaus, wie alle Erziehungsanstalten überhaupt, nur als Nothbehelf für die mangelnde Erziehung des Elternhauses.
In seinem Hause war auch wirklich Pestalozzi die belebende Seele. Alle Glieder desselben standen ihm gleich nahe. Nicht blos die Kinder, auch die Lehrer nannten ihn Vater und hörten aus seinem Munde das trauliche Du. Mit frohem Gesicht und offenster Freundlichkeit gegen Jeden wandelte er in seinen guten Stunden im Hause, in den Lehrzimmern unter der fröhlich thätigen Jugend umher, mit Diesem oder Jenem ein paar Blicke oder Worte wechselnd. Er trat während der Unterrichtszeit bald in die eine, bald in die andere Classe auf einige Augenblicke ein, ohne sich übrigens lange darin aufzuhalten, denn er wußte, daß er seinen Gehülfen vertrauen konnte, die seine Freunde waren.
Nach dem Abtreten der helvetischen Regierung beschloß jedoch der [567] neueingesetzte Große Rath von Bern, daß das Schloß von Burgdorf – über dessen Sicherung zu seinen Erziehungszwecken Pestalozzi in seiner Harmlosigkeit versäumt hatte, sich von der helvetischen Regierung die nöthigen gerichtlichen Bürgschaften, die man ihm damals nicht verweigert hätte, geben zu lassen – der Sitz eines Oberamtmanns werden sollte. Pestalozzi ward dadurch in die traurige Nothwendigkeit versetzt, die ihm so lieb gewordene Wiege seines neuaufblühenden Werkes zu verlassen.
Zunächst zog er nun im Jahre 1804 nach dem wenige Stunden entfernten ehemaligen Klostergebäude zu Münchenbuchsee, das er aber sammt dem größern Theil seiner Zöglinge alsbald an Wellenberg in Hofwyl überließ, um selbst eines der ihm von der Waadtländer Regierung angebotenen Schlösser, das alte Yverdon oder Iserten, am Südende des Neuenburger Sees, zum Sitze seiner pädagogischen Thätigkeit zu erwählen.
Düster freilich waren die Räume des von Karl dem Kühnen erbauten alten burgundischen Schlosses, Raben und Dohlen nisteten in den vier dicken Thürmen desselben, deren Mauern von dunkelgrünem Epheu dicht umsponnen waren. Kaum für das Unentbehrlichste war die neue Anstalt eingerichtet. Die zwei großen Schlafsäle für die Zöglinge waren nicht einmal gedielt. Besondere Zimmer für sich hatten die Lehrer nicht, sondern mußten den Tag über im Getümmel irgend einer Classe an ihren Stehpulten arbeiten. An dem alten Brunnen, der sich mitten im großen Schloßhof von alten Linden umgeben befand, wurden des Morgens im Sommer und Winter lange hölzerne Röhren gelegt, die rechts und links von der Reihe der Knaben umstanden wurden, damit sie sich mit dem durch einen Hahn zulaufenden Wasser den Rest der Schläfrigkeit aus den Augen wuschen.
Das Schloß zu Yverdon oder Jserten war also der Schauplatz, wo die bald wieder vereinigte Genossenschaft des Pestalozzi’schen Erziehungshauses im Sommer 1805 ihr neues Leben begann und in einer Reihe von Jahren fortsetzte, während welcher dieses Haus, bei eifrigster Thätigkeit und Regsamkeit im Innern, auch nach außen dem Anschein nach eine glänzende Blüthe zeigte. Es erhielt, namentlich auch durch die Empfehlungen Fichte’s in seinen Reden an die deutsche Nation, und Herbart’s, bald europäischen Ruf und ward von Zöglingen aus allen Ländern besucht. Von allen Weltgegenden her kamen Lehrjünger, die sich auf Monate oder Jahre, und zum Theil sehr angesehene Fremde, die sich tagelang dort aufhielten.
Als im Jahr 1814 der König von Preußen Friedrich Wilhelm der Dritte nach Neuchâtel kam, war Pestalozzi sehr krank. Dennoch mußte ihn einer seiner Schüler und späterer Unterlehrer, Ramsauer, zum König begleiten, damit er ihm danken könne für seinen Eifer um das Volksschulwesen, den dieser insbesondere durch die Sendung so vieler Eleven nach Yverdon bethätigte. Auf der Hinreise sank Pestalozzi mehrere Mal in Ohnmacht und mußte aus dem Wagen gehoben und in ein Haus gebracht werden. Da wollte ihn Ramsauer bewegen zurückzukehren, er aber erwiderte: „Nein, schweig’ davon! Ich muß den König sehen, und sollt’ ich auch darüber sterben. Wenn durch meine Gegenwart nur ein einziges Kind in Preußen einen bessern Unterricht empfängt, so bin ich reichlich belohnt.“
Freilich vernachlässigte Pestalozzi bei dieser edelsten Aufopferung nicht selten sein Haus und ward bei der vielen Aufmerksamkeit, die er Fremden widmete, gegen die Lehrer und Zöglinge der Anstalt oft zum Schuldner.
Mit dem Jahre 1810 begannen die schon längere Zeit im Stillen sich vorbereitenden Irr- und Wirrsale des Pestalozzi’schen Hauses zu Tage zu treten. Die Unordnung in der Führung der Hauswirthschaft, welche Pestalozzi zu bewältigen keine Fähigkeit und Kraft hatte, nahm überhand; unter den Lehrern der Anstalt herrschten Reibungen, Zerwürfnisse, gegenseitige Eifersucht, bis zuletzt eine Spaltung in zwei Heerlager eintrat und schließlich Streit und Erbitterung sich so steigerten, daß Pestalozzi sich 1825 genöthigt sah, seine Anstalt ganz aufzulösen, die hieraus von einem seiner Lehrer, dem früheren Pfarrer Riederer, neu begründet wurde, und sich als achtzigjähriger Greis zu seinem einzigen Enkel auf den Neuenhof zurückzuziehen, wo er sich mit Schriftstellerei beschäftigte, die Erzählung „Lienhard und Gertrud“ fortsetzte und vollendete und 1826 als dreizehnten Band seiner sämmtlichen Schriften seinen „Schwanengesang“ veröffentlichte. Derselbe enthält ein Gemisch von Klagen über das Mißlingen seiner Lebensbestrebungen und neben langen, einförmigen Erörterungen über seine Erziehungs- und Unterrichtsgrundsätze auch manches Richtige, Rührende und Ergreifende, wobei er den Kern seines Wirkens von der Schale zu sondern und sich des Bleibenden und Unvergänglichen in seinem Lebenswerke zu freuen weiß. Gleichzeitig erschien von ihm, aber nicht als Bestandtheil seiner sämmtlichen Schriften, sondern in anderem Verlage, ein Buch unter dem Titel: „Meine Lebensschicksale als Vorsteher meiner Erziehungsanstalt in Burgdorf und Iserten.“ Hier ist sein Blick getrübt, sein Herz erbittert und sein Urtheil über die Genossen seiner Unternehmung vielfach unbillig und ungerecht.
Mit Anfang des Jahres 1827 erkrankte Pestalozzi. Am 15. Februar theilte er dem Pfarrer Steiger zu Birr, wohin der Neuenhof gehörte, mündlich seine letzten Willenserklärungen mit und ließ sich dann nach Brugg fahren, wo er am 17. Februar starb. In Birr vor dem Schulhause ward er unter dem Geleite und Gesang der Lehrer von den umliegenden Dörfern und ihrer Schulkinder in die schneebedeckte Erde versenkt. Als später die Aargauer Regierung an der Stelle des alten Schulhauses ein neues aufführen ließ, wurde der Platz, wo Pestalozzi ruhte, mit einem Gitter eingefriedigt und dahinter die Hauptseite des neuen Schulhauses zum Denkmal Pestalozzi’s gestaltet, welches über dem Brustbilde desselben die Worte enthält: „Unserem Vater Pestalozzi.“
Im Jahre 1846 begingen Tausende von Lehrern und Erziehungsfreunden in allen Gegenden Deutschlands und der Schweiz das hundertjährige Geburtsfest Pestalozzi’s, als des Vaters der neuern Pädagogik, deren edle Früchte größtenteils aus dem von ihm gestreuten Samen erwuchsen und zum Gemeingute der Menschheit wurden. Die zahlreichen Pestalozzi-Stiftungen, die seitdem entstanden, zeugen von der dauernden Verehrung der Nachwelt gegen den großen Meister und Reformator auf dem Gebiete des Unterrichtes und der Erziehung.
Die bahnbrechenden Verdienste Pestalozzi’s, so wie der Umschwung, welchen er durch Lehre und Beispiel auf jenem Gebiete veranlaßte, können nur dann vollständig gewürdigt werden, wenn man die verkehrten Grundsätze und den grauenhaften Schlendrian der alten Schule mit seiner Methode und deren Leistungen vergleicht. Das damit auf’s Engste verwachsene innerste Wesen Pestalozzi’s, welches alle Schwächen und Fehler dieser großartigen Natur bei weitem überragt, zeichnet uns einer seiner langjährigen Freunde, der verstorbene Dr. Blochmann in Dresden, der acht Jahre als Lehrer an seiner Anstalt zu Yverdon verweilte und treffliche Züge aus dem Bilde seines Lebens und Wirkens uns überliefert hat, mit den treffenden Worten: „Ich habe wenig Menschen kennen gelernt, aus deren Lebensmitte ein so reicher Strom von Liebe floß, als aus seinem Herzen. Die Liebe war recht eigentlich sein Lebenselement, der unversiechbare göttliche Trieb, der von Jugend auf all’ seinem Streben und Wirken Richtung und Ziel gab. Mit dieser seiner Liebe, in ihrer Aufopferungskraft und Uneigennützigkeit, war in ihm ein hoher Grad von Anspruchslosigkeit, Bescheidenheit und Demuth verbunden, und dieser letzteren stand in seinem Gemüthe ein Heldenmuth zur Seite, wie solcher in gleicher Kraft in keines Manschen Seele, der nicht demüthig ist, zur Erscheinung kommt.“
Das große Verdienst Pestalozzi’s besteht hauptsächlich darin, daß er „ein Grundgesetz für den Unterricht fand und es für die gesammte Erziehung ahnte; daß er zuerst, und er allein, eine Methode begründete, von welcher erst die eigentliche Wissenschaft des Unterrichts datirt.“ – Aller Unterricht gründet sich bei ihm auf Anschauung. Diese ist ihm die Grundlage aller Erkenntniß. Von ihr muß alle Lehre ausgehen und dahin wirken, daß das Kind jeden Gegenstand, der ihm zur Anschauung und durch diese zum Bewußtsein gebracht wird, als Einheit in’s Auge fasse, daß es die Form eines jeden Gegenstandes, d. h. sein Maß und sein Verhältniß, kennen lerne, daß es endlich mit dem ganzen Umfang der Worte und Namen aller von ihm erkannten Gegenstände vollständig vertraut werde. Diese seine Methode hat sich während des ersten Zeitraumes seiner erziehenden Wirksamkeit (in Staus) subjectiv ausgeprägt und in seiner Persönlichkeit concentrirt. Sein ganzes Sinnen und Streben war darauf gerichtet, die Segnungen der Wohnstube zu Segnungen der Schulstube zu machen. Im zweiten Zeitraume des Entwickelungsganges der Pestalozzi’schen Methode (Burgdorf, Yverdon) tritt die subjective Seite derselben [568] mehr zurück und die objective bildet sich einseitig aus. Die Erziehung geht mehr in Unterricht über, die Bildung wird vorherrschend intellektuell. Von Haus aus ein Gegner des Katechismus, gerieth Pestalozzi, dem anfangs das Leben mit seinen frischen Eindrücken Alles galt und der das Bücherwesen beim Unterricht haßte, später in die auffallende Verirrung, den Unterricht mechanisieren zu wollen und auf die gedruckten Methodenbücher, Anschauungstabellen etc. den größten Werth zu legen.
Zwei Mangel sind es besonders, die Pestalozzi’s System anhaften. Einmal übersieht er, daß Zahl, Form, Wort die Urformen des Denkens nicht erschöpfen. Der Mensch hat auch Farbensinn, Ortssinn, Thatsachensinn und jedem dieser Sinne entsprechende Eigenschaften. Doch läßt sich dieser Mangel leicht beseitigen, weil der Geist der Pestalozzi’schen Methode auf die Behandlung aller Gegenstände ohne Schwierigkeit übertragen werden kann. Der andere, von Pestalozzi selbst gefühlte und ausgesprochene Mangel seines Systems bestand darin, daß er neben den Kenntnissen die Fertigkeiten, neben dem Wissen das Können nicht gehörig berücksichtigte. Aber die Fertigkeiten, von deren Besitz Können und Thun abhängt, geben sich ebenso wenig von selbst, wie Einsicht und Kenntniß. Auch sie müssen durch Uebung erwachsen, auch für sie muß ein A-B-C der Thätigkeit erfunden werden, das von den einfachsten Aeußerungen der physischen Kräfte, die ja die Grundlage aller menschlichen Fertigkeiten enthalten, ausgeht und so die Vorbedingung einstiger höchster Vollkommenheit zu Wege bringt. Hier nun trat Friedrich Fröbel ergänzend ein, indem er lehrte, zur Arbeit durch Arbeit, zur Thätigkeit durch Selbstthätigkeit zu erziehen. So schuf er die genetisch entwickelnde, überall an das praktische Leben anknüpfende Methode in seinen Spiel- und Beschäftigungscirkeln, seinen Kindergärten und Erziehungsgrundsätzen überhaupt. Wie auf dem Gebiete der Volksschule die Gedanken Pestalozzi’s in Diesterweg ihren namhaftesten Vertreter, Verbreiter und Fortbildner gefunden haben, so hat Fröbel Pestalozzi’s Ideen auf dem ihnen eigenthümlichen Gebiete des Hauses und der Kinderstube am glücklichsten vervollständigt und ergänzt. Die Aufgabe der Gegenwart aber ist es recht eigentlich: „den Waldboden zu schaffen, auf dem die in Haus, Kindergarten und Schule gezogenen Stecklinge die reichste, beste Nahrung finden, damit aus diesen Zöglingen Menschen werden, wie sie das Ideal der erziehlichen Bestrebungen Pestalozzi’s, Fröbel’s, Diesterweg’s, jenes großen Dreigestirns von Menschenbildnern, waren; Menschen,“ wie Wichard Lange sagt, „aus einem Guß, mit einer organischen Weltanschauung und einer einheitlichen, grundsatzgemäßen charaktervollen Wirksamkeit.“
Im Vorzimmer des Parlaments.
In unseren constitutionellen Zeiten haben die Vorzimmer der Könige Concurrenten bekommen. Auch in den Vorhallen der Räume, in denen die gesetzgebenden Versammlungen debattiren, finden sich Schwärme von Bittstellern und Ränkeschmieden ein. In den Vereinigten Staaten bilden diese Lobbyers – von lobby Vorhalle, so genannt – eine besondere Classe und genießen der Achtung, die wir den beharrlichen Supplicanten der Vorzimmer der Könige zollen. England hat ebenfalls seine Stammgäste des Parlamentsganges, doch sind sie interessanter und achtbarer als die Lobbyers von Washington.
Dieser Gang ist ein stattlicher Raum. Seine mit Eichenholz getäfelten Wände und Decke, seine gemalten Glasfenster, sein ausgelegter Fußboden, seine mächtigen Candelaber von Bronze geben ihm ein vornehmes und ernstes Aussehen. In einem Winkel steht ein Schenktisch, an dem die Mitglieder zur Sommerszeit sich mit Eis und Limonade abzukühlen und zur Winterszeit mit Sherry und Limonade zu erwärmen pflegen. Unter den verschiedenen Thüren zieht eine, von massivem Eichenholz und mit Eisen beschlagen, die Blicke besonders auf sich: sie führt in den Sitzungssaal. Es ist noch früh am Tage, aber der Gang hat sich schon hübsch gefüllt. Gruppen von Menschen erwarten die Ankunft der Parlamentsmitglieder, und alle Augen ruhen auf der Glasthür, durch welche die Ersehnten eintreten müssen. Hier steht eine Deputation eines frommen Vereins, die Herrn Newdegate, dem langjährigen Führer der strengkirchlichen Partei im Unterhause, irgend eine kirchliche Frage dringend an’s Herz legen will. Die ehrwürdigen Herren, aus denen sie besteht, sind mit Bittschriften beladen, und wie sie so auf einen Klumpen zusammengedrängt dastehen, lassen sie die Stelle, wo ihr Opfer sich zeigen muß, nicht einen Augenblick aus den Augen. Dicht neben ihnen steht ein glattrasirter Mann mit ascetischen Zügen und einem langen Rock, unverkennbar ein katholischer Priester. Er ist übrigens glücklicher als seine kirchlichen Rivalen, denn er hat bereits einen irischen Abgeordneten am Rockknopfe und setzt ihm die besondern Wünsche der Katholiken im Städtchen Ballyhoolau auseinander. Dort wartet ein lebenslustiger und rothbackiger Landjunker auf einen Freund, den Vertreter der Grafschaft, der ihm für die heutige Nacht ein Billet für die Galerie des Sprechers, oder vielleicht sogar einen der bevorzugten Plätze „unter der Glocke“ versprochen hat. Der bleiche junge Mann dort, der einen so auffallenden Contrast mit dem Squire bildet und sich durch seinen Anzug als einen Mann aus dein Volk verräth, ist durchaus nicht die unbedeutende Persönlichkeit, für die man ihn halten könnte. Wir werden gleich sehen, daß er mit den angesehensten Mitgliedern des Hauses auf dem Fuße der Gleichheit verkehrt, und es läßt sich fragen, ob es viele Namen von Abgeordneten giebt, die von einem Ende Englands bis zum andern so allgemein bekannt sind, wie der Name dieses jungen bleichen Mannes im schlichten Rock. Es ist Georg Potter, der Leiter der Handwerkervereine. Der ältliche Mann mit dem tief gefurchten Gesicht, der hinter ihm steht und mit einem Freunde von militärischer Haltung spricht, ist ebenfalls ein Führer des Volks, Beales. Sein Gefährte ist sein getreuer Schildknappe, Oberst Dickson, den die Arbeiter für einen der Londoner Wahlbezirke als Candidaten für die bevorstehenden Wahlen aufgestellt haben. Man wird den Parlamentsgang selten betreten können, ohne einem dieser Herren zu begegnen.
Jener schlanke, schöne Mann mit einer Camellie im Knopfloche, der so ausgesucht fein gekleidet ist und dem man es ansieht, wie sehr er mit sich selbst, der um ihn stehenden Gruppe von Zuhörern und der Welt im Allgemeinen zufrieden ist, gehört nicht zu den Ministern. Die meisten Engländer kennen seinen Namen nicht und nie begegnet man ihm in den Zeitungen. Aber auf jeder Bühne, auch auf der politischen, giebt es Leute hinter den Coulissen, die mindestens ebenso wichtig sind, wie die Schauspieler auf der offenen Scene. Eine allgemeine Wahl könnte ohne die Beihülfe dieses Mannes nicht durchgeführt werden und eine Ministerkrisis, mit der er nichts zu thun hätte, ist nicht denkbar. Was würde aus der „großen conservativen Partei“ werden, wenn er sich in’s Privatleben zurückzöge! Herr Spofforth ist ja der Agent der Conservativen, und man erzählt sich von seinem politischen Einfluß wunderbare Geschichten. Der Mann mit leicht jüdischen Zügen, der ihm so aufmerksam zuhört, ist kein Tory, vielmehr der Eigenthümer und Leiter einer großen liberalen Zeitung. Vermuthlich erwartet er, daß dem Agenten seiner Gegner einige Worte entfallen, die ihm Winke über das feindliche System bei den nahen Wahlen geben. Außer ihm sind Journalisten aller Art, Eigenthümer, Redacteure, Berichterstatter und Londoner Correspondenten gegenwärtig. Einige verweilen die halbe Nacht im Gange und sprechen mit Einem nach dem Andern, während Mancher auf einen einzigen bestimmten Abgeordneten lauert, auf ihn zuschießt, wenn derselbe erscheint, eine einzige Frage stellt und mit zufriedenem Gesicht davoneilt.
Fast ebenso zahlreich wie die Journalisten sind die Privatsecretäre. Manche stehen blos eine Stufe über dem Range des Kammerdieners, während andere die Söhne von Cabinetsministern sind und einst eine hohe Stellung einnehmen werden. Welche Unterstützung ist ein guter Privatsecretär für einen Staatsmann! Die Briefe, die er schreibt, die Bestellungen, die er ausführt, haben nicht sehr viel zu sagen, aber versteht er sein Fach und besitzt er Tact, so weiß er Zudringliche vom Cabinet des Ministers fern zu halten und den Abgewiesenen zufrieden zu stellen. Dort geht ein Privatsecretär mit einem Minister Arm in Arm und ein Schwarm von Bittstellern wartet schon, um sich ihm zu empfehlen, wenn der große Mann ihn verläßt. Es ist vielleicht kein schroffer [569] Uebergang, wenn wir uns vom Privatsecretär zu jenen Herren wenden, die in einer Linie neben dem Eingang stehen. Sie sind keine gewöhnlichen Besucher des Ganges und ihr Charakter verräth sich darin, wie sie Alles anstaunen. Wie bedauernswürdig ist der Abgeordnete von Little Stoke Pogis, der gleich erscheinen wird und sich eine halbe Stunde mit ihnen unterhalten muß, wenn er nicht bei der nächsten Wahl ihre Stimmen verlieren will!
Die Zeit vergeht, doch bleibt uns noch ein Augenblick für die Betrachtung der würdigen und fein gekleideten Herren, welche die Armstühle zu beiden Seiten der Thür einnehmen. Sie sind keine Herzöge, wenn sie auch gelegentlich dafür gehalten werden sollten, sondern einfach Thürsteher. Diese Herren sind wichtige Personen und verrathen ein großes Selbstbewußtsein. In kleinen Behältern neben ihren Stühlen liegen unzählige Briefe, die für die Mitgliedern des Hauses bestimmt sind und beim Eintritt der Eigenthümer abgegeben werden. Das Hauptgeschäft dieser Herren besteht darin, unbefugte Personen fern zu halten, und sie müssen sich daher die Gesichter der Abgeordneten genau merken. In den Provinzen erzählt man sich eine Lieblingsgeschichte von einem Fremden, der nach London kam und Westminster sehen wollte, aber aus Irrthum in’s Unterhaus gerieth und mitten unten den Mitgliedern Platz nahm. Ein solcher Fall kann indeß nicht vorkommen, denn nach jeder Wahl bitten die Thürsteher die vorübergehenden neuen Mitglieder um ihre Namen und fahren damit so lange fort, bis die Gesichter ihnen bekannt sind.
„Hüte ab!“ ruft ein Polizeimann aus einem Winkel, und sofort entblößen sich alle Köpfe. Vier andere Polizeidiener schaffen unter der Menschenmenge des Ganges Platz, und nun meldet eine zweite Stimme den Sprecher an, worauf eine kleine Procession erscheint, die den ersten „Gemeinen“ Englands auf seinen Posten geleitet. Zuerst kommt ein Ceremonienmeister; dann folgt Lord Charles Russell in voller Hoftracht und mit einem goldenen Scepter auf der Schulter. Nun zeigt sich der Sprecher selbst in voller Perrücke und einem langen Ueberkleide, mit seinem Caplan an seiner Seite und mit seinem Schleppenträger hinter sich, der den Saum des Kleides trägt’. Die Gesellschaft geht durch die Thür, die sich halb hinter ihr schließt, und bald darauf ruft einer der Herren in den Lehnsesseln: „Der Herr Sprecher ist beim Gebet!“ und dann werden die Thüren geschlossen und Niemand darf mehr eintreten, bis das Gebet vorüber ist. Im Unterhause gilt die Regel, daß diejenigen Mitglieder, welche beim Gebet schon anwesend sind, sich ihren Platz für die ganze Sitzung sichern können. Sie belegen, indem sie ihre Karte in den kleinen Rahmen von Bronze einschicken, der an der Rücklehne jedes Sitzes befestigt ist. Gewisse Personen finden immer denselben Platz. Die Ministerbank bleibt natürlich den Räthen der Krone vorbehalten und auch die erste Bank auf der Seile der Opposition ist in festen Händen. Außer diesen Plätzen giebt’s nur einige wenige, die man bestimmten Personen überläßt. Zu diesen gehören Bright, der blinde Fawcett, General Peel, Stuart Mill, Baines, Newdegate, Wetzel und noch zwei oder drei andere. Unter diesen dürfen wir Herrn Kavaragh nicht vergessen. Dieser Gentleman wurde ohne Arme und Beine geboren und kann sich ohne Beihülfe nicht bewegen. Ein Diener trägt ihn in’s Haus und setzt ihn auf den Platz. Wird abgestimmt, so kann er natürlich nicht mit in eines der Vorzimmer gehen, in welche die Mitglieder sich begeben, die „Jas“ nach rechts, die „Neins“ nach links. Die beiden Stimmenzähler müssen zu ihm kommen und ihn allein auf seinem Platze abstimmen lassen.
Wir müssen in den Gang zurückkehren und den Strom von Mitgliedern beobachten, der sich durch ihn ergießt. Der gutmüthige Polizeiaufseher, der eine der stehenden Figuren des Ortes ist, steht immer unter einer Menge von Engländern und Fremden und nennt ihnen die berühmten Mitglieder, die vorbeigehen. Wir treten zu der Gruppe, um von seiner Personenkenntniß Nutzen zu ziehen. Hier kommt Bright, der große Radicale und Sprecher der Manchesterschule, der immer einer der Ersten ist. Er ist stärker geworden als in den Tagen des Kampfes gegen die Korngesetze, und sein Backenbart wie sein Haar haben beinahe eine weiße Farbe angenommen, aber das schöne Auge hat nichts von seinem alten Feuer verloren. Jener magere altmodisch gekleidete Mann, der ein wenig hinkt, ist Stuart Mill, der geistreiche Schriftsteller und Nationalökonom. Ihm folgt einer seiner besten Schüler, Henry Fawcett, geführt von einem kleinen Knaben. Jener Mann mit dem Augenglase, der zwischen der Menge im Gange hin- und hereilt und für Jeden ein Wort und einen Händedruck hat, ist Maguire, der Biograph des Vaters Mathew, und jener kurzsichtige Herr mit kurz abgeschnittenem grauen Bart und militärischer Haltung ist eine zweite literarische Berühmtheit des Hauses, der hier vertraulich als Cothen Kinglake bezeichnet wird. „Cothen“ ist der Titel der Beschreibung seiner Reise in den Orient, die in England in hohem Ansehen steht. Zufällig trifft es sich so, daß eben der Herausgeber der Times an ihm vorbeigeht. Nach seinen breiten und offenen Zügen sollte man ihn eher für einen Landjunker halten, als für das mächtige Wesen, dem das große Orakel der europäischen Presse gehorcht.
Die Mitglieder drängen sich nun so zahlreich herein, daß man die einzelnen kaum zu bemerken vermag. Hier aber ist eine Persönlichkeit, die wir nicht unbeachtet lassen dürfen. Dieser große Mann mit dem grauen Schnurrbart und den melancholischen Augen ist Lord John Manners. Er nimmt im Ministerium keine hervorragende Stelle ein, aber wir betrachten ihn mit Interesse, denn er war einmal die Hoffnung des jungen Englands. Disraeli, der ihn zum Helden eines seiner Romane machte, ist hoch über seinen Kopf emporgestiegen; allein er hängt an seinem alten Freunde mit einer Liebe, die wir nicht übersehen dürfen, und darum sitzt Lord John Manners gegenwärtig auf der Ministerbank.
Nicht zu verkennen ist der Mann, welcher jetzt kommt, mit scharfen grauen Augen umherblickt, die ganze Versammlung mit einem Blick überfliegt und rasch in das Haus geht. Jeder hat das edle gedankenvolle Gesicht schon gesehen, in das der Kummer mehr Furchen gegraben hat als die Zeit. Alles tritt ehrfurchtsvoll zurück und nicht Wenige nehmen den Hut ab, während Gladstone, das Haupt der vorgeschritteneren Whigs und der Ministerpräsident der nächsten Zeit, bei ihnen vorbeigeht. Selbst seine Gegner achten ihn wegen seiner Ehrlichkeit hoch, und Niemand spricht ihm die großen Eigenschaften ab, denen er seine eigenthümliche und fast beispiellose politische Laufbahn verdankt. Er ist schon vorbei, ehe wir ihn ordentlich gesehen haben, und indem wir ihm mit den Blicken folgten, übersehen wir einen andern merkwürdigen Mann, dessen Lob Conservative und Liberale zugleich singen, den Minister des Aeußern, Lord Stanley.
Herr Lowe, der in Australien seine Schule gemacht und sich den Liberalen angeschlossen hat, ist der nächste Vorübergehende. Sein rothes Gesicht und schneeweißes Haar machen ihn zu einer auffallenden Erscheinung. Hier ist der Premierminister selbst. Er geht mit trippelnden Schritten, schwingt mit den Armen und schlägt die Augen nieder, so daß er die Grüße nicht bemerkt, mit denen man ihn empfängt. Wie lange ist es her, als er, arm und unbekannt, jene wunderbare Laufbahn betrat, auf der er zuletzt zu den Stufen des Thrones gelangt ist und nun die Zügel des britischen Weltreichs in der Hand hält. Den Mann umgiebt ein stark romantisches Licht. Sieht man ihn, so denkt man unwillkürlich an „Vivian Grey“, dessen Schicksale er in einem seiner Romane erzählt, an seine dornenvolle Jugend, seine Kämpfe, seine Versuchungen, seinen schließlichen Triumph, und denkt man daran, so fühlt man eine große persönliche Sympathie mit dem Manne, der so viel gelitten und so viel erreicht hat.
Nach Disraeli hat man für die kleineren Berühmtheiten, die noch kommen, kein Interesse mehr. Es giebt genug, die zu sehen und deren Schicksale zu studiren der Mühe werth ist, doch ist die Neugier des Fremden gewöhnlich befriedigt, wenn er seine Augen an dem großen Kleeblatt des Hauses, an Bright, Gladstone und Disraeli geweidet hat. Wir verweilen übrigens noch einen Augenblick, um jenen Herrn in untadelhaftem Anzuge zu betrachten, der eben einen glatt anschließenden Handschuh auszieht, um einem Freund die Hand zu drücken. An dem Manne ist durchaus nichts Schreckliches, und er scheint der jüngere Sohn eines Lords zu sein. Es ist der O’Donoghue, den Tipperary anbetet und dessen Ansprüche auf den Thron von Irland mehr als einmal öffentlich vertheidigt worden sind. Ein größerer Contrast als der zwischen seinem Aeußeren und seinem Ruf läßt sich kaum denken. Als er in’s Unterhaus trat und den Eid leistete, war Alles verwundert, statt des wilden rothhaarigen Rebellen, den man erwartete, diesen eleganten jungen Herrn zu sehen.
[570] Während des ganzen Abends geht es im Gange lebhaft her. Fortwährend kommen Herren und lassen Mitglieder herausrufen, die gewöhnlich nicht gerade gern erscheinen. Freunde, Wähler, Bittsteller, geheime Rathgeber – alle Sorten von Personen versammeln sich an diesem Platze. Hier werden auch jene wunderbaren Gerüchte ausgebrütet, welche in aufgeregten Zeiten von der Presse wie auf Flügeln durch die Welt getragen werden. Hier hören wir – gewöhnlich von einem irischen Mitgliede – daß ein Riß im Cabinet entstanden ist, oder daß Disraeli die Auflösung des Parlaments bereits in der Tasche hat. Die Stammgäste des Ganges wissen von dem Geheimniß der beiden großen politischen Parteien bedeutend mehr, als die Führer jener Parteien selbst, und dem „Londoner Correspondenten“, der hier täglich einen Theil seiner Zeit verbringt, mißlingt es nie, ein ganzes Paket überraschender Neuigkeiten mit sich fortzunehmen, die er seinen Lesern in der Provinz auftischen kann. Neben diesen komischen Seiten des Ganges tritt keine häßliche Seite stark hervor. Erinnert man sich, daß das Vorzimmer des heutigen Unterhauses eine größere Wichtigkeit besitzt, als der Controleurgang vor Joseph’s des Zweiten Cabinet einst besaß, so kann man sich nur freuen, daß dieses Vorzimmer keines der demüthigenden Schauspiele gewährt, die man in anderen Vorzimmern erlebt hat und noch heute erlebt. Man kann den ganzen Abend dastehen und wird nichts Verletzendes sehen, keine der unwürdigen Schmeicheleien oder Drohungen hören, die anderswo nicht unbekannt sind. Doch sieh’ da, die Debatte ist beendet. Die Sitzung war interessant, aber kurz. Die Mitglieder eilen zum Abendessen, die elektrischen Glockenzüge klingeln im ganzen Hause, und jetzt ruft der Thürsteher laut: „Wer geht heim?“ Die einmal hergebrachte Frage ist sonderbar, denn es versteht sich von selbst, daß Alles geht, wenn das Spiel aus ist.
Man kann es den Lesern der „Gartenlaube“ gar nicht verdenken,
wenn sie sich ein wenig verwundert haben, als sie von dem Eifer hörten,
mit welchem die Großmächte der Erde in diesem Jahre sich rüsteten,
Expeditionen in das ferne Arabien und Indien zu entsenden, nicht
etwa, um dort Länder zu erobern oder eine ihnen angethane Beleidigung
blutig zu rächen, auch nicht um den widerstrebenden
Völkern die Wohlthat europäischen Schutzes oder die noch größere
Wohlthat christlicher Civilisation aufzudrängen, sondern lediglich,
um ein kleines Ereigniß am Himmel von nur wenigen Minuten
Dauer beobachten zu lassen. Denn daß die Sonnenfinsternisse
gerade so ganz außerordentliche Erscheinungen seien, behaupten
die Astronomen nicht einmal, die uns vielmehr belehren, daß sie
weit häufiger als die Mondfinsternisse vorkommen. Im Laufe
von achtzehn Jahren, sagen sie, kommen durchschnittlich neunundzwanzig
Mondfinsternisse und einundvierzig Sonnenfinsternisse vor,
und es können sogar vier Sonnenfinsternisse in einem einzigen
Jahre stattfinden. Nun mag es sich freilich mit den Sonnenfinsternissen
doch etwas anders verhalten, als mit den Mondfinsternissen.
Letztere werden durch den Eintritt des Mondes in
den Schatten der Erde erzeugt, dem Mond wird also dabei das
Licht der Sonne wirklich entzogen, und alle Orte der Erde, denen
der Mond überhaupt über dem Horizonte steht, also fast über die
ganze Halbkugel hin, müssen die Finsterniß in der gleichen Weise
sehen. Bei den Sonnenfinsternissen dagegen wird durch das Dazwischentreten
des kleinen Mondes nicht der ganzen Halbkugel der Erde
das Licht der Sonne gleichmäßig entzogen; die Sonne kann vielmehr
dem einen Orte gänzlich, dem andern nur zum Theil verfinstert
erscheinen und an einem dritten Orte vollkommen sichtbar bleiben.
Totale Sonnenfinsternisse können darum allerdings für einen bestimmten Ort zu den seltneren Erscheinungen gehören, und es kann vorkommen, wie es Paris im neunzehnten Jahrhundert widerfährt, daß ein einzelner Ort ein ganzes Jahrhundert hindurch keine totale Sonnenfinsternis; zu sehen bekommt; London ist sogar, wie man berechnet hat, vom Jahre 1140 bis zum Jahre 1715, also in einem Zeitraum von fünfhundertfünfundsiebenzig Jahren nicht ein einziges Mal durch ein solches Ereigniß beglückt worden. Man kann also doch wohl zugeben, daß manche Länder, daß vielleicht England und Frankreich, Oesterreich und die nordamerikanischen Staaten einige Veranlassung haben mochten, ihre Gelehrten in jene bevorzugten Gegenden des Aequators zu senden, die von den Küsten des rothen Meeres bis zur Küste von Neuguinea am 18. August d. J. das Glück genossen, von einer so seltenen Naturerscheinung heimgesucht zu werden. Freilich schwerer begreiflich wird man es finden, daß selbst Rom seine Gelehrten dorthin sendete, da man im Allgemeinen der Meinung ist, daß es seine Peterspfennige zu andern Dingen nöthiger braucht, als um ein seltenes Naturphänomen im Dienste der profanen Wissenschaft beobachten zu lassen. Vollends unbegreiflich aber wird man es finden, daß auch der Norddeutsche Reichstag sich mit diesem Ereigniß befaßt hat, daß sogar auf Veranlassung und im Auftrage des Norddeutschen Bundes eine Doppel-Expedition nach Aden an der arabischen Küste und in das Innere Indiens zu seiner Beobachtung abgegangen ist.
Wir sind an dergleichen Regierungsunternehmungen von den Zeiten des seligen Bundestages her so gar nicht gewöhnt, daß wir wirklich etwas ganz Außerordentliches dahinter vermuthen müssen. Nun kommen vollends die Astronomen und erzählen uns, daß noch im Laufe der nächsten Jahrzehnte, am 19. August 1887, eine totale Sonnenfinsterniß sich die Ehre geben wird, sich in Berlin und an anderen Orten Norddeutschlands öffentlich sehen zu lassen, und wir wissen, daß wir bei einer solchen Ankündigung keine rothen Zettel zu fürchten haben, daß höchstens eine Wolke an unserem launenhaften deutschen Himmel uns das Schauspiel verderben kann. Warum wartete man denn nicht diese bequeme und billige Gelegenheit ab und ersparte so die Tausende, welche diese Expedition kostete, wenn denn doch einmal etwas für Wissenschaft und Aufklärung geschehen soll für unsere darbenden Schulen? Es muß also doch wohl eine ganz besondere Bewandtniß mit dieser Sonnenfinsterniß vom 18. August haben, und diese hat es in der That. Wir wollen daher versuchen, unsern Lesern in möglichster Kürze und Deutlichkeit eine Vorstellung davon zu verschaffen, worin sich diese Sonnenfinsterniß von allen andern unterscheidet und welche Zwecke überhaupt die Beobachtung einer Sonnenfinsterniß verfolgt.
In der That ist eine totale Sonnenfinsterniß keineswegs wie die andere. Was sie ganz besonders unterscheidet, das ist ihre Dauer. Offenbar ist diese Dauer zunächst durch das Verhältniß der scheinbaren Größen der beiden einander verdeckenden Himmelskörper zur Zeit des Ereignisses bedingt. Denn daß Sonnen- und Mondscheibe uns nicht immer gleich groß erscheinen, ist bekannt, weil Sonne und Mond wegen der länglichen elliptischen Form der Mond- und Erdbahn sehr verschiedene Entfernungen von uns einnehmen können. So kann der Mond einmal achtundvierzigtausendsechshundert, ein ander Mal einundfünfzigtausendsechshundert Meilen von uns entfernt sein. Die Verfinsterung der Sonnenscheibe durch die Mondscheibe muß nun offenbar um so länger dauern, je größer die scheinbare Fläche des verdeckenden Mondes und je kleiner die verdeckte scheinbare Sonnenscheibe ist. Am größten erscheint uns aber der Mond in seiner Erdnähe, am kleinsten die Sonne in ihrer Erdferne. Vereinigen sich also diese beiden Umstände zur Zeit, wo Sonne, Mond und Erde in einer geraden Linie stehen, also eine Sonnenfinsterniß veranlassen, so kann die totale Verfinsterung an Orten des Aequators bis zu sieben Minuten achtundfünfzig Secunden währen. Tritt aber das Umgekehrte ein, ist der Mond sehr weit von der Erde entfernt, die Sonne dagegen sehr nahe, so dauert die totale Finsterniß nur etwa zwei bis drei Minuten. Dies war bei den letzten totalen Sonnenfinsternissen der Fall, bei der vom 28. Juli 1851 und bei der vom 18. Juli 1860.
Bei der jetzigen dagegen finden sich nahezu die günstigsten Bedingungen erfüllt. Die Sonne ist am 1. Juli dieses Jahres in ihre größte Erdferne getreten und hat sich während der sechs Wochen bis zum Ereigniß noch kaum merklich genähert. Der Mond dagegen trat gerade in der Nacht vom 17. zum 18. August, sechs Stunden vor der Finsterniß, in seine größte Erdnähe. Dadurch geschah es, daß bei dem betreffenden Ereigniß die totale Verfinsterung die seltene Dauer von sechs Minuten sechsundvierzig [571] Secunden erreichte. Allerdings würde diese Dauer trotz der günstigen Stellung der drei Himmelskörper doch nicht ganz erreicht worden sein, wenn nicht ein anderer wichtiger Umstand hinzugekommen wäre, wenn nämlich nicht der Schattenkegel des Mondes gerade über einen Erdgürtel hingestrichen wäre, der in unmittelbarer Nähe des Aequators liegt. Einmal wurde dadurch, wenigstens für diejenigen Orte, an welchen die Finsterniß um Mittag stattfand, die Entfernung des Mondes von dem Beobachter abermals nicht unbeträchtlich verringert und damit sein scheinbarer Durchmesser vergrößert. Sodann aber wurde die Dauer der Finsterniß auch insofern verlängert, als der Schattenkegel des Mondes hier auf Punkte der Erdoberfläche traf, welche die größte Umdrehungsgeschwindigkeit besitzen und daher auch am schnellsten dem vorüberziehenden Mondschatten nacheilen können. Endlich aber erlangt der Umstand, daß die Zone der totalen Finsterniß in die Nähe des Aequators fällt, auch dadurch noch eine ganz besondere Wichtigkeit, daß der Raum, innerhalb dessen das Ereigniß beobachtet werden konnte, eine ungewöhnliche Ausdehnung erlangt. Dieser Raum beträgt nicht weniger als zweitausend Meilen in der Länge und etwa dreißig Meilen in der Breite und umfaßt überdies Landstriche, die für den Astronomen zu den glücklichsten gehören, da sie kaum Störungen durch die Ungunst des Wetters befürchten lassen. Wie wichtig aber eine möglichst reiche Auswahl von Beobachtungsorten und eine möglichst große Entfernung derselben ist, werden wir aus der Art der Arbeiten ersehen, die den Astronomen bei einem solchen Ereigniß beschäftigen. Jedenfalls hat in der ganzen historischen Zeit noch keine Sonnenfinsterniß stattgefunden und wird sich auch in vielen Jahrhunderten keine ereignen, welche durch ein ähnliches Zusammentreffen glücklicher Umstände begünstigt wird. Die Sonnenfinsterniß vom 18. August dieses Jahres war also wirklich eine der seltensten Erscheinungen dieser Art.
Werfen wir nun einen Blick auf die Beobachtungen, um welche es sich bei einer solchen Finsterniß handelt. Der eine Theil dieser Beobachtungen ist streng astronomischer Natur. Es gilt nämlich, genau die Zeit festzustellen, in welcher die Finsterniß beginnt, den Punkt der Sonnenscheibe, welcher zuerst mit der Mondscheibe in Berührung kommt, die Zeit, wann eine bestimmte Erhöhung am Umfange des Mondrandes einen Theil der Sonne zu bedecken beginnt, die Zeit des vollständigen Verschwindens der Sonnenscheibe und des Wiedererscheinens des ersten hellen Lichtpunktes am entgegengesetzten Sonnenrande, endlich die Zeit des Endes der Finsterniß, die von der Zeit des Anfangs derselben höchstens um vier und eine halbe Stunde verschieden sein kann. Man wird fragen: wozu noch diese Zeiten beobachten, die der Astronom sich doch rühmt, so genau vorherberechnen zu können? Allerdings sind sie mit Hülfe der überaus genauen Kenntniß, welche die Astronomen von der Bewegung der Erde und der noch weit zusammengesetzteren des Mondes besitzen, für jeden Beobachtungsort im Voraus genau berechnet. Diese Berechnung selbst bedarf auch keineswegs der Controle, wohl aber bedürfen einer solchen die Zahlen, welche der Rechnung zu Grunde liegen, z. B. die Zahlen, welche sich auf die augenblickliche Entfernung der Erde vom Monde und von der Sonne, oder welche sich auf den jedesmaligen Ort des Mondes in seiner Bahn beziehen. Bestätigen die Beobachtungen die Rechnung, treten die Erscheinungen genau in den vorausbestimmten Zeiten ein, so waren auch die der Rechnung zu Grunde liegenden Zahlen richtig. Stimmen aber die Beobachtungen nicht vollständig mit der Rechnung überein, weichen jene Zeiten auch nur etwa um Zehntheile einer Secunde von den vorausberechneten ab, so führt dies rückwärts zur Berichtigung jener zu Grunde liegenden Zahlenannahmen, also zur Berichtigung der so wichtigen sogenannten Elemente der Erd- und Mondbahn. Man wird nun leicht begreifen, daß für diese Controle die Dauer der Finsterniß und die Zahl und der Abstand der Beobachtuugsorte von der allergrößten Bedeutung sind.
Eine zweite Art von Beobachtungen, welche eine totale Sonnenfinsterniß herausfordert, gehört mehr der physischen Astronomie an. Sie beziehen sich auf die Natur der Sonnenoberfläche und der Lichterscheinungen in ihrer Umgebung. Die eigenthümliche Dämmerung, welche eintritt, wenn die Sonnenscheibe völlig durch den Mond verdeckt ist, gestattet Manches zu sehen, was sich sonst in dem blendenden Glanze der Sonne verbirgt. Gäbe es einen Planeten, der sich in noch größerer Nähe als der Mercur um die Sonne bewegte, wie ja in der That der berühmte Leverrier das Dasein eines solchen aus gewissen Störungen des Mercurlaufes durch Rechnung nachgewiesen haben will, so wird er auch dem noch so scharf bewaffneten Auge des Astronomen niemals anders sichtbar werden, als bei Gelegenheit einer solchen Sonnenfinsterniß. Die ungewöhnliche Dauer der jetzigen und der dadurch bedingte ungewöhnliche Grad der Verdunkelung der Sonnenumgebung muß das Ausspähen nach diesem unbekannten und zweifelhaften Weltbürger ganz besonders begünstigen. Aber noch ungleich mehr wird jene wunderbare Lichtkrone die Aufmerksamkeit des Astronomen in Anspruch genommen haben, jener leuchtende Strahlenkranz, der sich um die gänzlich verfinsterte Sonne bis auf einen Abstand von etwa einem Dritttheil des scheinbaren Monddurchmessers erstreckt und der am inneren Rande so hell strahlt, daß man fast zweifeln könnte, ob wirklich die ganze Sonne verfinstert sei, während er sich nach außen unmerklich in den Himmelsraum verliert. Für diese merkwürdige Erscheinung hat man noch immer keine genügende Erklärung.
Bekanntlich hat man bisher angenommen, daß die Sonne selbst ein dunkler Körper sei, der von mindestens zwei Umhüllungen umgeben werde, einer inneren, in mattem Lichte leuchtenden, einer sogenannten Dunsthülle, und einer äußeren, der sogenannten Lichthülle, von welcher das uns zukommende Sonnenlicht ausstrahle. Durchbrechungen dieser Hüllen, trichterförmige Dehnungen in denselben sollten denn die bekannten Sonnenflecken und ihre grauen Ränder erklären. Für das Entstehen jener Lichtkrone mußte man freilich noch eine dritte Umhüllung, eine sogenannte Wolkenhülle annehmen, die für gewöhnlich nicht sichtbar sei, weil sie von der Lichthülle überstrahlt werde, sofort aber als Lichtkrone erglänze, wenn uns durch Dazwischentreten des Mondes das Licht der eigentlichen Lichthülle entzogen werde. Aber in der neueren Zeit hat namentlich die sorgfältige Beobachtung der Sonnenflecken auf Erscheinungen aufmerksam gemacht, wie die feinen Lichtadern und die als „Weidenblätler“ bezeichneten schlanken, zugespitzten Lichtkörper photographisch aufgenommener Sonnenflecke, die jene Erklärung durchaus unhaltbar machen. Dazu kommen die völlig räthselhaften sogenannten Protuberanzen, die sich bei totalen Sonnenfinsternissen in dem Augenblicke zeigen, wo der letzte Lichtfunke verschwunden ist. Es sind blaßröthliche Hervorragungen, die an dem Rande des dunkeln Mondes wurzeln und die einige Beobachter mit röthlichen zackigen Bergen, andere mit gerötheten Eismassen, wieder andere mit unbeweglichen gezahnten rothen Flammen verglichen haben. Ja sie hängen nicht einmal immer mit dem Rande des Mondes oder der Sonne zusammen, sondern bilden bisweilen völlig abgetrennte rothe Flecke. Was sie in Wirklichkeit sind, ist noch völlig unerklärt; nur daß sie weder Mondberge noch Sonnenberge sein können, ist gewiß, da sie im ersteren Falle eine Höhe von dreißig bis vierzig, im zweiten eine Höhe von sechszehntausend Meilen haben müßten.
Die Lösung dieser interessanten Räthsel kann, wenn irgend je, mit Aussicht auf Erfolg nur bei Gelegenheit der eben stattgefundenen Sonnenfinsterniß versucht werden, nicht nur weil die seltene Dauer derselben die Beobachtung begünstigt, sondern auch weil die heutige Wissenschaft im Besitz von Beobachtungsmitteln ist, von denen man früher keine Ahnung hatte. Abgesehen von der photographischen Kunst, deren glänzende Fortschritte das flüchtige Ereigniß in ungemein scharfen Bildern zu fixiren gestattet, steht dem Astronomen jetzt die Spectralanalyse, eine der großartigsten Entdeckungen, die je in einer Wissenschaft gemacht worden, zu Gebote. Diese Spectralanalyse gestattet bekanntlich aus dein Farbenbilde, welches ein Lichtstrahl bei seinem Durchgänge durch ein dreiseitiges Glasprisma erzeugt, auf die Natur der Lichtquelle selbst zurückzuschießen, namentlich zu entscheiden, ob diese Lichtquelle ein glühender fester oder flüssiger Körper oder ein glühendes Gas ist, und sogar welcher stofflichen Natur die glühenden Gashüllen sind, durch welche das Licht etwa hindurch gegangen ist. Schon jetzt hat die Spectralanalyse entschieden, daß unsere Sonne ein in Weißglühhitze befindlicher fester oder flüssiger Körper ist, umgeben von einer unserer Atmosphäre ähnlichen gasförmigen Hülle von geringerer Leuchtkraft und niedrigerer Temperatur, in welcher zahlreiche unserer irdischen Grundstoffe, wie Eisen, Chrom, Nickel, Zink etc. vorhanden sind. Die Spectralanalyse sollte bei der jetzigen Sonnenfinsterniß auch die Lichtkrone und die Protuberanzen zum Gegenstände ihrer Untersuchung machen. Sie sollte namentlich [572] aus dem Spectrum der uns als Lichtkrone erscheinenden Sonnenatmosphäre entwickeln, ob wirklich alle jene irdischen Stoffe in ihren Dämpfen vorhanden sind, auf welche aus den sogenannten Frauenhofer’schen Linien des gewöhnlichen Sonnenspectrums bisher geschlossen wurde.
Es sind unzweifelhaft große Räthsel, mit deren Lösung sich die Beobachter der jetzigen Sonnenfinsterniß befaßt halben. Wenn man aber fragt, welchen unmittelbaren Nutzen die Welt daraus ziehen wird, so könnte man wohl antworten, daß allein schon die Verbesserung der Bahnelemente der Erde und des Mondes durch die größere Sicherheit, die sie den astronomischen Berechnungen gewährt, auch denjenigen also, welche unsere Schiffe auf gefahrvollen Meeren leiten, ein nicht genug zu schätzender Gewinn sei. Aber wer will überhaupt von unmittelbarem Nutzen wissenschaftlicher Forschungen sprechen! Wer will ermessen, was eine wissenschaftliche Entdeckung in ihrem Schooße birgt! Jedes gelöste Räthsel ist eine Erweiterung unseres Wissens und damit unserer Macht und unseres Wohlstandes. Die astronomische Expedition, die der norddeutsche Bund in die fernen Länder Arabiens und Indiens ausgesandt, ist in Wahrheit ein Eroberungszug, und die Männer, welche unter glühender Tropensonne die Sonnenfinsterniß des 18. August beobachten, sind ebenso Helden, wie die, welche den Kampf mit dem Eis der Polarsee im Dienste der Wissenschaft aufnahmen.
„Steinpfalz“ nennt, zur Unterscheidung von der geprieseneren
Rhein- und Weinpfalz, der Volkswitz das baierische Land
am Böhmerwald, das seit fünfhundert Jahren als „Oberpfalz“
in der deutschen
Geschichte steht. Dort, in einem der anmuthigen Thäler, durch welches das kleine Flüßchen Pfreimt, des Böhmerwalds frische Tochter, der fichtelgebirgischen Naab zufließt, drei Stunden von der Stadt Naabburg nordostwärts entfernt, liegt ein Pfarrdorf, über dessen etwa achtzig Häusern, sich eine Burg erhebt; beide heißen Trausnitz. Um aber diese Burg von dem Schlosse Trausnitz zu Landshut zu unterscheiden, wird sie insbesondere „Trausnitz im Thale“ genannt. Sie ist eine denkwürdige Stätte der deutschen Vergangenheit.
Kaiser Heinrich der Siebente, einer der edelsten Herrscher Deutschlands, hatte als das Haupt der Waiblinger den reichsfeindlichen Welfenbund der Habsburger mit dem Papste zu Avignon und mit Frankreich besiegt, und darum wurde er zu Buonconvento von einem Mönch im Abendmahle vergiftet. „Im Kelch des Lebens hast Du mir den Tod gereicht, aber fliehe, bevor die Meinen Dich ergreifen!“ So sprach der Sterbende zu dem Mörder und verschied am 24. August 1313. Die Kunde dieses Todes weckte den Kampfmuth der Welfen wieder auf. Des von Johann von Schwaben ermordeten Kaisers Albrecht Sohn, Friedrich der Schöne, trat, vom Papste unterstützt, zur Kaiserwahl hervor und hatte an seinem Bruder, dem Herzog Leopold von Oesterreich, einen heldenmütigen Heerführer; ihm gegenüber hoben die Waiblinger, mit den patriotischen Städten und reichstreuen Fürsten im Bunde, Ludwig von Baiern auf ihren Schild. Beide waren Jugendgenossen, früher einander in inniger Freundschaft zugethan. Mechtilde, Kaiser Rudolph’s von Habsburg Tochter, die Mutter Ludwig’s, war die Schwester Kaiser Albrecht des Ersten, des Vaters Friedrich’s des Schönen, mit dem er zu Wien am Hofe der Habsburger in seiner Jugend Theilnehmer des Unterrichtes und der Spiele war. Jetzt zogen Beide das Schwert gegen einander. Zwar trat ein Augenblick der Versöhnung ein; noch einmal schliefen beide Fürsten wie Bruder in einem Bett zu Salzburg, und Ludwig hatte sogar dem Freund seinen Beistand bei der Kaiserwahl verheißen. Da fiel am Wahltag auf ihn selbst die Stimme der mächtigen Luxemburgischen Partei, – vom Glanz der Krone geblendet vergaß er das dem Freunde gegebene Wort; er ließ sich feierlich in Aachen krönen, während Friedrich nur in Bonn gekrönt wurde, und der Bruderkrieg begann von Neuem.
Erst nach neun Jahren kam der Tag der Entscheidung. Am 28. September 1322 wurde Friedrich von Oesterreich in der Schlacht bei Mühldorf besiegt und von dem Nürnberger Ritter Rindsmaul gefangen. Viele Ritter stritten sich um diese Ehre, aber Friedrich selbst sagte: „Diesem Kuhmaul, das ich mit Hauen und Stechen nicht von mir bringen konnte, hab’ ich mich gelobt.“ Kaiser Ludwig übergab den Gefangenen dem Bitzthum von Lengfeld-Weiglin, der ihn in die Gewahrsam seines festen Schlosses Trausnitz im Thale brachte.
Als Friedrich das Schloß erblickte, in welchem er wohnen sollte, und dessen Namen hörte, seufzte er: „Es heißt billig Traus nit, weil ich sein nicht enttraut hätte, daß ich in solcher Maaß sollt’ hergeführt werden.“
In der That muß dieses Gefängniß selbst für jene harte Zeit ein sehr strenges gewesen sein, wenn es auch für den „hohen Gast“ einige Bequemlichkeiten mehr geboten haben sollte, als es, wohlerhalten, wie es ist, heute dem Augenschein zeigt. Der Thurm, der in seinem obersten Theil Friedrich’s Gewahrsam enthielt, steht frei, und ist nur durch die einfache Thormauer mit dem Schlosse verbunden. Zum Thurme führt ein einziger Eingang, welcher in der oberen Hälfte desselben ausgebrochen ist, so daß nur mittels einer Leiter der Eintritt zu ihm ermöglicht werden konnte. Von da führt eine steinerne Treppe, welche in der Ecke des Thurmes angebracht ist, zum Gefängnisse hinauf; diese erhält nur von der [573] Fensterluke rechts das spärlichste Licht, so daß man beim Aufsteigen die Augen in den Fingerspitzen tragen muß und ist so enge, daß die Schultern des Hinaufschreitenden links und rechts die Wände berühren. Hier oben, dicht unter dem Dache, saß nun Friedrich, nichts um sich hörend als das Rauschen der schwarzen Tannenwälder, nichts um sich sehend als das Kreisen der hungrigen Raben. Die schmale Steintreppe ist das einzige Bauwerk im Thurme; unter ihr und neben ihr ist Alles hohl und leer – da lebt nichts, als höchstens die Wanderratte und die Fledermaus.
Dritthalb Jahre lang saß in diesem unheimlichen Raume Friedrich, der Einsamkeit und seinem zehrenden Kummer überlassen. Er hieß nur noch „der Schöne“, er war es längst nicht mehr. Bart- und Haupthaare ließ er wachsen, und als einzigen Zeitvertreib schnitzte er Pfeile, die er nicht verschießen konnte. Selbst seine Gemahlin – die Königstochter Elisabeth von Aragonien – durfte nicht zu ihm und weinte sich darüber blind.
Friedrich’s Bruder Leopold setzte zwar den Kampf gegen den Kaiser mit allen Kräften fort, aber vergeblich war all’ sein Mühen, den Gefangenen zu befreien. Weder die Gewalt half, noch die List und äußerste Kühnheit. Es klingt wie eine Sage, daß einmal in der Nacht ein Jüngling, der Kleidung nach ein Student oder fahrender Schüler, die Mauern der Trausnitz von außen erstiegen haben soll. Es pochte draußen am Fensterlein und eine Stimme mahnte den gefangenen Friedrich herbeizukommen und mit ihm herunterzufahren.
„Wer bist Du?“ fragte voll Entsetzen Friedrich, denn ein Menschenkind schien ihm solches Werkes nicht fähig.
„Frag’ nicht, wer ich sei, willst Du anders entkommen und behend thun, was ich Dir heiße,“ war die Antwort.
Da überfiel den König banges Grausen wie die Wächter, welche ihn hüteten. Sie Alle schlugen ein Kreuz, als erblickten sie den bösen Geist, am Fensterlein hangend, und mit lautem Gebet und Geschrei vertrieben sie denselben. Darum lief im Volke lange die Rede, es habe ein Meister schwarzer Kunst Leopolden verheißen, seinen Bruder durch den Teufel entführen zu lassen.
Leopold hatte sich auch einmal zu dem Mittel der freundschaftlichen Annäherung gewendet und die Reichsinsignien an Ludwig ausgeliefert; allein die Unterhandlungen führten nicht zur Versöhnung, weil er weder die Ansprüche seines Bruders auf die deutsche Königskrone ganz fallen, noch die durch ihn besetzten Städte des Reiches in Schwaben und Elsaß frei lassen wollte. Da er nun weder durch freundliches Unterhandeln, noch durch kriegerisches Pochen den Kaiser Ludwig bewegen konnte, den gefangenen Friedrich auf freien Fuß zu stellen, so versuchte er in seiner Erbitterung das Aeußerste, sich Anhänger zu werben und neue Fehde zu beginnen. Er schloß ein engeres Bündniß mit dem König Johann von Böhmen und rief den König von Frankreich zu Hülfe, um Deutschland mit Krieg zu überziehen und dessen Krone auf des Letzteren Haupt zu bringen. Umsonst war aber diese Verschwörung. Sie zerfiel durch Mißtrauen und Selbstsucht ihrer Glieder und scheiterte an des Baiern unerschrockener Tugend.
Was Leopold’s Trotz nicht zu erreichen vermochte, gelang der Frömmigkeit und dem Glauben an das menschliche Herz. Gottfried, der Prior der Karthause zu Maurbach, der Beichtiger des gefangenen Friedrich, reiste nach München zum Kaiser Ludwig und [574] redete zur Versöhnung. Da erwachte in Letzterem die alte Jugendliebe, und er ritt in des Winters letzten Tagen mit seinen Edeln zur Trausnitz. Hocherschrocken empfing ihn der Gefangene, aber Ludwig’s Milde stillte seine Sorge. Großmuth und Dankbarkeit schlossen den Bund. Friedrich ward ohne Lösegeld frei. Er aber entsagte der Reichskrone, Oesterreichs Fürsten sollten, was sie dem Reiche entrissen, zurückstellen und vereint mit ihm Ludwig’s Feinde zwingen, ihn als den einzigen König anzuerkennen. Das verhieß Herzog Friedrich und, zur Bekräftigung seiner Sühne, seiner Tochter Elisabeth Hand dem Sohne Ludwig’s, Stephan; dazu noch: könn’ er sein gegebenes Wort nicht lösen, woll’ er aus freien Stücken bis Johannis zur Sonnenwende selben Jahres in das Gefängniß von Trausnitz zurückgehen. Friedrich beschwor feierlich die am 6. März
1325 auf der Trausnitz ausgefertigte Urkunde der Versöhnung mit Ludwig. In der Kirche, wo der Prior von Maurbach das Hochamt beging, nahmen Beide aus seiner Hand am Altare den geweihten Leib des Herrn. Da, tief bewegt fielen sie sich um den Hals und küßten einander vor allem Volke.
Hier stehen wir bei einem der schönsten Momente deutscher Geschichte. Die Märzensonne des Jahres 1325 beleuchtet hier ein seltenes Bild: einen siegreichen Kaiser und seinen gefangenen Vetter und Jugendgespielen vor dem Altare in herzlicher Umarmung. Wie ihre Strahlen die eisigen Blumen von den Fenstern des Kirchleins thauten, so hat die fromme Rede des Karthäusers die Kruste von Feindesherzen gelöst und das erzwungen, was Bündnisse, Gewalt und Schwert vergeblich versuchten.
Am 23. März 1325 kehrte Friedrich zu den Seinigen nach Wien zurück. Die Welt staunte. Niemand wollte dieser Sühne trauen. Viele nannten Ludwig feig und schwach, Viele ihn unklug und Viele ihn hinterlistig. Andere suchten Friedrich zur Rache an Ludwig zu bewegen, erklärten ihn auf’s Neue als König und versprachen ihm ihren Beistand. Der Papst sprach ihn sogar von seinem Eide los, „denn so weit war es damals gekommen,“ sagt ein deutscher Geschichtsschreiber, „daß ein Wälscher sich unterstehen durfte, ein Ehrenwort, das zwei deutsche Männer sich gegeben, für nichtig zu erklären!“ – Aber Friedrich von Oesterreich hielt treu und deutsch am redlich gegebenen Wort, sandte seine Tochter Elisabeth zur Verlobung nach München, that in offenen Briefen auf des Reiches Thron Verzicht und mahnte Leopold zum Frieden. Und da er seine Mühen eitel fand, kam er nach vier Monaten wieder zum Könige gen München, wie er gelobte, sein Gefangener zu sein.
Hinter solcher Hochherzigkeit stand Ludwig nicht zurück. Er erkannte, daß kein Edlerer neben ihm zu finden sei im ganzen Reiche, und theilte darum mit ihm freiwillig das Reich selbst. Beide schlossen einen Vertrag, wonach Beide als Kaiser nebeneinander herrschen sollten und der, nach Menzel, also lautet: Jeder sollte den Titel eines römischen Königs und Augusti führen, den Andern Bruder nennen und in der Vorsetzung des einen oder andern Namens bei Freiheits- oder Gnadenbriefen von Tag zu Tage wechseln. Keiner sollte für sich und ohne den Andern etwas Wichtiges vornehmen. Die großen Lehen sollten von Beiden zugleich verwilligt und die Lehensleistungen, sowie die Huldigungen, in gemeinsamem Namen angenommen werden. Beide wollten einander gänzlich und einträchtig wider ihre Feinde beistehen. Ginge Einer nach Italien, sollte indessen der Andere das deutsche Reich verwalten. Auch sollten zwei Siegel verfertigt und in jedes Beider Namen gegraben werden, so daß in Ludwig’s Siegel Friedrich’s Name und in Friedrich’s Siegel Ludwig’s Name voranstehen sollte. Die beiden Kaiser aßen und schliefen zusammen. Der Papst wußte sich vor Erstaunen nicht zu fassen und nannte diese Freundschaft incredibilem, mirabilem (unglaublich, wunderbar).
Beide, größer als ihr Zeitalter, das ihre Tugend nicht begriff, beklagten fortan nur die Härte eines Schicksals, welches von ihnen Trennung oder gemeinsamen Untergang zu heischen schien. Als Ludwig seinem Sohne, dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg, den die Heiden aus Litthauen hart bedrängten, deren wilde Schwärme weder wehrlose Greise noch Säuglinge noch Weiber schonten, Rettung sandte und selbst dahin wollte, nahm er, ehe er aus Baiern schied, Friedrich, den treuen Freund, und vertraute ihm Gemahlin, Kinder und des ganzen Herzogthums Pflege.
Weder Griechenlands noch Roms hohe Geschichten bewahren ein ähnliches Denkmal argloser Treue![1]
So war Trausnitz im Thal Zeuge der edelsten Tugenden zweier hochherziger Fürsten! In der Folge kam diese Burg in die Hände verschiedener Besitzer. Auf ihr haus’ten die berühmten Geschlechter der Wiltingen, Zenger und Spornneck und ruhen die Gebeine der Letzteren in der Pfarrkirche. Nach den Freiherren von Quentel waren die Freiherren von Hanakam, dann die Freiherren Karg von Bebenburg die letzten Besitzer, und von diesen erkaufte im Jahre 1833 König Ludwig der Erste von Baiern die Burg, um sie der Nachwelt als ehrwürdiges Denkmal zu erhalten.
Neben diesem bewahrt unsere Literatur ein noch unvergänglicheres Denkmal zu Ehren der „deutschen Treue“ in dem Gedichte, das Friedrich Schiller ihr widmete und das, in wie viel hunderttausend Händen es jetzt auch sei, doch hier, als Schluß dieses Geschichtsbildes, an seine richtigste Stelle gesetzt wird:
Um den Scepter Germaniens stritt mit Ludwig dem Baier
Friedrich aus Habsburgs Stamm, Beide gerufen zum Thron;
Aber den Austrier führt, den Jüngling, das neidische Kriegsglück
In die Fesseln des Feinds, der ihn im Kampfe bezwingt.
Mit dem Throne kauft er sich los, sein Wort muß er geben,
Für den Sieger das Schwert gegen die Freunde zu ziehn;
Aber was er in Banden gelobt, kann er frei nicht erfüllen;
Siehe, da stellt’ er auf’s Neu’ willig den Banden sich dar.
Tief gerührt umhalst ihn der Feind, sie wechseln von nun an,
Wie der Freund mit dem Freund, traulich die Becher des Mahls,
Arm in Arme schlummern auf einem Lager die Fürsten,
Da noch blutiger Haß grimmig die Vetter zerfleischt.
Gegen Friederich’s Heer muß Ludwig ziehen. Zum Wächter
Baierns läßt er den Feind, den er bestreitet, zurück.
„Wahrlich! So ist’s! Es ist wirklich so! Man hat mir’s geschrieben,“
Rief der Pontifex aus, als er die Kunde vernahm.
[575]
Blätter und Blüthen.
Die rothe Brieftasche. Zur Zeit, als ich noch Criminaldirector in Z. war, lebte dort ein Steuerrath Becker, der die großherzogliche Steuercasse allein zu verwalten hatte. Der Steuerrath, ein ruhiger, solider und fast penibler Mann, erfreute sich bei seinen Vorgesetzten und allen Einwohnern der Stadt eines hohen Ansehens, bei uns aber, die wir ihm näher standen, auch großer Liebe. Eine Reihe von Jahren trafen wir uns täglich gegen Abend in der einzigen Restauration des Ortes.
In den letzten Jahren wurden aber die Besuche des Steuerrathes seltener, und wenn er kam, so war er zerstreut, schreckte oft wie aus tiefem Nachsinnen empor und eilte baldmöglichst nach Hause. Nie gab er uns eine Erklärung dieses veränderten Wesens, und wir suchten den Grund in dem Umstande, daß sein ältester Sohn, der Buchhalter in einem kaufmännischen Geschäfte gewesen, plötzlich entlassen und nach Amerika ausgewandert war. So sagte man wenigstens in der Stadt. Mitunter aber überkam mich, ich wußte selbst nicht wie, ein anderer Gedanke. War auch die Casse des Steuerrathes in Ordnung? Der Steuerrath alterte; die Casse war sehr groß, enthielt oft ungemein hohe Summen; wie leicht konnte ein Versehen begangen sein! Noch mehr, so sparsam, ja fast geizig der Steuerrath war, so groß waren doch bei seiner zahlreichen Familie seine Ausgaben und der Gehalt verhältnißmäßig nur gering. Und dazu noch der mißrathene Sohn! Allein die Revisionen, ordentliche und außerordentliche, hatten nie einen Defect ergeben, die Casse stimmte stets bei Heller und Pfennig.
Es war im Spätsommer 1850. Ich saß in der Dämmerung in der Restauration, als der Hausdiener des gegenüber liegenden Gasthofes mich herausrief und mir mittheilte, daß im Hotel zwei Herren abgestiegen seien, die mich dringend zu sprechen wünschten und Ort und Zeit der Zusammenkunft erbitten ließen. Da meine Wohnung außerhalb der Stadt ziemlich entfernt lag, begab ich mich selbst nach dem Gasthofe und traf im oberen Zimmer zwei Herren, die mir auf die verbindlichste Art und Weise entgegen traten. In der gewähltesten Toilette stellten sie sich mir als Ministerialräthe vor und überreichten ein Beglaubigungsschreiben des Ministers, nach welchem Beide mit einer gewichtigen geheimen Mission betraut waren, ich aber gleichzeitig angewiesen wurde, den Herren Commissarien auf Verlangen unbedingte criminal-polizeiliche Hülfe zu gewähren.
Dieser Auftrag war so seltsam und für mich, den alten Criminalbeamten, so neu, daß er mich im ersten Augenblicke überraschte. Was war in meinem Bezirke geschehen, welches Verbrechen war begangen, von dem ich keine Ahnung haben sollte? Ich prüfte das Beglaubigungsschreiben von allen Seiten, es trug die mir wohlbekannte Unterschrift des Ministers und das große Siegel des Staatsministeriums. Ich mußte gehorchen.
„Womit kann ich den Herren dienen?“ begann ich.
„Mit nichts weiter, mein Herr Director, als daß Sie uns gütigst sagen, wo wir Sie heute Abend bestimmt finden und Ihre Hülfe in Anspruch nehmen können.“
„Ich bleibe zu Hause.“
„Wir danken verbindlich und hoffen, Sie nicht belästigen zu müssen.“
Ich entfernte mich nach den gewöhnlichen Höflichkeitsbezeigungen und ging nach Hause. Ich war mehr als mißmuthig, da ich mich als Werkzeug zur Entdeckung eines Verbrechens übergangen glaubte.
Unterwegs traf ich den Gensd’armen Leopold. „Was giebt es Neues im Kreise, Leopold?“
„Nichts, gar nichts, Herr Criminaldirector! Reite nun schon drei Tage umher und habe nicht einmal einen lumpigen Landstreicher getroffen.“
Also auch Leopold, mein Factotum und ausgezeichnet durch seinen polizeilichen Scharfsinn, wußte nichts.
„Kommen Sie mit,“ befahl ich ihm, „und warten Sie bei mir.“ Es geschah. Zu Hause angekommen, ließ ich ihn in der Unterstube und ging hinauf in mein Arbeitszimmer. Ich ging unruhig auf und ab, wartend der Dinge, die da kommen sollten. Es schlug sieben, acht, endlich neun Uhr, aber Alles blieb ruhig. Schon glaubte ich, daß meine Thätigkeit nicht mehr in Anspruch genommen werden würde, als es plötzlich heftig an der Klingel riß. Ich zuckte zusammen und öffnete die Thür. Die Treppe her auf stürmte weinend und schreiend die dreizehnjährige Tochter des Steuerrath Becker.
„Um Gottes willen, Herr Criminaldirector, helfen Sie, retten Sie; sie wollen den Vater verhaften, zwei Männer, die heut’ Abend die Casse revidirt haben. Vater läßt Sie bitten, gleich zu kommen.“
Jetzt war mir Alles klar. Es waren außerordentliche Revisoren, ein Defect war verrathen und festgestellt.
Ich eilte zu der Wohnung des Steuerrathes. „Gut, daß Sie kommen, schon wollten wir zu Ihnen schicken. Verhaften Sie den Steuerrath Becker; in der Casse ist ein Deficit von siebentausend Gulden.“
„Verflucht, wer das sagt!“ schrie der Steuerrath mit hocherröthetem Gesicht, „verflucht der Schurke, der das sagt! Es fehlt eine Brieftasche mit siebentausend Gulden, aber Ihr habt sie mir gestohlen, während ich draußen war. Ihr Diebe, Ihr Schurken! – verhaften Sie die beiden Menschen, Herr Criminaldirector.“
„Thun Sie Ihre Pflicht, Herr Criminaldirector,“ rief der eine der Revisoren mit befehlender Stimme, indem er das entfaltete Beglaubigungsschreiben emporhob.
„Gemach, gemach, meine Herren,“ entgegnete ich, „von dem Augenblicke an, daß Sie den Steuerrath Becker der Unterschlagung und dieser Sie des Diebstahls beschuldigt, hat das Beglaubigungsschreiben keine Wirkung mehr, ich habe vielmehr kraft des mir verliehenen Amtes jetzt selbständig zu handeln, zu untersuchen und zu entscheiden.“
„Bedenken Sie, was Sie thun; wir werden dem Herrn Minister Bericht abstatten müssen, wie wenig Sie –“
„Genug,“ unterbrach ich sie, „ich kenne meine Pflicht.“
Die Vernehmung begann und das Resultat war folgendes: Die beiden Revisoren waren gegen sieben Uhr Abends bei dem Steuerrathe eingetroffen, hatten sich als solche legitimirt und die Vorlegung der Bücher und die Oeffnung der Casse verlangt. Beides war geschehen. Sie hatten mit größter Gewandtheit die Bücher ausgerechnet und den Bestand der Casse somit festgestellt. Jetzt ging es an ein Zählen derselben. Die Geldrollen wurden gewogen, dann aufgebrochen und gezählt. Da war plötzlich das Dienstmädchen des Steuerrathes in das Cassenzimmer getreten.
„Herr Steuerrath, draußen ist ein Mensch, der Sie dringend zu sprechen verlangt.“
„Habe Revision und keinen Augenblick Zeit!“
Das Dienstmädchen hatte sich entfernt, und man hatte weiter gezählt.
Das Dienstmädchen war wieder eingetreten.
„Herr Steuerrath, der Mensch läßt sich nicht abweisen, er hat eine wichtige Nachricht zu bringen –“
„Habe Dir schon gesagt, ich bin nicht zu sprechen, der Mensch soll warten.“
„Von Ihrem Sohne aus Amerika!“
„Von meinem Sohne?“
„Haben Sie einen Sohn in Amerika, Herr Steuerrath?“
„Ja, mein Herr!“
„So sehen Sie doch zu, was der Mensch will!“
Der Steuerrath war auf den Flur getreten. Er behauptete, daß an der Treppe ein Mensch gestanden, der ihn zu sich gewinkt, dann aber plötzlich Kehrt gemacht und zur Hausthür herausgelaufen sei. Er sei sofort in das Cassenzimmer zurückgekehrt. Hier hatten ihn die Revisoren mit der Mittheilung empfangen, daß an der Casse siebentausend Gulden fehlten. Der Steuerrath hatte dies bestritten und behauptet, daß, als er das Zimmer verlassen, eine rothe Brieftasche mit siebentausend Gulden in der rechten Ecke der Casse gelegen habe und nun verschwunden sei. Es war zu den heftigsten Scenen gekommen; die Revisoren hatten von Verhaftung gesprochen, der Steuerrath hatte sie Diebe, Betrüger genannt und um Hülfe gerufen.
So lag die Sache. Alle Drei hatten gegen die ausdrückliche Bestimmung gefehlt, nach welcher während der Revision Niemand das Zimmer verlassen durfte, ohne daß die Casse wieder verschlossen und versiegelt worden wäre. „Der Steuerrath Becker hat die Frechheit, uns des Diebstahls zu beschuldigen. Nun wohl! Wenn wir die Brieftasche gestohlen haben, so müssen wir sie ja bei uns tragen; wir bitten dringend, Herr Criminaldirector, uns zu visitiren!“
Dieser Antrag war nicht abzulehnen. Die Visitation begann und zwar auf das Allergenaueste. Nirgends die Spur einer Brieftasche, das Unterfutter der Kleider nirgends defect, es war kein Zweifel, die Herren hatten die Brieftasche nicht. Der Steuerrath war auf einen Stuhl gesunken und hatte sein Antlitz mit den Händen bedeckt. Ein leises Stöhnen drang zu unserm Ohr.
„Ich erkläre Sie als verhaftet, Herr Steuerrath,“ begann ich, „und werde Sie, da die Nacht zu weit vorgeschritten, bis morgen früh in Ihrem Hause bewachen lassen.“
„Das geht nicht, Herr Criminaldirector, wir bitten, den Steuerrath zum Arreste abzuführen, da wir die Casse in Beschlag nehmen müssen.“
„Die Beschlagnahme der Casse ist meine Sache,“ entgegnen ich, „ich stehe Ihnen dafür, daß der Steuerrath Becker nicht entfliehen soll, und ersuche Sie, sich morgen früh sieben Uhr zur Aufnahme des Thatbestandes wieder einzufinden. Es ist jetzt Mitternacht vorüber.“
Den beiden Herren kam dies offenbar nicht gelegen; sie beriefen sich auf den Befehl des Ministers und verlangten wiederholt die Abführung des Steuerrathes. Mein Entschluß stand aber fest; ich verschloß die Casse, nahm die Schlüssel an mich und rief durch das nach dem Garten gehende Fenster den Gensd’arm Leopold. Er war mir gefolgt, und ich hatte ihm befohlen, im Garten zu warten, bis ich seiner bedürfen würde. Jetzt trug ich ihm kurz auf, im Garten zu bleiben und bis auf Weiteres Niemand aus dem Hause und Niemand hinein zu lassen. Einen herbeigerufenen Polizeisergeanten stellte ich vor das Zimmer des Steuerrathes, dann entfernte ich mich mit den beiden Cominissarien, die ich bis dahin begleitete, wo unsere Wege sich trennten. Ich eilte nach Hause und suchte mein Lager.
Aber der Schlaf floh mich und unruhig wälzte ich mich hin und her. War der Steuerrath schuldig? Konnte man eigentlich noch daran zweifeln?
Hatte er nicht eine starke Familie, einen ungerathenen Sohn? Und der Trübsinn der letzten Jahre! Aber war er nicht ein offener, biederer Charakter, langjährig bewährt im Staatsdienste, war er nicht sparsam über alle Maßen? Und die beiden Commissarien, sollten sie die Brieftasche gestohlen haben? Unmöglich! Wer war der Mann, der den Steuerrath herausgerufen? Offenbar ein Werkzeug in der Hand des Steuerrathes, dem Alles daran gelegen, das Cassenzimmer verlassen und nun die Commissarien des Diebstahls beschuldigen zu können. Kein Zweifel!
Es dämmerte schwach im Osten, da litt es mich nicht länger auf meinem Lager. Ich begab mich nach dem Hause des Steuerrathes und zwar durch den an das freie Feld stoßenden Garten, in welchem Leopold auf- und abpatrouillirte. Er wußte noch nichts, ich machte ihn mit dem Sachverhältniß bekannt.
„Mein Gott,“ sagte er, „als ich gestern Abend in den Garten trat, sah ich einen Menschen, der vom Felde her nach dem Garten schlich, aber umkehrte, als er mich gewahr wurde. Auch in der Nacht war es mir, als ob wieder Einer nach dem Hause zu schleichen versuchte. Leider klapperte mein Säbel, und er nahm Reißaus.“
Sonderbar! Stand dieser Mensch mit der That in Verbindung? Im Zimmer des Steuerrathes brannte noch Licht. Ich begab mich hinauf und trat in die Stube. Verzweifelnd die Hände ringend, bleich wie der Tod, trat er mir schluchzend entgegen.
[576] „Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, beim Blute des Erlösers, ich bin kein Verbrecher, ich habe den Großherzog nicht bestohlen. O mein Gott, mein Gott, meine Ehre, mein armes Weib, meine Kinder!“
„Herr Director, Herr Director,“ schallte plötzlich Leopold’s Stimme zu uns herauf, „hier liegt eine rothe Brieftasche im Grase!“
Wir standen Beide einen Augenblick versteinert.
„Das Geld ist drin, das Geld ist drin! Sieben Scheine zu tausend Gulden.“
Und im Osten stieg jetzt die Sonne empor. Der Steuerrath aber war auf die Kniee gesunken und erhob die Hände dem leuchtenden Gestirne entgegen, seine Augen glänzten in wahrer himmlischer Seligkeit und seine Lippen lispelten ein heißes Dankgebet.
„Mein Weib, meine Kinder!“
Und ich rief sie Alle herein, welche die Nacht hindurch in heißen Thränen sich gebadet, und sie stürzten zu den Füßen des Gatten und des Vaters, umklammerten seine Kniee und umschlangen seinen Nacken und jubelten laut, daß Gott der Herr sie errettet! In der Thür aber stand Gensd’arm Leopold, die aufgeschlagene Brieftasche mit dem Gelde in der Hand, und in dem Auge des alten Soldaten glänzte eine schwere Thräne und rollte langsam in großen Tropfen über seine Wange.
„Auf, nach dem Gasthofe!“
Ja, wo waren die beiden Herren Ministerialräthe? Das Nest war leer, die beiden Herren waren abgereist, hatten die Rechnung zu bezahlen vergessen, auch waren die silbernen Leuchter des Wirthes nach ihrem Geschmacke gewesen. Es war kein Zweifel mehr. Die beiden Gauner hatten die augenblickliche Abwesenheit des Steuerrathes aus dem Cassenzimmer benutzt und die Brieftasche aus dem Fenster in den Garten geworfen. Der Mann, der den Steuerrath herausgerufen, war der Dritte im Bunde und bestimmt gewesen, die Brieftasche im Garten zu suchen. Leopold’s Anwesenheit hatte ihn daran gehindert. Die Steckbriefe durchliefen die Zeitungen, aber die Gauner wurden niemals ergriffen.
Das kaiserliche Stillleben in Fontainebleau. Der Kaiser und die Kaiserin der Franzosen führen jetzt ein völlig stilles, zurückgezogenes Leben im Schlosse von Fontainebleau und haben keinen anderen Besuch, als den der Großfürstin Marie von Rußland. Es scheint, als ob die Herrschaften sich einmal von allen geselligen Anstrengungen und Aufregungen erholen wollten, denn sie veranstalten weder Bälle noch Concerte, empfangen blos sehr wenig Besuche und vertreiben sich die Zeit nach dem eigenen Belieben jedes Einzelnen.
Schon sehr früh am Morgen verläßt das kaiserliche Paar seine Zimmer und geht ohne weitere Begleitung stundenlang in den malerisch schönen englischen Anlagen des Privatparks spazieren, worauf man sich stets zum Frühstück in den sogenannten chinesischen Salons versammelt.
Der kaiserliche Prinz steht pünktlich ein halb sechs Uhr auf und trifft nach einem Morgenspaziergang mit seinem Gouverneur zum Frühstück mit seinen Eltern zusammen; später kommt ein Professor der Pariser Universität, der ihm Unterricht ertheilt, ein Theil der Zeit wird auch den Uebungen im Reiten, Fechten, Schießen oder Turnen unter der Anleitung verschiedener Lehrmeister gewidmet. In den Mußestunden lenkt der Prinz sein Velociped (einen kleinen Wagen mit Mechanismus zur Selbstfortwegung nach Art der Draisinen) in den schattigen Alleen des Parks umher, oder er rudert auf dem See in Gesellschaft seines Vetters und seiner Cousinen, der Kinder des Herzogs von Alba, die sich stets in der Nähe und unter den liebevollen Augen der Kaiserin befinden.
Das allgemeine Frühstück wird bald da, bald dort eingenommen, sehr häufig in dem Zimmer, welches Ludwig Philipp und seiner Familie als Lese- und Arbeitszimmer diente, oft auch in einem nach dem Blumengarten zu gelegenen Salon, sehr selten im eigentlichen Speisesaal. Die Kaiserin hegt eine besondere Vorliebe für die „chinesischen Salons“, und man verbringt deshalb die Zeit meistens unter den seltsamen, fremdartigen Erinnerungen aus dem Sommerpalast des Kaisers von China, den goldenen Pagoden, emaillirten Vasen, kupfernen Götterbildern, juwelenbesetzten Schwertern, kunstreich geflochtenen Matten, Porcellanfiguren etc., welche die französischen Soldaten als Beute aus China heimgebracht haben. Nur drei Gegenstände in diesen Zimmern zeigen entschieden, daß man sich in Frankreich befindet: das berühmte Portrait der Kaiserin im Kreise ihrer Hofdamen, von Winterhalter, ein schöner Erard’scher Flügel, und ein kleiner Leierkasten, wie ihn die Savoyardenknaben haben, der das Entzücken des Prinzen bildete, als er noch ein ganz kleiner Knabe war.
Zwei Mal in der Woche führt ein Extrazug die Minister zu Berathungen beim Kaiser, und jeden Abend sendet der Polizeipräfect von Paris einen doppelten Bericht über die Vorgänge und Stimmung des Tages an den Kaiser und die Kaiserin. Mittwochs begiebt sich der Kaiser jedoch regelmäßig nach Paris, um dem Ministerrath zu präsidiren und selbst einmal nach Allem zu schauen.
Spaziergänge und Fahrten durch die herrlichen Alleen des wundervollen Parks nehmen einen großen Theil des Tages in Anspruch, oder man ergeht sich in den Sälen und Zimmern des Schlosses selbst, dem merkwürdigsten und schönsten von ganz Frankreich, wo die Salamander Franz des Zweiten und die Chiffre Heinrich’s des Dritten mit den Halbmonden der schönen Diana von Poitiers verschlungen sind.
Aber Fontainebleau hat auch neuere wichtige Erinnerungen; da ist das Arbeitszimmer des großen Napoleon mit dem kleinen Tisch, auf welchem er die Abdankungsurkunde unterschrieb und an dem die Sporen seiner grimmig aufstampfenden Füße noch sichtbare Spuren hinterlassen haben. Das Zimmer der Kaiserin ist voll von Andenken an Marie Antoinette, z. B. die reichen Seidenvorhänge an den Fenstern, Thüren und dem Bett waren ein Geschenk der Stadt Lyon an die unglückliche Königin; sie wurden während der Revolution heruntergerissen und verkauft, aber Napoleon der Erste entdeckte sie und brachte sie an ihren früheren Platz zurück in das Zimmer der „sechs Marien“, wie es genannt wird.
Die Lehren der Volkswirthschaft haben in den letzten Jahren einen
schon vielfach segensreich sich fühlbar machenden Einfluß auf das Volk gewonnen,
und um diesen Sinn weiter zu wecken, zu befestigen und in eine
dem Wohle des Einzelnen wie der Gesammtheit förderliche Bahn zu leiten,
bedarf es nur einer organisirten mündlichen Belehrung, sowie der fortlaufenden
Hinweisung auf Schriften, welche die großen Naturgesetze der Volkswirthschaft
in anregender, überzeugender und gemeinverständlicher Weise darzustellen
suchen. Die Zahl derartiger Werke ist, bei der Schwierigkeit der
Aufgabe, freilich noch nicht groß. Um so mehr halten wir es für unsere
Pflicht, auf ein Unternehmen aufmerksam zu machen, das, unserer Ueberzeugung
nach, nur einer wachsenden Theilnahme des Publicums bedarf,
um sich zu einer wahrhaft bedeutsamen Wirksamkeit aufzuschwingen. Es ist
dies ein (bei Otto Wigand in Leipzig erscheinendes) „Jahrbuch für
Volkswirthschaft, herausgegeben von Dr. Wolfgang Eras,“
an dem sich viele hervorragende Publicisten der national-ökonomischen Wissenschaft
betheiligt haben und dessen erster bereits für das Jahr 1868 veröffentlichter
Jahrgang, ein Bändchen von mäßigem Umfange und zu wohlfeilem
Preise, eine Reihe von Aufsätzen enthält, welche durch Inhalt und
anregende Darstellung das Interesse jedes denkenden Menschen fesseln müssen.
Die Idee, nicht auf systematischem, lehrbuchartigem Wege, sondern durch
kurze und volksthümliche Behandlung einzelner wichtiger Fragen für die
Beseitigung von Vorurtheilen zu wirken, welche nur zu oft die Hauptquelle
der gesellschaftlichen Uebel sind, ist gewiß eine glückliche, wo der Ausführung
Kräfte wie der Herausgeber und Mitarbeiter, wie Prince-Smith, Dr. [[Julius
Faucher]], Dr. Karl Braun, Wislicenus, Hieronymi etc. zur Seite stehen, die
n. A. auch der sittlichen Seite volkswirthschaftlicher Bestrebungen die gebührende
Aufmerksamkeit zu widmen wissen. Dem genannten Bändchen
hat denn auch eine günstige Aufnahme nicht gefehlt, so daß die Unternehmer
die nöthige Ermunterung zur Herausgabe eines zweiten Jahrganges
gefunden haben, auf den wir hiermit im Voraus verwiesen haben wollen.
Aus Schwaben. Zu dem trefflichen Artikel in Nr. 34 „Deutschlands
Herrlichkeit in seinen Baudenkmalen. Nr. 3. Das Münster zu Ulm“ ist
berichtigend und ergänzend zu bemerken: Der Eßlinger Baumeister, derselbe,
welcher“ an der Eßlinger Frauenkirche, gleichfalls einem der schönsten
vollendeten Denkmale gothischer Baukunst, hauptsächlich mit gebaut hat, heißt
Böblinger, nicht Döblinger.
In dem Vierteljahrhundert seit Beginn der Wiederherstellung ist die Summe von gegen zweihundertundfünfzigtausend Thaler verbaut worden. Bei der heuer zum ersten Male versuchten Münsterbaulotterie ist nur zu bedauern, daß der Vertrieb der Loose in der preußischen Monarchie nicht gestattet wurde; Gründe für die an höchster Stelle ablehnende Antwort sind nicht bekannt geworden, doch war sie von einer Gabe von achttausend Thalern begleitet. Der Bezug von Loosen gerade von Ulm aus ließe sich übrigens durch Bestellung gegen Postnachnahme leicht ausführen. Bei zehn Loosen ist das elfte frei und deckt die Kosten des Versands. Mögen da und dort Einige zusammenstehen; die Ziehung ist am 15. October und die Gewinne an Geld und Kunstwerken namhaft, höchster Gewinn zwanzigtausend Gulden. Bestellungen gehen an Kaufmann Klemm in Ulm.
Inhalt: Die Brüder. Novelle von Adolf Wilbrandt. (Schluß.) – Skizzen aus dem Land- und Jägerleben. Wort und Bild von Ludwig Beckmann. 4. Auf Wildkatzen. Mit Abbildung. – Der Reformator der Erziehungslehre. (Schluß.) – Im Vorzimmer des Parlaments. – Die totale Sonnenfinsternis; am 18. August 1868. Von Otto Ule. – Eine Denkstätte „deutscher Treue“. Mit Abbildungen. – Blätter und Blüthen: Die rothe Brieftasche. – Das kaiserliche Stillleben in Fontainebleau. – Die Lehren der Volkswirtschaft. – Aus Schwaben.
Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:
Dieses über sämmtliche bisher erschienenen Jahrgänge der Gartenlaube und über alle die Tausende der einzelnen literarischen und artistischen Beiträge derselben Rechenschaft und Nachweis gebende Register aus der Feder des in dergleichen Arbeiten vielfach bewährten Adolf Büchting in Nordhausen verschafft dem Leser erst eine genaue Uebersicht über die Fülle des Gebotenen und setzt ihn in den Stand, ohne Mühe zu finden, worüber er sich gerade belehren und unterhalten will. Es ist in der That für alle Freunde und Abonnenten der Gartenlaube ein unentbehrliches Noth- und Hülfsbuch, mögen sie nun im Besitze sämmtlicher oder nur einiger Jahrgänge derselben sein, denn da ist kein Artikel oder keine Illustration der Zeitschrift, die in dem „Sachregister“ nicht nach Jahrgang, Seitenzahl und Inhalt verzeichnet stehen.
- ↑ Wenigstens in einer Anmerkung verdient ein Beispiel deutschen Worthaltens in den Ritterkreisen derselben Zeit Erwähnung. Als es in dem Kriege der beiden Kaiser 1313 bei Eßlingen mitten im Neckar zu einem Gefecht kam, gerieth der österreichische Ritter Heinrich Schweinkenrist in die Gefangenschaft des Baiern Stephan von Gumpenberg. Dieser ließ ihn auf Ehrenwort frei, um daheim das Lösegeld zu holen, und vertraute ihm sogar sein eigenes Pferd zur Heimreise an. Der Oesterreicher ritt davon und kam zu guter Zeit richtig mit Roß und Lösegeld auf des Gumpenbergers Burg bei dem Sieger an, der natürlich, brav wie sein Kaiser, das Geld zurückwies, aber einen Freund gewonnen hatte