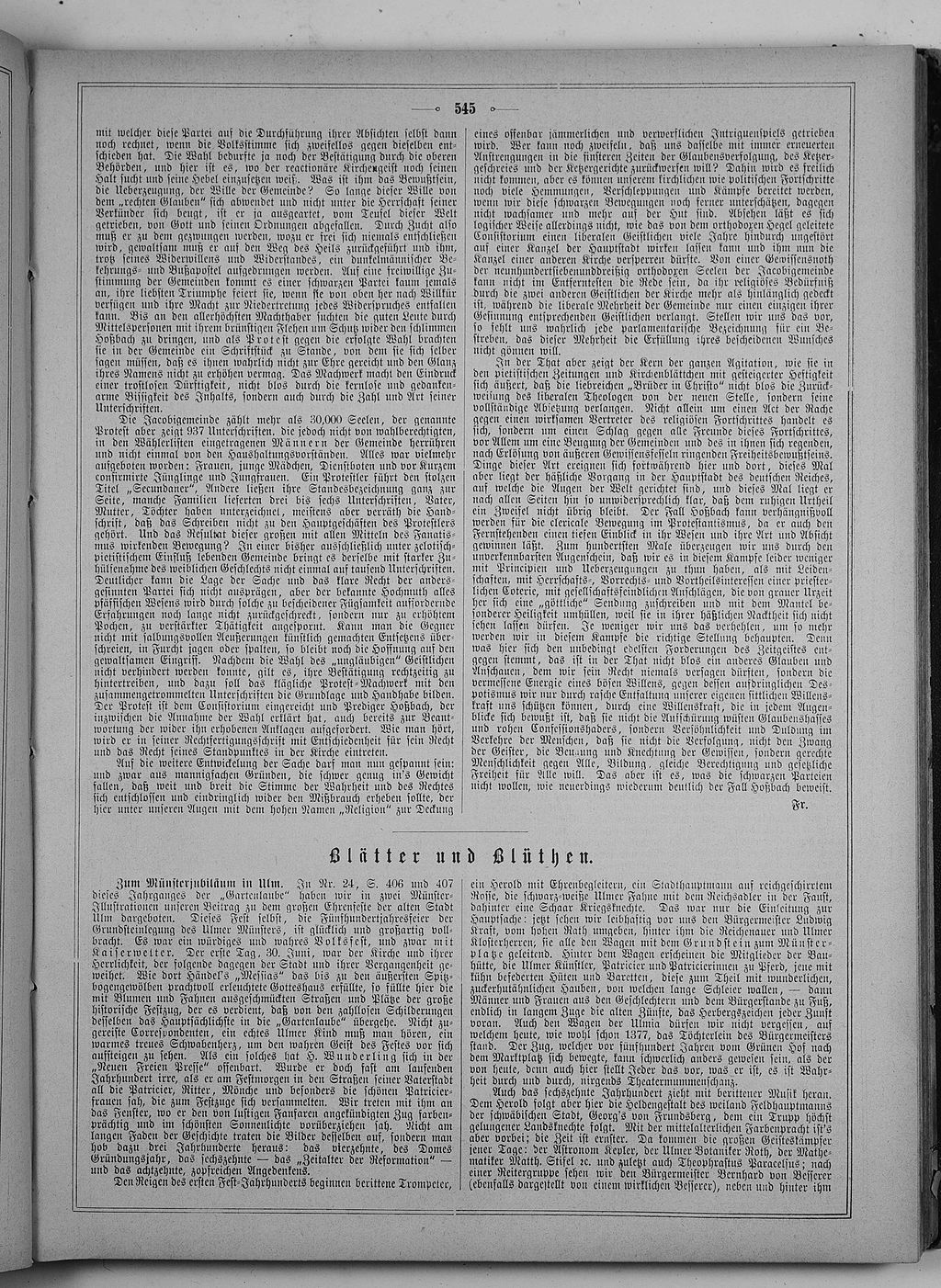| Verschiedene: Die Gartenlaube (1877) | |
|
|
mit welcher diese Partei auf die Durchführung ihrer Absichten selbst dann noch rechnet, wenn die Volksstimme sich zweifellos gegen dieselben entschieden hat. Die Wahl bedurfte ja noch der Bestätigung durch die oberen Behörden, und hier ist es, wo der reactionäre Kirchengeist noch seinen Halt sucht und seine Hebel einzusetzen weiß. Was ist ihm das Bewußtsein, die Ueberzeugung, der Wille der Gemeinde? So lange dieser Wille von dem „rechten Glauben“ sich abwendet und nicht unter die Herrschaft seiner Verkünder sich beugt, ist er ja ausgeartet, vom Teufel dieser Welt getrieben, von Gott und seinen Ordnungen abgefallen. Durch Zucht also muß er zu dem gezwungen werden, wozu er frei sich niemals entschließen wird, gewaltsam muß er auf den Weg des Heils zurückgeführt und ihm, trotz seines Widerwillens und Widerstandes, ein dunkelmännischer Bekehrungs- und Bußapostel aufgedrungen werden. Auf eine freiwillige Zustimmung der Gemeinden kommt es einer schwarzen Partei kaum jemals an, ihre liebsten Triumphe feiert sie, wenn sie von oben her nach Willkür verfügen und ihre Macht zur Niedertretung jedes Widerspruches entfalten kann. Bis an den allerhöchsten Machthaber suchten die guten Leute durch Mittelspersonen mit ihrem brünstigen Flehen um Schutz wider den schlimmen Hoßbach zu dringen, und als Protest gegen die erfolgte Wahl brachten sie in der Gemeinde ein Schriftstück zu Stande, von dem sie sich selber sagen müssen, daß es ihnen wahrlich nicht zur Ehre gereicht und den Glanz ihres Namens nicht zu erhöhen vermag. Das Machwert macht den Eindruck einer trostlosen Dürftigkeit, nicht blos durch die kernlose und gedankenarme Bissigkeit des Inhalts, sondern auch durch die Zahl und Art seiner Unterschriften.
Die Jacobigemeinde zählt mehr als 30,000 Seelen, der genannte Protest aber zeigt 937 Unterschriften, die jedoch nicht von wahlberechtigten, in den Wählerlisten eingetragenen Männern der Gemeinde herrühren und nicht einmal von den Haushaltungsvorständen. Alles war vielmehr aufgeboten worden: Frauen, junge Mädchen, Dienstboten und vor Kurzem confirmirte Jünglinge und Jungfrauen. Ein Protestler führt den stolzen Titel „Secundaner“, Andere ließen ihre Standesbezeichnung ganz zur Seite, manche Familien lieferten drei bis sechs Unterschriften, Vater, Mutter, Töchter haben unterzeichnet, meistens aber verräth die Handschrift, daß das Schreiben nicht zu den Hauptgeschäften des Protestlers gehört. Und das Resultat dieser großen mit allen Mitteln des Fanatismus wirkenden Bewegung? In einer bisher ausschließlich unter zelotisch-pietistischem Einfluß lebenden Gemeinde bringt es derselbe mit starker Zuhülfenahme des weiblichen Geschlechts nicht einmal auf tausend Unterschriften. Deutlicher kann die Lage der Sache und das klare Recht der andersgesinnten Partei sich nicht ausprägen, aber der bekannte Hochmuth alles pfäffischen Wesens wird durch solche zu bescheidener Fügsamkeit auffordernde Erfahrungen noch lange nicht zurückgeschreckt, sondern nur zu erhöhtem Pochen, zu verstärkter Thätigkeit angespornt. Kann man die Gegner nicht mit salbungsvollen Aeußerungen künstlich gemachten Entsetzens überschreien, in Furcht jagen oder spalten, so bleibt noch die Hoffnung auf den gewaltsamen Eingriff. Nachdem die Wahl des „ungläubigen“ Geistlichen nicht verhindert werden konnte, gilt es, ihre Bestätigung rechtzeitig zu hintertreiben, und dazu soll das klägliche Protest-Machwerk mit den zusammengetrommelten Unterschriften die Grundlage und Handhabe bilden. Der Protest ist dem Consistorium eingereicht und Prediger Hoßbach, der inzwischen die Annahme der Wahl erklärt hat, auch bereits zur Beantwortung der wider ihn erhobenen Anklagen aufgefordert. Wie man hört, wird er in seiner Rechtfertigungsschrift mit Entschiedenheit für sein Recht und das Recht seines Standpunktes in der Kirche eintreten.
Auf die weitere Entwickelung der Sache darf man nun gespannt sein: und zwar aus mannigfachen Gründen, die schwer genug in’s Gewicht fallen, daß weit und breit die Stimme der Wahrheit und des Rechtes sich entschlossen und eindringlich wider den Mißbrauch erheben sollte, der hier unter unseren Augen mit dem hohen Namen „Religion“ zur Deckung eines offenbar jämmerlichen und verwerflichen Intriguenspiels getrieben wird. Wer kann noch zweifeln, daß uns dasselbe mit immer erneuerten Anstregungen in die finsteren Zeiten der Glaubensverfolgung, des Ketzergeschreies und der Ketzergerichte zurückwerfen will? Dahin wird es freilich nicht kommen, aber es können unserem kirchlichen wie politischen Fortschritte noch viele Hemmungen, Verschleppungen und Kämpfe bereitet werden, wenn wir diese schwarzen Bewegungen noch ferner unterschätzen, dagegen nicht wachsamer und mehr auf der Hut sind. Absehen läßt es sich logischer Weise allerdings nicht, wie das von dem orthodoxen Hegel geleitete Consistorium einen liberalen Geistlichen viele Jahre hindurch ungestört auf einer Kanzel der Hauptstadt wirken lassen kann und ihm nun die Kanzel einer anderen Kirche versperren dürfte. Von einer Gewissensnoth der neunhundertsiebenunddreißig orthodoxen Seelen der Jacobigemeinde kann nicht im Entferntesten die Rede sein, da ihr religiöses Bedürfniß durch die zwei anderen Geistlichen der Kirche mehr als hinlänglich gedeckt ist, während die liberale Mehrheit der Gemeinde nur einen einzigen ihrer Gesinnung entsprechenden Geistlichen verlangt. Stellen wir uns das vor, so fehlt uns wahrlich jede parlamentarische Bezeichnung für ein Bestreben, das dieser Mehrheit die Erfüllung ihres bescheidenen Wunsches nicht gönnen will.
In der That aber zeigt der Kern der ganze Agitation, wie sie in den pietistischen Zeitungen und Kirchenblättchen mit gesteigerter Heftigkeit sich äußert, daß die liebreichen „Brüder in Christo“ nicht blos die Zurückweisung des liberalen Theologen von der neuen Stelle, sondern seine vollständige Absetzung verlangen. Nicht allein um einen Act der Rache gegen einen wirksamen Vertreter des religiösen Fortschrittes handelt es sich, sondern um einen Schlag gegen alle Freunde dieses Fortschrittes, vor Allem um eine Beugung der Gemeinden und des in ihnen sich regenden, nach Erlösung von äußeren Gewissensfesseln ringenden Freiheitsbewußtseins. Dinge dieser Art ereignen sich fortwährend hier und dort, dieses Mal aber liegt der häßliche Vorgang in der Hauptstadt des deutschen Reiches, auf welche die Augen der Welt gerichtet sind, und dieses Mal liegt er nach allen Seiten hin so unwidersprechlich klar, daß dem ruhigen Urtheil ein Zweifel nicht übrig bleibt. Der Fall Hoßbach kann verhängnißvoll werden für die clericale Bewegung im Protestantismus, da er auch den Fernstehenden einen tiefen Einblick in ihr Wesen und ihre Art und Absicht gewinnen läßt. Zum hundertsten Male überzeugen wir uns durch den unverkennbarsten Augenschein, daß wir es in diesem Kampfe leider weniger mit Principien und Ueberzeugungen zu thun haben, als mit Leidenschaften, mit Herrschafts-, Vorrechts- und Vortheilsinteressen einer priesterlichen Coterie, mit gesellschaftsfeindlichen Anschlägen, die von grauer Urzeit her sich eine „göttliche“ Sendung zuschreiben und mit dem Mantel besonderer Heiligkeit umhüllen, weil sie in ihrer häßlichen Nacktheit sich nicht sehen lassen dürfen. Je weniger wir uns das verhehlen, um so mehr werden wir in diesem Kampfe die richtige Stellung behaupten. Denn was hier sich den unbedingt edelsten Forderungen des Zeitgeistes entgegen stemmt, das ist in der That nicht blos ein anderes Glauben und Anschauen, dem wir sein Recht niemals versagen dürften, sondern die vermessene Energie eines bösen Willens, gegen dessen aufdringlichen Despotismus wir nur durch rasche Entfaltung unserer eigenen sittlichen Willenskraft uns schützen können, durch eine Willenskraft, die in jedem Augenblicke sich bewußt ist, daß sie nicht die Aufschürung wüsten Glaubenshasses und rohen Confessionshaders, sondern Versöhnlichkeit und Duldung im Verkehre der Menschen, daß sie nicht die Verfolgung, nicht den Zwang der Geister, die Beugung und Knechtung der Gewissen, sondern gerechte Menschlichkeit gegen Alle, Bildung, gleiche Berechtigung und gesetzliche Freiheit für Alle will. Das aber ist es, was die schwarzen Parteien nicht wollen, wie neuerdings wiederum deutlich der Fall Hoßbach beweist.
Zum Münsterjubiläum in Ulm. In Nr. 24, S. 406 und 407 dieses Jahrganges der „Gartenlaube“ haben wir in zwei Münster-Illustrationen unseren Beitrag zu dem großen Ehrenfeste der alten Stadt Ulm dargeboten. Dieses Fest selbst, die Fünfhundertjahresfeier der Grundsteinlegung des Ulmer Münsters, ist glücklich und großartig vollbracht. Es war ein würdiges und wahres Volksfest, und zwar mit Kaiserwetter. Der erste Tag, 30. Juni, war der Kirche und ihrer Herrlichkeit, der folgende dagegen der Stadt und ihrer Vergangenheit geweihet. Wie dort Händel's „Messias“ das bis zu den äußersten Spitzbogengewölben prachtvoll erleuchtete Gotteshaus erfüllte, so füllte hier die mit Blumen und Fahnen ausgeschmückten Straßen und Plätze der große historische Festzug, der es verdient, daß von den zahllosen Schilderungen desselben das Hauptsächlichste in die „Gartenlaube“ übergehe. Nicht zugereiste Correspondenten, ein echtes Ulmer Kind muß man hören, ein warmes treues Schwabenherz, um den wahren Geist des Festes vor sich aufsteigen zu sehen. Als ein solches hat H. Wunderling sich in der „Neuen Freien Presse“ offenbart. Wurde er doch fast am laufenden Jahrhundert irre, als er am Festmorgen in den Straßen seiner Vaterstadt all die Patricier, Ritter, Mönche und besonders die schönen Patricierfrauen sah, die zum Festzuge sich versammelten. Wir treten mit ihm an das Fenster, wo er den von lustigen Fanfaren angekündigten Zug farbenprächtig und im schönsten Sonnenlichte vorüberziehen sah. Nicht am langen Faden der Geschichte traten die Bilder desselben auf, sondern man hob dazu drei Jahrhunderte heraus: das vierzehnte, des Domes Gründungsjahr, das sechszehnte – das „Zeitalter der Reformation“ – und das achtzehnte, zopfreichen Angedenkens.
Den Reigen des ersten Fest-Jahrhunderts beginnen berittene Trompeter, ein Herold mit Ehrenbegleitern, ein Stadthauptmann auf reichgeschirrtem Rosse, die schwarz-weiße Ulmer Fahne mit dem Reichsadler in der Faust, dahinter eine Schaar Kriegsknechte. Das war nur die Einleitung zur Hauptsache: jetzt sehen wir leibhaftig vor uns den Bürgermeister Ludwig Kraft, vom hohen Rath umgeben, hinter ihm die Reichenauer und Ulmer Klosterherren, sie alle den Wagen mit dem Grundstein zum Münsterplatze geleitend. Hinter dem Wagen erscheinen die Mitglieder der Bauhütte, die Ulmer Künstler, Patricier und Patricierinnen zu Pferd, jene mit kühn befederten Hüten und Baretten, diese zum Theil mit wunderlichen, zuckerhutähnlichen Hauben, von welchen lange Schleier wallen, – dann Männer und Frauen aus den Geschlechtern und dem Bürgerstande zu Fuß, endlich in langem Zuge die alten Zünfte, das Herbergszeichen jeder Zunft voran. Auch den Wagen der Ulmia dürfen wir nicht vergessen, auf welchem heute, wie wohl schon 1377, das Töchterlein des Bürgermeisters stand. Der Zug, welcher vor fünfhundert Jahren vom Grünen Hof nach dem Marktplatz sich bewegte, kann schwerlich anders gewesen sein, als der von heute, denn auch hier stellt Jeder das vor, was er ist, es ist Wahrheit durch und durch, nirgends Theatermummenschanz.
Auch das sechszehnte Jahrhundert zieht mit berittener Musik heran. Dem Herold folgt aber hier die Heldengestalt des weiland Feldhauptmanns der schwäbischen Stadt, Georg’s von Frundsberg, dem ein Trupp höchst gelungener Landsknechte folgt. Mit der mittelalterlichen Farbenpracht ist’s aber vorbei; die Zeit ist ernster. Da kommen die großen Geisteskämpfer jener Tage: der Astronom Kepler, der Ulmer Botaniker Roth, der Mathematiker Matth. Stifel etc. und zuletzt auch Theophrastus Paracelsus; nach einer Reitergruppe sehen wir den Bürgermeister Bernhard von Besserer (ebenfalls dargestellt von einem wirklichen Besserer), neben und hinter ihm
Verschiedene: Die Gartenlaube (1877). Leipzig: Ernst Keil, 1877, Seite 545. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1877)_545.jpg&oldid=- (Version vom 9.9.2019)