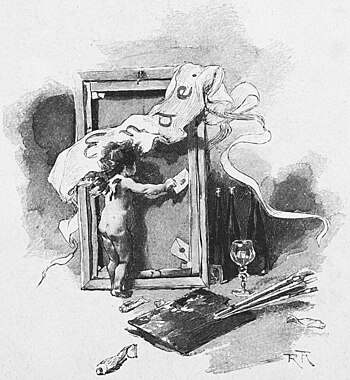Die Gartenlaube (1894)/Heft 52
[877]
| Nr. 52. | 1894. | |
Illustriertes Familienblatt. — Begründet von Ernst Keil 1853.
In der Stadt verlautete erst etwas von den Geschehnissen im Wollmeyerschen Hause, als der Arzt gerufen wurde, um festzustellen, daß der Herr Stadtrat, aus noch unermittelten Gründen, den Tod gesucht und gefunden habe.
Ich saß während der ganzen Zeit auf dem nämlichen Fleck im Lehnstuhl am Ofen, die Füße emporgezogen, ohne Speise und Trank. Die Komtesse, die bei mir war, hielt mich krampfhaft an den Händen. Fähig zum Sprechen war ich nicht, als die Herren vom Gericht mich um dieses und jenes befragten.
„Lassen Sie das arme Kind,“ bat die Komtesse. „Sie sehen, sie ist krank.“
Der Hof stand voll Menschen, eine Menge Leute kam und ging; eine beklemmende schwüle Luft war draußen und drinnen. Die Bekannten des Hauses eilten mit verstörten Gesichtern herbei und einige drangen bis zu mir herein.
„Aber um Gotteswillen, weshalb denn nur?“ fragten sie. „Was war denn der Grund?“ „Vermögensverluste!“ „Ach Gott bewahre, der Tod der Frau!“ „Ja freilich, er war so anders in letzter Zeit; der Sanitätsrat hat ihn durchaus auf Reisen schicken wollen, aber er ging ja nicht.“ „Armes Kind, nun so ganz verwaist!“ So ging das hin und her.
Das war in den Nachmittagsstunden; gegen Abend kam niemand mehr. Anfänglich leise, dann immer bestimmter, immer machtvoller drang die Kunde von dem wahren Sachverhalt unter die Menschen, die in diesem Mann ein Vorbild bürgerlicher Tugenden zu verehren gewohnt waren. Selbstmord, weil er der Absicht überführt worden war, aus dem verschlossenen Schubfach des alten Fräulein Himmel ein Dokument zu entwenden, das eine schwere Schuld seiner Vergangenheit bewies! Allerlei Einzelheiten, die heute noch im Munde der Westenberger sind, wenn man vom Stadtrat Wollmeyer spricht, wurden erfunden – aber so schwer, so schrecklich wie die Wirklichkeit war ja doch nichts.
Um zehn Uhr abends brachte man den Toten nach der Leichenhalle des Friedhofs.
Die Komtesse hatte uns verlassen, die Nacht senkte sich über all die Häuser und Hütten der kleinen Stadt, in denen heute die Leute ausnahmslos mit dem Gedanken an das traurige Ereignis einschliefen. Eine Nacht war es, die so recht paßte zu dem grausigen Geschehnis. Das Gewitter, das schon gestern gedroht, war mit Sturm und Regen herangezogen, die hohen Bäume des Gartens ächzten und bogen sich im Sturm, und Blitz auf Blitz flammte hernieder. Die Mädchen im Hause fürchteten sich; sie saßen mit blassen Gesichtern, bei brennender Lampe die ganze Nacht in der Küche beisammen, und wenn ein Laden knarrte oder der Regen prasselnd gegen die Fenster geschleudert wurde, schrieen sie auf, daß es bis in unsere Stube scholl.
Die Base, das Schlüsselbund im Gürtel, war allein in den oberen Flur hinaufgegangen, um dort ein schlecht schließendes Fenster zu verriegeln. Die Thüren der Gemächer droben trugen bereits das obrigkeitliche Siegel.
Einige Briefe, die nachmittags gekommen waren, lagen auf dem Tisch im Zimmer der Base, einer davon aus Amerika, mit Brankwitzens Handschrift.
„Jetzt gehen Sie schlafen, Anneliese,“ sagte die alte Frau, „ich bleibe hier bei Ihnen. Freilich, es wäre besser, Sie schliefen in dem netten Stübchen bei der Komtesse.“
„Sie hier allein lassen? Niemals, Base!“
So blieben wir beisammen in der schrecklichen Nacht, ohne zu sprechen. Keiner von uns kam der Schlummer. Gegen Morgen kochte die alte Frau Kaffee. Als es fünf Uhr schlug, löschte sie die Lampe, öffnete die Läden und stand dort wartend; endlich ging sie rasch aus dem Zimmer. Ich hörte, wie sie die Hausthür aufschloß und dann mit jemand sprach.
Ich richtete mich in meinem Stuhle empor – Robert Nordmann? Die Base
[878] mußte mit ihm in ihrer Stube sein; ich sah ihn nicht, ich hörte nur den Klang seiner Stimme. Viel war es nicht, was er sprach; sie redete mehr. Dann ward es wieder still, er mußte wieder fort sein.
Am Nachmittag kam die Komtesse; sie wollte mich mit Gewalt aus dem Hause nehmen. Ich wehrte mich, die alte Frau dürfe nicht allein bleiben. Kein Mensch außer mir wußte ja, was sie litt in dieser Zeit.
Und am zweiten Tag ward der Mann begraben, still in aller Morgenfrühe. Die Base stand an seinem Grab, sonst niemand.
Eine Frau nur war noch neben die Base getreten an den frischen Hügel, ein Kind an der Hand, einen Jungen von etlichen Jahren, der halb trotzig, halb furchtsam dem Sarge nachsah.
Die Base erzählte es mir, als sie zurückkam. „Nun kann der arme Schlucker betteln gehen,“ hatte diese Frau gesprochen; „wer sorgt in Zukunft für ihn? Umsonst kann ich ihn nicht behalten, die Knopfmarthe hat ihm nichts hinterlassen.“
„Ich werd’ schon sorgen, daß er nicht umkommt; behalten Sie ihn nur, bis der Nachlaß geordnet ist,“ hatte die Base getröstet.
Dann lebten wir zwei allein in dem großen Hause, dessen obere Räume noch immer versiegelt waren; erst nach Wochen konnte das gerichtliche Verfahren geschlossen werden. – –
Der Sommer kam, ein ungewöhnlich heißer Sommer, den ich mehr im Garten verlebte als im Hause, in dem alten melancholischen Garten, der für ein trauriges sehnsüchtiges Gemüt wie geschaffen war. Die Fenster des Hauses sahen so still verschlafen zu ihm hinunter, und die Rosen blühten in wunderbarer Pracht, ohne daß eine Hand sich nach ihnen ausgestreckt hätte. Die Base schlich zuweilen durch die schattigen Gänge und setzte sich neben mich, müßig, die Hände im Schoß.
Die Tage hatten Blei in den Schwingen. Dann kam einer, an dem die alte Frau mich leise fragte: „Ist es wirklich wahr, Anneliese, Sie wollen fort?“
Ich nickte mit abgewandtem Gesicht. „Ja, Base. Sehen Sie, ich werde krank, wenn ich noch länger hier bleibe; ich muß etwas zu thun haben, muß arbeiten, um alles zu vergessen, und – ich denke, ich bin lange genug der Gast von Robert Nordmann gewesen. Er ist doch der Erbe.“
„Aber bis zum Oktober bleiben Sie doch noch?“ Die Lippen der alten Frau zitterten. „Anneliese, bis zum Oktober!“
Der erste Oktober erschien. Ich lebte wie in einem verzauberten Schloß; nichts hörte ich von der Welt da draußen – die Base hatte sogar die Zeitungen abgeschafft. Die Komtesse kam eines Nachmittags, als ich im Garten spazieren ging – nach meiner Gewohnheit dreißigmal rund um den großen Platz in gleichmäßigem Schritt wie eine Schildwache. Sie marschierte neben mir her, bat nur um Verlangsamung des Tempos und fragte: „Na, nun bist Du ja bald erlöst, mein Kücken, die Stelle in England hat Dir die Gräfin Arvensleben verschafft. Ich bin sehr für dieses Engagement, denn, weißt Du, ein bißchen weit weg ist doch besser jetzt. Die ganze Provinz und die umliegenden Dörfer reden ja von nichts anderem als von dieser Geschichte, und eine Zeitung in die Hand zu nehmen, ist nachgerade schrecklich – Wollmeyer und Nordmann, und Nordmann und Wollmeyer!“
Ich blieb stehen und sah sie erschreckt an.
„Ja, meine Anneliese, wer hätt’s gedacht! Jetzt versteh’ ich erst, warum der Mann zur Pistole griff – es blieb ihm ja nichts anderes übrig. Das sind heitere Sachen, die da zu Tage kamen!
Nordmann hat sich übrigens sehr taktvoll benommen und höchst anständig, denn – hör’ zu – er hat auf das ganze Vermögen Wollmeyers verzichtet, ausgenommen die Besitzung in Thüringen, die Eigentum seiner Mutter war. Ja, aber weißt Du denn das gar nicht?“ fuhr sie mich an, „ich trage Dir das da vor, und Du starrst mir ins Gesicht, als spräche ich irre – Dich geht’s doch am nächsten an und –“
„Ich wußte nicht, Tante, daß die Angelegenheit jetzt verhandelt wird; mich berührt sie übrigens kaum – was habe ich mit Wollmeyers Nachlaß zu thun?“
„Ja so! Aber so recht kannst Du nicht behaupten, daß es Dich nicht angeht. Na, es ist ein altes Sprichwort, Kind, dem Bettelmann fällt das Brot aus der Tasche! Was hat der armen Len’ ihr Opfer nun genützt, Du kriegst doch nicht einen Dreier! Aber ich wollt’ nur sagen: der Nordmann hat das ganze ergaunerte und erwucherte Vermögen seines Onkels der Stadt Westenberg geschenkt, teils zur Erbauung eines Waisenhauses – können wir nämlich famos gebrauchen, denn was hier herumkrebst an verlassenen Würmern, die in schlechter Pflege sind und nicht satt kriegen und geprügelt werden, ist nicht zu sagen – andernteils für die Armenkasse. Ja, und denke nur, er hätte es nicht beweisen können, daß sein Vater damals unschuldig verurteilt wurde, wenn nicht die Base ein paar Schnitzelchen Papier besessen hätte, die die ganze Geschichte klarmachten, einen nachgelassenen Brief von der ersten Frau, der beweist, daß der alte Nordmann kein Dieb war, und zweitens ein Schreiben, das der alte Brankwitz an seinen Bundesgenossen Wollmeyer richtete als Quittung über die empfangene recht bedeutende Kaufsumme für Langenwalde, die Wollmeyer ihm in guten Staatspapieren und barem Gelde gezahlt hatte – drei Tage nach geleistetem Manifestationseid! Und diese Briefe wollte der Biedermann – Gott verzeih’ ihm seine Sünden – natürlich damals stibitzen, damals, als Du um Hilfe geschrien hast und die ganze Angelegenheit zum Klappen brachtest. Herr Gott, Anneliese, in allen Zeitungen steht die Geschichte unter der Spitzmarke: Ehrenrettung eines Verstorbenen.“
„Ich habe nichts gelesen, Tante.“
„Kind, Du mußt Dich nicht grämen; der Wollmeyer hat mehr Menschen verblendet als Deine arme Mutter und mich.“
„Tante, mich nie!“ antwortete ich.
„Es ist wahr,“ gab sie zu, „Du konntest ihn von Anfang an nicht leiden. Wie gesagt, Kind, alles in allein genommen, ist es besser, Du verschwindest ein wenig von hier. Mit der Zeit verwischt sich die Geschichte – vorläufig ist sie doch hier Deiner Zukunft hinderlich, wenn Du auch nicht das Geringste dafür kannst.
Du hast ja auch hier nichts, was zu verlassen Dich schmerzen müßte, ich meine, was so mit dem Herzen verwachsen ist, daß das Losreißen einem unmöglich scheint. Die Base und ich sind zwei alte Weiber, was hast Du an uns? Und Du weißt ja auch, daß wir bei jedem Herzschlag an Dich denken werden und daß, so lange die alten Augen offen sind, Dir eine Zuflucht bei mir sicher ist, wenn draußen die Wellen allzu hoch gehen.“
„Du hast recht, Tante, ich besitze nichts als Euch beide, aber das ist schon sehr, sehr viel, und ich werde es mit Schmerzen hinter mir lassen.“
„Hm!“ sagte sie.
Sie hatte wohl erwartet, daß ich noch von etwas andern reden würde, das ich verlassen müsse. Ich konnte es nicht, ich glaubte ja, daß Robert mich längst vergessen habe, und wenn er mich auch nicht vergessen habe, daß dann ewig trennend die schreckliche Katastrophe zwischen uns liege wie ein Abgrund, den zu überbrücken auch die heißeste Neigung nicht hinreichen würde.
„Also dann – auf nach England, Kind!“
„Ja, Tante.“
„Deine Sachen, ich meine die Sachen Deiner Mama, kannst Du bei mir unterbringen, Anneliese.“
„Ja, Tante, ich danke Dir schön.“
„Ich werde Dich bis nach Hamburg bringen, Kücken, wollt’ schon immer ’mal hin.“
Ich nickte gerührt.
„Was ist eigentlich der Nordmann für ein Mensch?“ fragte sie dann. „Muß ein wunderlicher Heiliger sein; hundert an seiner Stelle hätten den Mammon eingesteckt. Na, zwar – wenn man selbst solchen Geldsack hat! Aber es ist doch nett von ihm; überhaupt hat er die ganze Sache höchst anständig behandelt. Er wolle weiter nichts, als das Andenken seines verstorbenen Vaters reinigen, soll er geäußert haben, schmerzlich berühre es ihn dabei, daß einem andern, der sich nicht mehr verteidigen könne, ein Makel aufgedrückt würde, aber er habe nicht anders handeln können, er sei es seinen verstorbenen Eltern und seiner einstigen Familie schuldig. Was ist Dir denn, Anneliese? Weinst Du? Du bist übrigens recht bleichsüchtig, Kind; von dem bißchen Gehen keuchst Du ordentlich. Spaziere nur langsam, ich muß heim, will Deine Angelegenheit zum Abschluß bringen.“
Sie küßte mich auf die Stirn. „Mut, Kind, es ist alles nur halb so schwer, wie es aussieht.“
Ich stand da neben dem Stamme der alten Linde und lehnte den Kopf daran. Todeseinsam, herbstmüde lag der Garten vor mir, die Abendnebel vom Weiher zogen herauf und hingen gleich leichten Schleiern in den Bäumen; feucht und welk lagen die Blätter am Boden. So still, so schläfrig war die Welt, als wollte sie [879] entschlummern, des Blühens und des Sommers müde. Wenn man auch so einschlafen könnte, um nach köstlicher Ruhe zu einem Frühling zu erwachen! Warum mußte man weiterleben, immer weiter, unter einem grauen Himmel, ohne Sonnenstrahl, ohne Wärme, verlassen, allein im fremden Lande unter fremden Menschen? – Es wäre so schön, so märchenhaft, wenn Robert noch einmal vor mir stände wie in der Todesnacht Mamas, um zu sagen: „Komm, Anneliese!“ Aber das that er nicht wieder, zu viel Schuld lag zwischen uns, schwere Schuld – fremde Schuld.
Eine schüchterne Stimme in mir wollte widersprechen: aber er liebt Dich ja doch, er wird kommen; Geduld, Anneliese, Geduld! Allein Geduld war nie meine Stärke; wie kann man geduldig sein, wenn man liebt und meint, der, den man liebt, teile unsere Sehnsucht nicht. Nein, er liebte mich nicht! Erbarmen war es gewesen, Mitleid mit dem armen gequälten Ding! Nun wußte er die Qual beendet, die Freiheit war angebrochen – flieg’ hinaus, Du gefangener Vogel, such’ Dir ein schützendes Dach unter fremden Menschen!
Kurz und gut, sagte ich und wischte nur die feuchten Augen, wenn er hätte kommen wollen, wär’ er längst da, und deshalb vorwärts wie eine tapfere Soldatentochter! Sei Deines Vaters rechtes Kind, der so oft sagte: „Es wird mit nichts auf der Welt mehr Verschwendung getrieben als mit der Zeit, die man mit Gedanken über Unabänderliches, Geschehenes vergeudet, indem man sich ausmalt: wie hätte es sein können, wie ist es nun!“ Freilich, es ist schwer, aber Mut, Anneliese! Heute, als allerschwersten Anfang, bezeichne einmal die Sachen, in deren Mitte Du aufgewachsen bist, die Möbel und Geräte des Vaterhauses, die Du nicht mitnehmen kannst in die Fremde und die die Tante Komtesse Dir aufbewahren will! Wo sie es nur unterzubringen gedenkt in ihrem kleinen Hause? Gott mag es wissen. – Also vorwärts!
Mit einem Ruck, über den ich selbst lächeln mußte, löste ich mich von dem Baumstamm und schritt im Nebel durch den Garten dem Hause zu. In meinem Stübchen war es schon ganz finster, aber das Feuer im Kachelofen glühte und warf seinen roten Schein auf die Dielen. Es war so anheimelnd nach dem Nebel draußen. Ach, wer weiß, wo man so ein liebes trautes Plätzchen wiederfindet, um seine Gedanken auszuspinnen in heimlicher Einsamkeit? Wer weiß, ob je wieder Augenblicke für mich kommen werden, die mir, mir ganz allein gehören, und wäre es auch nur, um sie zu verbringen in Sehnsucht, in heißer aufflammender Sehnsucht nach einem freundlichen Wort, nach einer Liebkosung von der alten runzligen Hand der Base? Ich hatte sie doch lieb, diese meine Heimat, trotz allem und allem, von der Zeit her lieb, in der mir das alte Haus noch wie mein eigenes Besitztum erschien, wo Papa und Mama fröhlich waren und ich in der Dämmerstunde zwischen ihnen auf dem Sofa saß, den kleinen Hund auf dem Schoß, und hinter mir die Hände der beiden sich gefaßt hielten in stiller Zufriedenheit. Dann kam all das Schwere, aber der Glanz von damals war doch so mächtig, daß er hinwegleuchtete über das Elend und es mir in diesem Augenblick unmöglich erscheinen ließ, diese Heimat für immer zu verlassen. Herr Gott ja, der Abschied, wäre der nur erst vorüber!
Ich blieb sitzen und starrte mit brennenden Augen in die Glut. Ach, ein Feuer gab’s wohl überall, um sich zu wärmen, und Menschenglück blühte noch viel auf der Erde, aber es war nicht mein! Doch wer hinauszieht unter fremde Menschen, der soll sein persönliches Empfinden und Wünschen mit den andern unnötigen Dingen über Bord werfen als unnützes Reisegepäck. Ich wollte, die Komtesse gäbe den Plan auf, mich nach Hamburg zu begleiten. Wozu die Qual des Abschieds verlängern? O, ich hatte Deutschland so lieb! Ist denn Deutschland nicht groß genug, um sich irgendwo zu verstecken, mußte denn gleich das Meer zwischen mich und meine unglückliche Vergangenheit geschoben werden?
Im Nebenzimmer klapperte die Base mit dem Kaffeegeschirr. Unglaublich, wie früh es dunkel wurde bei dem Nebel! Und in England würde der Nebel noch viel schlimmer sein – ach, und ich liebte die Sonne so sehr! Den ganzen Tag Licht brennen und die Kinder, die vielleicht recht unartig waren, dabei im Zimmer haben – zwei Jungen und ein Mädchen – dazu diese Sehnsucht – vielleicht würde ich krank werden und sterben. Ob es wirklich Leute gab, die am Heimweh starben? Aber ehe man stirbt, wird man krank, und wie schrecklich ist Kranksein in der Fremde, in einem Hospital, wo eine Menge Betten an den Wänden steht und in jedem Bette ein stöhnender Mensch liegt, wo zu der eigenen Qual noch die der anderen kommt!
Ja, das konnte mir auch werden!
Die Glut im Ofen erlosch. Die Base rief mich nicht, es mußte jemand gekommen sein, mit dem sie sprach, vielleicht der Gärtner oder der Postbote oder – – Dann ging die Thür hinter meinem Rücken, ein Lichtschein streifte einen Augenblick den alten braun und weiß gesprenkelten Kachelofen, dann schloß sich die Thüre wieder; die Base hatte wohl herein geschaut, ob ich da sei, und hatte mich nicht gesehen.
Nun war es wieder dunkel und still. Oder war doch jemand eingetreten? Eine thörichte Furcht überfiel mich, als stände ein menschliches Wesen hinter mir und betrachtete mich.
Auf einmal sagte eine Stimme: „Anneliese!“ – leise, zitternd, eine Stimme, ach, eine Stimme – träumte ich denn? Regungslos blieb ich sitzen.
„Anneliese, hast Du nicht auf mich gewartet?“
Ich wollte mich aufrichten, aber ich vermochte es nicht, so bebte ich. Da bückte er sich und hob mich empor.
„Hast Du nicht gewartet, hast Du nicht gedacht, daß ich heute komme, heute, wo meine Militärzeit zu Ende ist? Schickst Du mich wieder fort? Nein, Du kannst nicht, Du darfst nicht, Anneliese, denn, siehst Du, nun ist mein Vater wieder ein Ehrenmann, wie der Deinige es war, und Du brauchst Dich nicht zu schämen, Anneliese Nordmann zu heißen. Anneliese, sprich doch ein Wort!“
Aber ich konnte dies Wort nicht sprechen, so gerne ich’s wollte – ich weinte.
Da führte er mich zu dem alten Großvaterstuhl am Ofen und ich setzte mich hinein und er kniete vor mich hin. „Mein kleines Mädchen, hör’ auf zu weinen, Thränen sind gar nicht mehr für Dich, dazu sollst Du nie, nie wieder Grund haben. Denk’ nicht mehr an die Vergangenheit, an die schrecklichen letzten Jahre, an alles, was sie Dir nahmen; denke daran, daß diese Zeit uns einander gegeben. Weißt Du noch – die Neujahrsnacht im Schlitten? Du meintest, es sei ein Abschiedskuß? Ich auch – aber nur einen Augenblick, dann wußte ich, es war der Anfang eines wundervollen Glücks. Und da oben in der alten Mühle, hörst Du, da wollen wir Hochzeit feiern. Nicht jetzt, nein, nein, aber Du sollst gleich dort wohnen, ich will Dich dort wissen, wenn ich an Dich denke. Du gehst mit der Base hin, sobald als möglich. Uebers Jahr, Weihnachten übers Jahr, dann komme ich, dann führt uns der Schlitten in das kleine Kirchlein, Anneliese, und nachher gehen wir an das Grab der Mutter, und ehe wir hinausreisen in die weite Welt, legt uns die Base ihre Hände auf das Haupt, die alten treuen Hände, die uns die teure Heimat schützen sollen, bis ich Dir meine neue im fernen Weltteil gezeigt, Anneliese.“
Es braucht niemand zu erfahren, was ich antwortete. Wir haben uns spät am Abend getrennt mit einem „Auf Wiedersehen!“ und die Base hat glückselig dabei gestanden mit ihren alten trüben Augen, denen zu lieb sie die Thränen herzhaft unterdrückte, „denn, Robert, das Salzwasser brennt so und die Augen sind krank und ich möchte sie so gern noch ein wenig schonen, um endlich einmal zu schauen, wie das Glück aussieht.“
Meine Zuflucht war an diesem Abend wieder der alte Großvaterstuhl neben dem Kachelofen. Die Base schlief fest und beruhigt nebenan, ich aber – wie hätt’ ich schlafen können, nach diesen Glücksstunden! Ich schmiegte mich mit dem köstlichen Gefühl des Geborgenseins in die ehrwürdigen Polster und sagte leise zu mir: „Uebers Jahr – Weihnachten übers Jahr!“
Am andern Morgen suchte ich die Komtesse auf. Sie saß in der blitzsauberen Küche und schälte Quitten zum Winterkompott. „Tante, ich gehe nicht nach England, schreib’ nur ab!“ rief ich ihr entgegen.
„Das ist unmöglich, bedaure!“ antwortete sie trocken und zog ein sehr beleidigtes Gesicht.
„Liebe Tante, es muß sein, bitte, bitte!“
„Nein. Ich habe mir die Finger fast lahm geschrieben – jetzt wird nichts mehr geändert. Du kannst Gott danken, daß Du eine solche Stelle bekommst – monatlich hundert Mark und nur drei Gören zu unterrichten! Du fängst geradeso an wie Deine Mutter – man muß wissen, was man will.“
„Aber, Tante, ich weiß genau, was ich will, ich will bei der alten Base bleiben, droben auf der Mühle.“
„I, Gott bewahre! Wie darfst Du der alten Person noch ihr Bissel Gnadenbrot wegessen!“
[880] „Wenn ich Dir aber sage, daß die Base beinahe mein Gnadenbrot ißt, Tante, beinahe –“
„Lieber Himmel, Du hast wohl etwas von Wollmeyer geerbt? Anneliese, Du wirst doch das nicht nehmen! Sonst –“ Und sie fuhr mit ihrem klebrigen Küchenmesser über die weißgescheuerte Platte des Tisches, „sonst zerschneide ich feierlich das Tafeltuch zwischen uns; dann bist Du das Mädel nicht, für das ich Dich bis jetzt hielt.“
„Ich habe nichts geerbt, ich habe mich nur verlobt, Tante; aber vorläufig darf es noch keiner wissen außer Dir.“
Sie ließ mich ausreden; ihr großes, sonst so bewegliches Gesicht sah mich starr an. „Unsinn!“ sagte sie, warf Messer und Quitten in die Schüssel und stellte diese so kräftig auf den Küchentisch, daß es mir heute noch unerklärlich ist, wie das irdene Ding es aushielt, ohne zu zerbrechen. „Komm’ mit herauf – – da ist natürlich wieder eine Dummheit passiert!“
Oben bestand ich nun ein Verhör, kreuz und quer durcheinander, ein Richter hätte es nicht besser machen können.
„Daß sich Gott erbarm’, so etwas!“ rief sie endlich. „Und davon hast Du mir nie eine Silbe erzählt? Na, komm’ her – ich gönn’ es Dir, und bei der Hochzeit bin ich selbstverständlich, und – er ist ein anständiger Mensch, sonst hätte er das Sündengeld eingesteckt, anstatt es den Armen zu geben.“
„Ich soll Dich grüßen von ihm, Tante, und ob Du für Deine Kleinkinderschule die unteren Zimmer im Schlosse hier gebrauchen könntest? Der obere Stock wird für die Waisen eingerichtet, und der erste, der da hineinkommt, ist der Knopfmarthe ihr Junge.“
„Himmel, da spare ich ja zweihundertfünfzig Mark Miete – natürlich! Ihr wollt nicht hier wohnen? Kann’s Euch nicht verdenken. Freilich nehm’ ich’s an, freilich.“
„Und, nicht wahr, Tante, noch bleibt’s Geheimnis? Sieh, er und ich wollen uns auch jetzt nicht sehen, ich will nicht ganz glücklich sein jetzt, ich traure noch um Mama.“
Sie nickte und preßte mich an sich. „Da hat doch Len’ ihr Opfer nicht ganz umsonst gebracht,“ sagte sie.
War das ein Winter, der nun folgte im Schnee der Berge, war das ein Sommer im Grün der Wälder, immer in Gedanken an ihn, immer im Bewußtsein eines Glückes, das mit jedem Tage näher heranzog! Kein Schritt in die grüne Tannenwildnis hinein ohne eine liebe Erinnerung, kein Blick auf die Wände der traulichen Zimmer ohne die Ahnung künftiger schöner Tage! Und wenn Robert auf Besuch kam, wenn Hübner den netten Korbwagen aus der Remise ziehen ließ und die dicken Pferde einspannte, um den „Herrn“ von der Bahn zu holen, wenn ich hinausspähte eine ganze Stunde zu früh – kommt er noch nicht? – und wenn er dann da war, wenn er die Stufen der Treppen mit zwei Sätzen nahm und die Thüre in weiteren zwei Sprüngen erreichte und wir uns dann in die Arme fielen – o, eine solche Seligkeit gab es nicht noch einmal in der Welt!
Wir bestimmten Veränderungen und Verschönerungen des liebsten Erdenplätzchens, das nun die Mühle und das Herrenhaus sein und bleiben sollte; wir machten eine Stiftung für Arme; wir ließen uns die Pläne zu einem Schulhause vorlegen – das alte war schier am Zerfallen – und ein halbes Jahr lang stickte ich an der Altardecke, die bei unserer Trauung zum erstenmal in der kleinen Kirche prangen und immer nur bei Hochzeiten aufgelegt werden sollte.
Die Base holte all ihre köstliche Leinwand hervor und ließ sie zerschneiden, und dann war das Weihnachtsfest da, welches das allerschönste für mich werden sollte.
Robert kehrte erst drei Tage vorher aus Amerika zurück; er war im Juli hinübergegangen. Am heiligen Abend kam er zu mir, am zweiten Feiertag sollte die Hochzeit sein.
Wieder schneite es und wieder lag heilige Stille über den schweigenden Wäldern und Bergen. Wieder kamen die Dorfleute mit Tannenbäumchen aus dem Forst und wieder roch es nach Hübners Festkuchen. Wie damals schleppten die Postboten sich fast tot an Paketen und wie damals ging ich die Landstraße entlang; aber diesmal nicht traurig und verlassen – diesmal, ja diesmal – –
Wären heute Arm in Arm meine Eltern hinter mir geschritten, es hätte doch einmal auf der alten Erde ein vollkommenes Glück gegeben! Aber freilich, die bange Vergangenheit lag wie ein wehmütiger Schleier über all dem Zauber der Gegenwart.
Und da war es wieder, das kleine Mäuerchen, auf dem ich vor zwei Jahren gesessen; und wie damals schob ich den Schnee hinunter und setzte mich wartend darauf; wie damals ließ ich die Blicke schweifen über die stille weihnachtliche Waldeinsamkeit. Aber in mir war nichts als Dank und Erwartung und ein weiches süßes Glücksgefühl, das sich zu pochendem Herzklopfen steigerte, als der Dreiklang der Schlittenglocken durch die stille Luft scholl.
Ich blieb ganz ruhig sitzen, als das Gefährt um die Ecke bog. Zuerst kamen die Pferdeköpfe in Sicht, an deren Geschirr rote Seidenschleifen neben den grünen Tannenzweiglein nickten, dann Herr Hübner selbst, im höchsten Staat, mit einem funkelnagelneuen Pelz, und an der Peitsche prangte ebenfalls ein purpurrotes Seidenband. Ich legte die Finger auf den Mund, und er lächelte, er verstand mich; langsam fuhr er heran.
Der Mann aber im Schlitten, der sah und hörte nicht. Er blickte unbeweglich vor sich hin; ein froher Ausdruck lag auf seinem Gesicht, dem lieben ernsten Gesicht. Ich sah zu ihm hinüber; hatte mein Blick denn nicht die Macht, ihn zu wecken aus seinem Hinbrüten? Doch! Er schaute herüber – mit einem Sprunge war er aus dem Schlitten und hielt mich umfaßt.
„O Du, Du mußtest ja hier sein, hier, an dieser Stelle!“
Der Schlitten fuhr weiter und bog um die Bergwand, wir waren allein mit unserem großen seligen Glück. Ich glaube, wir saßen zusammen auf der Mauer und spürten nichts von Kälte und Schnee.
Zwei Tage später war unsere Hochzeit; wie Robert einst gesagt, so kam es; an der nämlichen Stelle, wo seine Eltern getraut wurden, standen auch wir; hinter uns nur vier Personen: ein Paar merkwürdige Brautjungfern – die Base und die Komtesse, und dann Herr Hübner und seine prächtige Frau. Als ich zurückschritt an Roberts Seite,-da sah ich nichts als Menschen, lauter freundliche gerührte Gesichter, und die Jungen hielten uns seidene Bänder vor und die kleinen Mädchen streuten Tannenzweige und vom Chor sangen die Schulkinder: „Lobe den Herrn!“
Ach, nur eines fehlte noch: meine Mutter, meine arme Mutter!
Die Komtesse verstand meine Thränen; sie schloß mich in dem schmucken Speisesaal unseres Hauses in die Arme. „Kücken,“ sagte sie, „sie ruht, sie hat Frieden! Sieh, es giebt Menschen, die ruft der Herr zu sich, weil sie sich hier unten nicht zurecht finden – gönn’ es ihr!“
Und als die Dunkelheit herniedersank, hallten abermals Schlittenglocken durch den stillen Wald und zwei junge Menschen fuhren zusammen in die Welt hinaus. „Adieu, Frau Anneliese!“ hatte die Base noch gerufen, und die Komtesse hatte gemeint: „Sieht gerade aus wie eine Frau, das kleine schwarze Ding mit seinem Kindergesicht! Aber die Augen, freilich die Augen!“
Nach einem halben Jahre kehrten wir aus Amerika zurück, um für immer in Deutschland zu bleiben.
O du stille grüne Heimat, wie schön bist du jetzt mit deinem träumerischen Frieden!
Robert hat drüben sein Geschäft verkauft. Wir leben neun Monate des Jahres hier oben in den einsamen Bergen; um nicht ganz weltfremd zu werden, gehen wir dann alljährlich nach Weihnachten in eine größere Stadt. Aber wir zählen die Tage, bis wir wieder in unseren Bergen sind, wo jeder Stein uns kennt und uns die Leute so herzlich grüßen, wo die Mühle klappert, der Bach rauscht und der Wind durch die Baumwipfel braust. Wir haben beide unser Genügen an der Einsamkeit; vielleicht weil wir so Trübes erfahren haben von den Menschen, oder weil wir uns selbst genug sind, wir und unsere beiden Kinder, auf die die Base so schrecklich eingebildet ist und bei denen sie und die Komtesse Patenstelle vertraten. Wie dem auch sei, jedenfalls sind wir in unseren Bergen am glücklichsten. Robert ist ein musterhafter Gutsherr und ein Mühlenbesitzer – eine solche Mühle soll man lange suchen. Und ich, ich habe neben der Kindererziehung noch viel Zeit für alles Schöne, das mein Interesse erregt, und sehr stimmungsvoll klingt es, wenn ich Klavier spiele und die Mühle klappert den Takt zu Schuberts „Schöner Müllerin“. Dann sitzt Robert in der Fensternische und sieht zu mir herüber, und ihm gegenüber unser Schutzengel, die alte, treue Base, den größten Jungen zwischen den Knien. Träumerisch nickt sie dann wohl vor sich hin – ihre alten Augen haben noch geschaut, wie das Glück aussieht!
Alle Rechte vorbehalten.
Die Vorläufer unserer Neujahrskarten.
In der diesjährigen Weihnachtsnummer der „Gartenlaube“ hat Alexander Tille erzählt, wie sich die Christbescherung zum Teil aus dem Brauch der Neujahrsgeschenke entwickelt hat, der, wie bei vielen anderen Völkern, von altersher bei den Römern bestanden hat. Er hat auch darauf hingewiesen, daß die Vereinigung von Glückwünschen für Weihnachten und Neujahr, die sich noch heute auf den englischen „Weihnachtskarten“ (christmas-cards) finden – „eine fröhliche Weihnacht und ein glücklich Neujahr!!“ – von jener Verschmelzung alten Neujahrsbrauchs mit neuer Weihnachtssitte herstammt.
Wenn wir auf die Geschichte unserer deutschen Neujahrskarten, soweit sie sich nachweisen läßt, zurückblicken, so finden wir, daß diese Vereinigung von Weihnachts- und Neujahrsfeier in der Form eines Glückwunsches in Deutschland nie bestanden hat, oder wenigstens nur insoweit, als eben der Anfang des neuen Jahres mit dem Weihnachtsfeste zusammengefallen ist, daß dafür aber auf den ältesten uns überlieferten gedruckten Neujahrswünschen das Christkind, als Patron des Jahresanfangs dargestellt worden ist.
Ein Schriftsteller aus dem Beginne des 16. Jahrhunderts schildert, wie es zu seiner Zeit in Deutschland am Neujahrsfeste gehalten wurde; doch wie damals wird es wohl auch schon Jahrhunderte früher hergegangen sein, denn in jenen Zeiten veränderten sich die Sitten nur langsam. „Zum 1. Januar,“ schreibt er, „zur Zeit, wo das Jahr und alle unsere Zeitrechnung beginnt, besucht der Verwandte den Verwandten, der Freund den Freund; sie reichen sich die Hände und wünschen sich glückliches Neujahr und feiern dann diesen Tag mit festlichen Glückwünschen und Trinkgelagen. Nach althergebrachter Gewohnheit macht man sich auch gegenseitig Geschenke.“ Anstatt der Weihnachtsgeschenke waren damals noch allgemein Neujahrsgeschenke üblich.
Als mit der allgemeinen Verbreitung der Kultur im 14. und 15. Jahrhundert sich auch die Kunst des Schreibens immer mehr ausbreitete, als man unter Verwandten und Freunden anfing, fleißig sich Briefe zu schreiben, gelangte zur Zeit des Jahreswechsels die Formel in Gebrauch: „Gott geb’ Dir und uns allen ein gut selig neu Jahr und nach diesem Leben das ewig Leben. Amen.“
Die Erfindung des Buchdruckes und des Kupferstiches in der Mitte des 15. Jahrhunderts, der rasche Aufschwung, den die graphischen Künste damals nahmen, brachte einen Ersatz für die mündlichen und geschriebenen Glückwünsche: die „gedruckten“. In welcher Ausdehnung die Herstellung der gedruckten Wünsche in der Wiegenzeit dieser Künste erfolgte, kann nicht mehr festgestellt werden, da der größte Teil derselben, wie es bei dem vergänglichen Material derselben begreiflich genug ist, zu Grunde gegangen ist. Der älteste noch erhaltene gedruckte Neujahrswunsch rührt von dem ersten deutschen Kupferstecher von Ruf, dem sogenannten Meister E. S. vom Jahre 1466, her, dessen Namen die Forscher noch nicht bestimmen konnten. Auf einer reich und üppig erblühten, trefflich stilisierten Blume, die das anbrechende Jahr versinnbildlichen soll, steht das Christuskind; es hält ein fliegendes Band mit dem Wunsche „Ein goot selig jor“. Welch großer Beliebtheit sich dieser sinnige Neujahrswunsch, dessen Abbildung hier ihn etwas verkleinert zeigt, erfreute, sagen uns die verschiedenen Kopien, die es von ihm giebt.
Derselbe Wunsch „ein gut selig Jahr“ findet sich auch auf dem Kopfe von Wandkalendern jener Zeit. Auf einem solchen, den Hans Zainer in Ulm für das Jahr 1483 druckte, steht auf der vorderen Randleiste das Christuskind, während in dem quer über den Kalender sich hinziehenden Spruchbande, das wir verkleinert abbilden, der Neujahrswunsch des Buchdruckers steht: „Jhesum und Maria sein mutter klar, wünschet euch Hanns Zainer zum guten Jar.“ Man kommt in Versuchung, diesen Kalender als eine Widmung, als ein Neujahrsgeschenk Hans Zainers an seine Kunden anzusehen, von der Art, wie sie der Buchdrucker der Neuzeit seinen Geschäftsfreunden in das Haus sendet.
Also schon vor mehr als vierhundert Jahren hat man sich durch Karten beglückwünscht und erhielt man zum neuen Jahr einen Kalender mit Glückwunsch, ganz wie heutzutage. Natürlich kamen durch die gedruckten Wünsche die mündlichen und geschriebenen nicht außer Brauch. In den Briefen, die um Neujahr geschrieben wurden, fehlt der Wunsch zu einem glückseligen gnadenreichen neuen Jahr niemals. Die Nürnberger Klosterfrau Brigitta Holzschuherin sandte dem Michel Behaim zum neuen Jahr 1496 folgenden überschwenglichen Glückwunsch: „Jesus Christus der neugeborn Künig mit allem Trost, Freud und Seligkeit, die er uns mit seiner Geburt gebracht hat, besunder mit seiner Kraft wirken den heilsamen Namen Jesu am achten Tag ausgesetzt in der Myrrhen Bitterkeit seines Blutvergießen, in dem Geschmack der Süßigkeit des Weihrauch und Gold seiner unergründten Lieb, wünsch u beger ich dir aus Grund meines Herzen, zu einem guten seligen gnadenreichen neuen Jahr.“ Solchen Wünschen lag dann wohl auch noch Konfekt oder ein Fazenetlein (Taschentuch) als Geschenk bei. Nicht alle Nonnen hatten ein solch demutsvolles, gottergebenes Gemüt. Anna Tucherin, die gegen ihren Willen Klosterfrau geworden war, schreibt zornigen Gemütes an ihre Muhme: „Gott geb ihm ein verdorben Jahr, der mich macht zu einer Nunnen.“
Dem besprochenen Urahn unserer heutigen Neujahrskarten können wir eine Reihe sich anschließender Karten, welche den Zusammenhang mit unseren modernen herstellen würden, nicht folgen lassen. Ebenso ist der Kalender des 16. Jahrhunderts ganz wesentlich verschieden von seinem Vorgänger. Es wiederholt sich hier die merkwürdige Erscheinung, daß gerade die Erstlinge irgend einer Kunstübung oder irgend eines neuen Gegenstandes oft auf einer merkwürdig hohen Stufe stehen, von der die Nachkömmlinge schnell und zwar sehr tief herabsinken, um sich manchmal erst in Jahrhunderten wieder zur Höhe der Erstlingsprodukte zu erheben.
Die gedruckten Neujahrswünsche des 16. Jahrhunderts haben zwar mit denen des vorhergehenden die Darstellung des Christuskindes, den tiefreligiösen Sinn gemein; aber man begnügte sich mit so einem Bildchen allein nicht mehr; man war redseliger geworden und hängte demselben noch einen langen Text an, so daß die Wünsche über das Kartenformat hinauswuchsen und zu Plakaten [883] wurden. Aus einem solchen vom Jahre 1564, das sich im Germanischen Museum in Nürnberg befindet, rührt das hier wesentlich verkleinerte Christkind mit der Erdkugel in der Hand her. Es führt den Titel: „Schöne Trostsprüche von dem Kindlein Jesu Christi, den lieben Christen Kindlen zum Neuen Jar zusammengezogen.“ Rings um das Bild sind religiöse Sprüche eingedruckt, deren Inhalt sich auf die Weihnachtsfeier, auf die Geburt und Sendung Christi bezieht und die Kinder zum christlichen glaubensfesten Lebensgange ermahnt. Der Neujahrswunsch war also zunächst für Kinder bestimmt und bildet demgemäß einen Beleg für die weitere Ausbildung der Neujahrswünsche.
Die Plakatform behielten diese gedruckten Wünsche auch noch im 17. Jahrhundert bei. Infolge dieses großen Formates heftete man dieselben meist an Zimmerthüren oder an die Wand, wie es auf dem Lande mit „Haussegen“ und ähnlichen Blättern heute noch geschieht. An der Wand sind sie dann auch allmählich zu Grunde gegangen, wodurch sich ihre heutige große Seltenheit erklärt. Ihren religiösen Charakter haben die Neujahrswünsche auch noch im 17. Jahrhundert beibehalten; sie danken Gott für das Gute, das er im abgelaufenen Jahre beschert hat, und bitten um ein gutes neues Jahr. Auch hiervon eine Probe:
„Ach, laß dir auch forthin der Zeit
In deinen Schutz und Gütigkeit
Mich und die Mein empfohlen sein,
Thu wohl dem Rat und der Gemein,
Die Kirch und Priesterschaft erhalt,
Im Haus auch mit Ehleuten walt,
Die Handlung, Handwerk, Vieheszucht,
Den Feldbau segne mit der Frucht
Und hab also bei allem Stand
Dein himmelbreite Gnadenhand.
Behüt für Sünden, Schand und Spott,
Für Wasser, Feur und andrer Not,
Daß wir das Jahr in stiller Ruh
Und dir zum Lobe bringen zu,
Und wann der Jahre Ziel vollendt
So hilf uns an der Himmel End.“
Das Christkindchen aber, das die Neujahrswünsche des 15. und 16. Jahrhunderts zierte, ist verschwunden; es hat dem Geschmacke der Zeit entsprechend einer Anzahl schwülstiger Sinnbilder weichen müssen.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts nahmen auch die regelmäßig erscheinenden Zeitungen ihren Anfang und auch diese nahmen die Sitte an, ihren Abonnenten zum Jahreswechsel Glückwünsche darzubringen. Einer der ältesten der Art findet sich im Jahrgang 1624 der Frankfurter „Postzeittungen“, die wahrscheinlich eine Fortsetzung der im Jahre 1617 vom Postmeister von der Birghden gegründeten Zeitung waren. Der Glückwunsch lautet also: „Demnach das 1624. Jahr hierbei nahet, Als wünsch ich dem gutherzigen Leser durch das Neugeboren Christkindlein unsern lieben Emanuel und Frieden-Fürsten ein frölich antrettend und vielfolgender glückselig fried- und freudenreicher Neuer Jahr, in welchem man Fried und Einigkeit im Heil. Röm. Reich und unter des Adlers Flügeln geruhig und friedlich wohnen und leben mögen, Amen, Amen, Amen.“
Die Neujahrsbriefe wurden in diesem Jahrhundert zahlreicher; man schrieb solche an alle möglichen Gönner, Freunde und einflußreiche Personen, an deren Wohlwollen dem Gratulanten gelegen war. Unterbeamte schrieben sie in „ersterbender Demut“ an ihre Vorgesetzten, die Angestellten der Handelshäuser an ihre Gcschäftsherren etc. Oft waren diese Begrüßungen eine Förmlichkeit, die von der andern Seite mit der Auszahlung vertragsmäßig feststehender „Gratifikationen“ erwidert wurde. Die Neujahrsbriefe, Welche die Beamten, Honoratioren etc. unter sich austauschten, strotzten vom schwülstigen Phrasentum übertriebener Höflichkeit, wobei das Prunken mit Fremdwörtern sich häßlich hervordrängte. Natürlich folgten auf diese Briefe ebenso steife und schwülstige Erwiderungen: „Ich kann nicht anders als mit einem Widerschall antworten,“ schreibt ein Rat in Stettin an einen hohen norddeutschen Geistlichen, „und wünsche mit solchem ardeur als je gewünscht werden kann, daß der Höchste Gott meinem hochgeehrten Herren Ober-Kirchenrath mit aller prosperité an Leib und Seele beglücken und denselben et Ecclesiar et Reipublicae causa noch lange, lange Zeit erhalten, stärken und erquicken wolle.“
Das 18. Jahrhundert brachte Europa eine merkwürdige Neuerung; aus China gelangte der Gebrauch der Visitenkarten zu uns herüber. Und diese Karten gaben dann – zunächst vornehmlich in England – den Anstoß zur Entstehung einer Reihe anderer, nachdem man gesehen hatte, daß diese Kärtchen, wenn auch etwas gar zu winzig im Format, doch recht praktischer Natur waren. Auch die Neujahrskarten im modernen Sinn, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bereits in Massen Verbreitung fanden, dürften aus den Visitenkarten hervorgegangen sein. Freilich sind die Neujahrskarten der Zeit der Aufklärung grundverschieden von ihren Vorgängern; das religiöse Moment, das die alten beherrschte, verschwindet vollständig. Die neuen Karten zeigen dagegen Obelisken, Pyramiden u. ä. als Symbole edler Empfindungen, und vor allem Opferaltäre, Altäre mit der Göttin der Freundschaft, dem rosenstreuenden Amor, mit den Grazien, den Musen u. dergl. Eine ganz andere Welt sieht uns aus diesen Kärtchen entgegen. Der Geschmack einer Zeit, in welcher die deutschen Dichter ihre Geliebten, wenn sie sie besangen, mit klassischen Namen, wie Chloë und Phyllis, anredeten, und die ihre Bildersprache dem Wortschatz der griechischen und römischen Mythologie entnahm, spiegelt sich in ihnen. In Goethes und Schillers Jugendzeit, [884] wo unter anderem Rousseaus Einfluß den Hang zur „Empfindsamkeit“ so stark zur Entwicklung brachte, gelangte auch dieses Element auf den Neujahrskarten zum Ausdruck. Die Spruchverse, die auf den Karten den Bildern beigefügt sind, triefen förmlich von überschwenglichen Versicherungen der Freundschaft, deren Erhaltung oft der Hauptwunsch des Gratulierenden ist. Und in Reaktion darauf treten dann zu diesen Karten auch solche von humoristischem Inhalt wie die nebenstehende, welche die frühere Zeit überhaupt nicht kannte.
Die Neujahrskarten des 18. Jahrhunderts sind meist in Kupfer gestochen und koloriert, seltener sind sie in Holzschnitt ausgeführt. In manchen ist ein Raum zum handschriftlichen Eintrag des Wunsches offen gelassen, meist aber sind die glückwünschenden Verse mit Lettern eingedruckt, häufig auf ein eingesetztes Stück von rosa Seide, das dann oft durch eine Klappe geschützt ist. Nicht selten sind die Karten ganz aus rosa Seidenstoff, der auf Papier aufgezogen ist, um ihm Halt zu geben. Gegen Ende des Jahrhunderts und im Beginn des unsrigen werden gern gepreßte Karten verwendet, wie überhaupt schon eine große Mannigfaltigkeit besteht.
Eine besondere Art Karten wurde von den Künstlern jener Zeit zu eigenen: Gebrauch für Freunde und Gönner hergestellt. Manch reizendes Blättchen, das von liebenswürdigem Künstlerhumor zeugt, ist auf diese Art entstanden. Der eine stellt sich vor, wie er in das Zimmer tritt und seinen Glückwunsch darbringt, der andere entschuldigt sich, daß er nicht selbst kommen könne: er hat sich mit in die Thüre eingeklemmtem Mantel dargestellt, der ihn am Kommen verhindert. Namentlich die Nürnberger Künstler Haller von Hallerstein, Klein, Erhard, Wilder, Fleischmann u. a. haben solche Blättchen gestochen. Nicht immer hat die Darstellung Bezug auf den Jahreswechsel; häufig ist ein interessantes altes Denkmal abgebildet und mit Widmung und Wunsch versehen. Solche Karten werden hier und da noch in der Gegenwart von Künstlern ausgeführt. Es wäre sehr erfreulich, wenn diese alte Sitte bei unseren Künstlern wieder mehr in Aufnahme käme.
Wie sehr das unerschöpfliche Thema des Jahreswechsels geeignet ist, phantasie- und gemütvollen Künstlern Anregung für graziöse, bald sinnige, bald humoristische Bilder zu geben, die dem kleinen Format der Glückwunschkarten entsprechen, dafür hat in neuerer Zeit gar ansprechende Zeugnisse aber auch die Industrie hervorgebracht, welche der Massenerzeugung der Neujahrskarten obliegt. Einzelne hervorragendere Firmen haben dem auf diesem Gebiete herrschenden Ungeschmack dadurch zu begegnen gesucht, daß sie erste künstlerische Kräfte für die Ausführung neuer Blätter gewannen. Zunächst ist freilich noch der Ungeschmack in der Ueberzahl, ja die niedrigsten Gattungen des Scherzes und Witzes haben sich mit bedauerlichem Erfolg dieser Mitteilungsform bemächtigt, die von Ursprung her nur bestimmt war, seinen Mitmenschen Segen und Heil fürs neue Jahr zu entbieten.
Das Bild des alten Malers.
Es freut mich, daß auch Ihnen dieses Bild besonders gefällt,“ sagte der alte Justizrat Landmann. „Es ist ein schönes und gesundes Werk und nebenbei so eine Art Familienstück.“ Dabei lachte er leise und geheimnisvoll in sich hinein.
Wir saßen zu Zweien in dem kleinen Gemach neben dem Eßzimmer seiner Villa, in jener behaglichen und mitteilsamen Stimmung, die der würzige Geruch von echtem Kaffee und Havannarauch nach einem guten Mahle zu erwecken pflegt. Draußen vom Rheine klang das Stampfen und Rauschen eines Salondampfers herein, das Verdeck war dicht besetzt, und man konnte in der klaren Augustluft die einzelnen Gruppen und Gestalten scharf unterscheiden: junge Pärchen auf der Hochzeitsreise, die sich gegenseitig auf jedes alte Haus in der Front des Rheinstädtchens aufmerksam machten und dabei einander so dankbar in die Augen schauten, als hätten sie sich soeben fürstlich beschenkt, reisende Engländer, die ernsthaft in ihren roten Büchern die Geschichte der Burgruinen auf dem jenseitigen Ufer nachlasen, ohne die Burgen selbst eines Blickes zu würdigen, und alle die anderen ständigen Personen dieses lustigen Sommerschauspiels.
Der alte Herr beachtete sie nicht. Er hatte sich mit dem Rücken gegen das Balkonfenster gekehrt und betrachtete nachdenklich sein Lieblingsbild. Es war offenbar Porträt: eine junge Frau von kräftigen, fast üppig zu nennenden Formen, in einfacher ländlicher Tracht. Die linke Hand stützte sie auf ein Weinfäßchen, den vollen rechten Arm streckte sie aus weitem, halb zurückgleitendem Aermel aus, als wollte sie dem Beschauer den Römer kredenzen, den sie zierlich zwischen den rundlich schlanken Fingern hielt. Das Gesicht fast ganz von vorn – ein unendlich fröhliches Gesicht mit lachenden Augen, lachenden Wangengrübchen und lachendem Munde, der die schönsten Zähne sehen ließ. Von den dichten rotblonden Haarflechten hatte sich eine gelöst und rieselte wie ein Goldbächlein über die breite Schulter nach vorn auf das dunkle Kleid. Die Behandlung von Licht und Schatten wie die ganze frische kerngesunde Art des ziemlich in Lebensgröße gehaltenen Bildes erinnerte durchaus an Meister Rembrandt.
„Ja, es ist ein vortreffliches Bild,“ wiederholte der alte Herr. „Vortrefflich auch darin, daß die Nachahmung vollkommen ehrlich bleibt. Du lieber Gott, ich kenne ja einige sogenannte Bilderfreunde, denen man ohne sonderliche Mühe das Ding als einen Rembrandt oder einen anderen berühmten Holländer aufbinden könnte. Aber der Maler hat gar nicht an solche Schlechtigkeiten gedacht. Er hat sich einfach von einer geistesverwandten Vorliebe für den alten Meister den Pinsel führen lassen – und freilich auch von einer andern Liebe. … Für mich aber hat das Bild noch eine ganz eigene Bedeutung – und weil’s Ihnen so gefällt, so sollen Sie zur Belohnung für Ihren guten Geschmack die ganze Geschichte hören. Es dauert doch noch ein Stündchen, bis Ihr Dampfer kommt …“
Und der Alte erzählte:
„Es ist jetzt etwa zehn Jahre, daß ich das Bild besitze. Ich hatte kurz zuvor den Staatsdienst quittiert und war hierher gezogen; mein Töchterlein, damals ein Mädel von siebzehn Jahren, war noch zu Koblenz in strenger und heilsamer Hut des Instituts, allwöchentlich kam sie ’mal herüber. Drunten im Städtchen hauste zu jener Zeit ein kleiner Weinhändler, ein listiger alter Patron mit roter Nase und mächtiger Glatze. Persönlich machte der Kerl gerade nicht den besten Eindruck – wir alten Juristen haben in Fragen der Reellität eine feine Nase – aber seinen Stammgästen
[885] schenkte er in dem alten verräucherten Stübchen einen guten Tropfen, und auch ich kehrte öfters dort ein. Da er alsbald meine Liebhaberei für Bilder kannte, so verriet er mir eines Tages mit seinem pfiffigsten Gesicht, daß er ein schönes Stück habe, um mäßigen Preis wolle er es mir lassen. Na, was er mir über den Erwerb des Bildes sagte – er behauptete, ein armer und selbstverständlich durstiger Maler habe es ihm zur Deckung seiner Trinkschulden gegeben – sehr Vertrauenswert klang das nicht, aber das Bild gefiel mir sogleich sehr, bei dem Weinzapf wäre es ja doch verkümmert, und – kurz, ich kaufte es ihm für ein paar hundert Mark ab.„Sie wollen sich wohl für das Geld noch einige Zeitungen mehr anschaffen?“ fragte ich ihn; denn der Kerl hatte eine ganz merkwürdige Leidenschaft für allerlei Zeitungen, meist Lokalblätter aus ganz entlegenen Gegenden, die hier keinen Menschen interessieren konnten; er selbst studierte sie aber mit großem Eifer und abonnierte auf neue noch immer dazu. Als dann freilich später herauskam, weshalb er dieses sonderbare Preßstudium betrieb, da war es mit ihm aus, und er mußte schleunigst einen Luftwechsel vornehmen, um nicht dem Gericht oder gar einer Art Lynchjustiz seiner Weinbauenden und weinhandelnden Mitbürger zu verfallen. Der Bursche hatte nämlich jahrelang eine ganz eigenartige Gaunerei betrieben; er verkaufte Wein an Verstorbene. Wenn er in einem von seinen ostpreußischen oder pommerschen Lokalblättern die breitgeränderte Todesanzeige irgend eines Honoratioren fand, der anscheinend zahlungsfähige Erben hinterlassen hatte, so sandte er alsbald an die bisherige irdische Adresse des Seligen ein Faß miserablen Krätzers ab, den er auf irgend eine wohlklingende Marke taufte, mit Faktura „laut Ihrer werten Bestellung vom so und so vielten“, sagen wir acht Tage vor dem Todestag. Kam dann der Wein dort an, mitten in die Verwirrung der Trauer und Nachlaßordnung, so gab es gemeiniglich eine große Rührung: „Ach seht ’mal, den Wein hat Vater noch erst neulich bestellt, damit wollte er sich noch laben und uns eine Freude machen – den wollen wir in Ehren halten und verwahren, der soll auf den Tisch kommen, wenn dereinst auch einmal ein fröhlicher Anlaß die Familie wieder vereint,“ und so weiter. Die Rechnung wurde in den meisten Fällen quittiert, unser Gauner strich vergnügt seinen Raub ein, und nach Jahr und Tag wunderten sich die Leute da oben über den schlechten Geschmack ihres Verstorbenen, oder machten sich Vorwürfe, daß sie den edlen Wein nicht richtig behandelt hätten. Endlich ereilte den Kerl aber doch die Vergeltung, da er den Mißgriff that, auf eine ganz besonders große und Wohlstand verratende Todesanzeige hin ein gehöriges Faß Wein an die Adresse eines ostfriesischen Pastors zu schicken, der mit seiner Familie strenger Mäßigkeitsvereinler und obendrein seit zwei Jahren gelähmt gewesen war, mithin weder Weinbestellungen noch sonst etwas schreiben konnte. Die Verwandten witterten eine grausame Verhöhnung ihres enthaltsamen Vaters, sie ließen Ermittlungen anstellen, und so kam die Geschichte denn nach und nach heraus, worauf der Verbrecher schleunigst ins Ausland verschwand.
Solches geschah im Spätherbst, kurz nach der Weinlese und etwa ein halbes Jahr, nachdem ich das Bild erworben hatte. Mit besonderer Genugthuung betrachtete ich es nun, in dem Bewußtsein, es gerade noch zur rechten Zeit aus unwürdigen Händen befreit zu haben. Ich hatte es um der Beleuchtung willen, und weil ich es doch nicht drüben unter die echten Alten in meinem sogenannten Galeriezimmer einreihen wollte, hier aufhängen lassen, etwas höher, als es jetzt hängt, und mehr nach der Ecke dort, wo nun das geschnitzte Schränkchen steht. Meiner Tochter gefiel die rothaarige Weinschenkin ganz besonders. Allemal, wenn sie mich besuchte, war auch ihr Gang alsbald nach dem Bilde, und es war ordentlich, als wenn von dem lustigen gemalten Mädel ein voller Strahl des Frohsinns in ihr eigensinniges Braunköpfchen hinüberflöge, so heiter und liebevoll war sie gegen mich, wenn sie erst mit ihrem geliebten Bilde einsame Zwiesprach gepflogen hatte.
Es schien aber, daß dieser moderne „Rembrandt“ auch noch andere Leute förmlich bezauberte. Da lebte damals drunten im Städtchen ein junger Mann aus Berlin, ein Schriftsteller, der sich angeblich um der stillen und nervenstärkenden Luft willen in unser kleines Weinnest zurückgezogen hatte. Eines Tages – ich hatte ihn nur erst flüchtig kennengelernt – stellte er sich bei mir vor und bat, ihm das Bild zu zeigen. Er musterte es lange und aufmerksam, schien ganz ergriffen, that auch etliche tiefsinnige Bemerkungen über Rembrandt, Helldunkel und dergleichen, die unverkennbar nach einem frischen Studiengang in irgend einem Leitfaden der Kunstgeschichte schmeckten, und schließlich bat er um Erlaubnis, das Bild dann und wann in aller Stille, und wenn er mich nicht störe, wieder betrachten zu dürfen. Er möchte es als Motiv in einem Roman verwenden und sei überzeugt, daß er des häufigeren Anblicks bedürfe, um die Stimmung jedesmal wieder richtigzustellen [886] und festzuhalten. Na, von diesen Dingen verstand ich ja nun nichts, jedenfalls soll man einem Künstler nie die Möglichkeit versagen, in Stimmung zu geraten, und so kam er seitdem wieder, durchschnittlich alle Wochen einmal, ließ sich still in dies Zimmer geleiten und beschäftigte sich eine Weile damit, einsam und ungestört sich von der Weinschenkin zurechtstimmen zu lassen. Zuletzt fing er sogar an, eine kleine Kohlenskizze nach dem Bilde zu zeichnen, ein höchst trauriges Machwerk, das aber erschrecklich viel Zeit in Anspruch nahm und eigentlich nie fertig wurde.
Selbstverständlich sorgte ich dafür, daß meine Tochter bei ihren Besuchen nie mit dem Stimmungsjäger, der sich äußerlich als ein sehr netter gewandter Mensch darstellte, zusammenkam. Man kann nicht vorsichtig genug mit den jungen Leuten sein, zumal wenn sie schon in der Begeisterung für ein und denselben Gegenstand zusammentreffen. Gar zu leicht kommt es dann zu einer Verwechslung, sie glauben noch immer ihren gemeinsamen Liebling anzuschwärmen und schwärmen anstatt dessen einander an. Uebrigens mochte der junge Mann etwas von meinen Befürchtungen nach dieser Seite gemerkt haben oder litt er an einer gewissen Schüchternheit während seiner Stimmungsjägerei, jedenfalls war er taktvoll genug, auch seinerseits eine Begegnung mit meiner Tochter vor dem Bilde möglichst zu vermeiden. Ueberhaupt machte er einen ganz gebildeten Eindruck, und wie ich gelegentlich von einem Freund aus Berlin erfuhr, besaß er dort in litterarischen Kreisen bereits einen guten Ruf.
Nun, es mochten so etwa vier Wochen seit der Flucht jenes schuftigen Weingauners verflossen sein, an einem ziemlich klaren Novembermorgen – ich erwartete just an dem Tage mein Töchterchen – da meldete sich bei mir ein halbwüchsiges Wäschermädchen aus dem Städtchen drunten mit einer schönen Empfehlung vom Herrn Maler Franz Hahn und ob ich ihm nicht die große Güte erweisen wolle, ihn einmal aufzusuchen; er selber habe leider das Podagra und könne nicht gut gehen.
Ich hatte von diesem Maler Franz Hahn schon hin und wieder gehört. Als junger Mann war er vor einigen vierzig Jahren in das Städtchen gekommen, hatte sich dort in ein hübsches Mädchen aus geringem Stande vergafft, sich mit ihr verheiratet und war schließlich zu einem jener verkommenen Genies herabgesunken, die Porträts von Fleischern und Bauernmädchen für einen Thaler und eine Flasche Wein malen oder Ladenschilder, Wirtsstuben und Scheunengiebel mit stilvollen Pinseleien ausschmücken. In Romanen und Novellen machen sich diese Leute ganz gut, in Wirklichkeit sind sie meist ein Greuel für jeden ruhigen und fleißigen Mann und zum mindesten ein betrübendes Schauspiel, da ihnen wie anderen verkommenen Menschen auf die Dauer auch das abgeht, was verkommene Häuser noch erträglich machen kann – nämlich das Malerische.
In dieser Hinsicht machte allerdings Franz Hahn eine Ausnahme. Als ich ihn ein paar Stunden später in dem ärmlichen Stübchen aufsuchte, welches er bei der Mutter seiner Botin bewohnte, war ich fast wider Willen angenehm berührt von dem gescheiten freundlichen Gesichte des Alten, aus welchem mich unter einer hochgewölbten Stirn ein Paar offenblickender kluger Maleraugen fast schalkhaft anlugte. Allerdings leuchtete unter diesen Augen eine Stumpfnase von einer ganz unerlaubten Röte, und ich gewahrte einige leere Flaschen auf dem unordentlich vollgekramten Tische, welche jedenfalls etwas anderes enthalten hatten als Mineralwasser oder kalten Kaffee. Uebrigens war der Alte fleißig gewesen; bei meinem Eintritt bedeckte er mit dem Tuche ein Bild, an welchem er, vor einer höchst baufälligen Staffelei mühsam sitzend und das dick umwickelte Bein weit ausgestreckt, malte.
Nachdem ich mir aus einer Ecke des Zimmerchens, welches eine wahre Blüte der Unaufgeräumtheit vorstellte, einen wackligen Stuhl herbeigeholt, der unter anderem auch als Waschtisch gedient zu haben schien, klagte mir Franz Hahn nach vielen Entschuldigungen sein Leid. Er habe sich an mich gewandt, weil er gehört habe, daß ich von Haus aus Jurist sei und ein Herz für Bilder, folglich vielleicht auch wohl für Maler habe. Vor sieben Monaten etwa sei jener Weinwirt zu ihm gekommen und habe ihn mit großer Härte an eine Zechschuld gemahnt, die allerdings schon seit Jahr und Tag fällig war. Schließlich habe ihn der Mann vor die Wahl gestellt, entweder gerichtliche Klage und Pfändung zu gewärtigen oder ihm gutwillig als Pfand ein Bild zu überlassen, welches er noch in jungen Jahren gemalt und als Andenken behalten habe. Es sei das Bildnis seiner Frau gewesen, so wie sie ihn zuerst an jenem Tage, wo ihn das Schicksal in dieses Städtchen geführt, als Kellnerin unter der Thür eines Wirtshauses begrüßte. Er habe es nach ihrem frühen Tode gemalt, unter vielen Entbehrungen und Schmerzen, und seitdem immer in Händen behalten, als eine teuere Erinnerung und zugleich, wie er meine, als sein bestes Bild. Da er nun aber gewärtigen mußte, durch gerichtliche Pfändung wegen Trinkschulden doch das Bild und zugleich auch die Aussicht auf die Unterstützung, welche ihm etwelche fromme und weichherzige Leute bisher dann und wann zukommen ließen, zu verlieren, so habe er es dem Gläubiger gelassen, nachdem dieser versprochen, das Faustpfand in Ehren zu halten und nicht zu veräußern. Er selbst habe dann versucht, durch Sparsamkeit und allerlei Handwerksarbcit die Summe – es waren etwa hundert Mark – zusammenzukargen, und zur Hälfte habe er sie auch schon zurückgelegt gehabt, als ihn leider das böse Podagra wieder befallen habe. Inzwischen sei nun jener schlechte Mann geflohen, dessen Verwandte wollten nie etwas von dem Bilde gehört haben und hätten ihn grob abgewiesen, und nun quäle ihn Tag und Nacht die Sorge um sein Bild, das letzte Andenken an seine kurze glückliche Ehe und an eine bessere Künstlerzeit. Ob ich ihm da nicht mit Ratschlägen und Nachforschungen helfen wolle?
Es war mir nicht zweifelhaft, daß es sich um das Bild dort handle, welches jener Wirt also einfach durch eine seiner Gaunereien an sich gebracht hatte, um ein paar hundert Mark an mir zu verdienen, und ich muß sagen, daß es mir eine rechte Freude war, den Alten über den Verbleib seines Werkes aufzuklären und [887] ihm dessen Rückgabe zu versprechen. Ganz unbeschreiblich aber war die Rührung, mit welcher mir der Alte dankte. Die hellen Thränen flossen ihm aus den Augen, als ich das Bild der Wahrheit gemäß lobte.
Nun bat ich ihn, mir aber auch seine neueste Schilderei zu zeigen. Nur zögernd willfahrte er; es sei eine Art Porträtskizze, die er vor langen langen Jahren in Koblenz gemacht habe. Da er immer ein gutes und rasches Gedächtnis für schöne und bezeichnende Gesichter besessen, so sei es seine Gewohnheit gewesen, die Züge solcher Personen, die ihm öfters begegneten und ihn durch Schönheit oder Charakter fesselten, zu Hause aus dem Kopfe leicht zu skizzieren. So habe sich eine ganze Mappe einzelner Blätter angesammelt und erhalten, von denen er nunmehr einige auszuführen gedenke, so gut es gehe, in der Hoffnung, vielleicht von einem Kunsthändler ein Paar Thaler dafür zu bekommen. Wie erstaunte ich aber, als der Alte das Tuch entfernte und vor mir, fast ganz ausgeführt, in sauberster Arbeit und mit packender Wahrheit, das Porträt einer jungen schönen Dame stand, die ich selbst gekannt und zwar sehr wohl gekannt hatte; denn sie war ja nachmals meine geliebte Frau und die Mutter meines einzigen Kindes geworden! Nachdem ich meine Rührung einigermaßen bemeistert, durchmusterte ich die übrigen Skizzen – alles gute Bekannte, werte Freunde und auch einige gleichfalls sehr werte Feinde aus jener fröhlichen Jugendzeit! So manches liebe Gesicht längst Verstorbener, dem ich niemals hätte hoffen dürfen, wieder zu begegnen! Und der Mann, der diese meisterhaften Skizzen entworfen, ein echter Künstler von Gottes Gnaden, war hier in diesem Neste hängen geblieben, verkommen und verschollen, und saß jetzt hier neben mir als ein unzünftiger Anstreicher außer Dienst!
Ehe ich die stattliche Reihe der Skizzen – sie hängen jetzt ausgeführt drunten in dem runden Zimmer, und Sie haben sie nicht erst heute bewundert – zu Ende gesehen, war mein Plan gefaßt. Dem Alten trug ich ein hübsches Zimmer in meinem Hause, Unterhalt und – was ich für einen wichtigen Punkt in seinen Augen hielt – Freitrunk auf Lebenszeit an, dafür erbat ich mir von ihm als Deposit und späteres Erbteil die Bilder. Wir waren rasch handelseinig und ich verabschiedete mich von dem alten Künstler mit dem Versprechen, ihn noch selbigen Tages in meinem Wagen holen zu lassen.
Nach Tisch fuhr ich zum Bahnhof, um meine Tochter zu erwarten. Ich war so erfüllt von meinem Plane, daß ich ihr alsbald nach der Begrüßung davon erzählte. Sie teilte aufs herzlichste meine Freude und bestand darauf, daß wir sogleich auf dem Rückwege vor der Wohnung des Malers vorführen und ihn mitnähmen. Als ich ihr dort das Bildnis ihrer Mutter zeigte, begrüßte sie es mit Thränen und nahm es sofort an sich, versäumte aber auch nicht, Franz Hahn so freundlich und lieb zu danken, daß der Alte ordentlich wiederstrahlte. Im Wagen erzählte ich ihm dann von der eigentümlichen Verehrung des jungen Dichters, der auch am Vormittag während meiner Abwesenheit wieder vor dem Bilde geweilt hatte, und der Schwärmerei meiner Tochter für dasselbe. Meine Tochter errötete dabei ein über das andere Mal, wie das so die Art der Mädchen ist, wenn man in ihrer Anwesenheit von einem Gegenstand ihrer besonderen Neigung spricht.
Daheim wünschte Franz Hahn sogleich vor das wiedergefundene Bild geführt zu werden. Vorsichtig geleitete ich ihn in dies Zimmer und weidete mich an seiner Freude. Nach richtiger Malerart begann er aber, sobald er sich etwas gesammelt, die Beleuchtung zu kritisieren, welche viel günstiger sein werde, wenn das Bild mehr nach der Mitte hin gehängt würde. Ich bezweifelte das – wie ich jetzt gern zugestehe, sehr mit Unrecht – wir gerieten in Eifer und beschlossen, sogleich einen Versuch zu machen. Darüber kehrte meine Tochter zurück, die nebenan im Eßzimmer einen Willkommtrunk für unseren neuen Hausgenossen bereit gestellt und in ihrem Eifer den großen Löffel der Bowle in der Hand behalten hatte. Als sie unsere Absicht wahrnahm, wurde sie ganz entrüstet und verlangte, wir sollten das nachher besorgen und jetzt ins Eßzimmer gehen. Wir waren aber natürlich viel zu gespannt auf den Ausgang unserer Beleuchtungsstudien, um ihr zu folgen. Somit faßte ich das Bild an, um es von seinem bisherigen Platze zu heben. Da fiel etwas Weißes raschelnd hinter dem Bilde herunter zur Erde, und wie ich’s aufhob, was war es? Ein Briefchen, adressiert mit dem Vornamen meiner Tochter in der unverkennbarsten Männerhandschrift.
Ich sah meine Tochter an, die in höchster Verwirrung einen glühenden Eifer entwickelte, mich von der Lektüre des Schreibens abzubringen. Dann brach sie in Thränen aus. Ein grelles Licht
[888][889] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [890] begann mir aufzugehen. Natürlich brach ich den Brief ohne weiteres auf, und ich brauchte nur die ersten Zeilen zu überfliegen, um mich zu überzeugen, daß es ein Liebesbrief von der blühendsten Gattung war.
Und da behüte einer junge Mädchen! Das Institut in Koblenz war berühmt wegen seiner strengen Zucht. Von dort einen Briefwechsel mit einem jungen Manne anzufangen, war ungefähr so schwer wie den König von Spanien zu stehlen. Und trotz alledem hatten sie sich – im Hause der Tante einer Mitschülerin angeblich – kennengelernt, verliebt, ausgesprochen, und in Ermangelung eines öffentlicheren Verkehrsweges mußte dieses werte Bild als Briefkasten dienen, durch den anscheinend ein recht lebhafter Meinungsaustausch zwischen den beiden jungen Kunstenthusiasten vermittelt worden war!
Jetzt begriff ich allerdings, welch wichtige Motive und Stimmungen dieser junge Mann aus dem Bilde zog, oder auch hineinlegte. Ich brauche nicht zu sagen, wie mich diese Beichte, die mir mein schuldbeladenes Töchterlein unter vielem Schluchzen und Stammeln vortrug, fürs erste stimmte. Vermutlich sprach ich mich darüber auch sehr deutlich aus, und es mag sein, daß ich dabei einen Teil meines väterlichen Zornes auf das Bild ablud und ihm einige Eigenschaftswörter beilegte, die es im Grunde nicht verdiente.
Aber da legte sich Franz Hahn ins Zeug. „Herr Justizrat,“ sagte er bescheiden aber fest, „das ist kein verfluchtes Bild. Dazu steckt viel zu viel Liebe darin. Die Liebe hat es gemalt, die unauslöschliche zu einer, die nicht mehr auf Erden weilte – die Liebe hat es durch ein halbes verlorenes Menschenleben hindurch gerettet, entschwundenen Glückes eingedenk. Und nun es bei Ihnen ein freundliches Obdach gefunden, da hat es sogleich wieder der Liebe dienen wollen, und gewiß einer guten und treuen Liebe. Glauben Sie doch meinen Augen – ich bin ein armer Kerl und sehr heruntergekommen, aber doch ein Maler mit Maleraugen – ich sehe das liebe Fräulein dort und sehe Sie, ihren Vater, und da weiß ich, daß unser Herrgott auch den Dritten im Bunde dazu richtig ausgewählt hat!“
Na, was soll ich weiter sagen – der Alte redete auf mich ein, mit Thränen in den Augen und dazu mit einem so unglaublich braven humoristischen Lächeln in seinem verwitterten Gesicht – und mein Töchterlein schluchzte und bat und hatte auch sogleich mit weiblicher Strategie das Bild ihrer Mutter zur Hand und hielt es mir vor – du lieber Gott, was soll ein armer Vater machen, wenn Mutter und Tochter so auf ihn einstürmen! Wenigstens mußte ich soweit kapitulieren, daß ich nun erst einmal in Ruhe den Brief las – umfangreich genug war er, obwohl eigentlich an sachlichen Angaben in dem ganzen Aktenstück nur die Mitteilung stand, daß „sein“ neues Schauspiel gestern in Berlin mit kolossalem Erfolge aufgeführt worden sei und „er“ sich jetzt hinlänglich sichergestellt fühle, um bei mir anzuhalten; sie möge mich darauf vorbereiten. Hm, die Vorbereitung! Aber was sonst noch in dem Briefe stand, die üblichen weitläufigen Kurialien solcher Aktenstücke aus Amors Kanzlei, schien mir schließlich doch alles von einer sehr netten soliden Persönlichkeit herzurühren …
Den weiteren Verlauf können Sie sich ja wohl denken. Ich suchte meinen Rückzug mit Würde zu decken, aber das Ende vom Liede war natürlich, daß der Werber kam, warb und siegte … Nun, Gott sei Dank, sie sind glücklich geworden miteinander und ich habe die Zuversicht, daß wenn nicht mein Name, doch mein Stamm in Ehren weiter blüht. Franz Hahn hat aber noch mehrere Jahre hier bei mir gelebt, gezecht und gemalt. Es war ein schöner Nachsommer für ihn, und ich habe auch mein Teil davon geerntet. In jener ersten Zeit meiner Einsamkeit war mir der Humor des Alten, sein feines Kunstgefühl und seine ganze Gesellschaft eine tägliche Lebensfreude, das darf ich wohl sagen. Was er als Künstler wert war und was gar erst unter anderen Bedingungen aus ihm geworden wäre, davon kennen Sie ja die Beweise. Mein Schwiegersohn suchte ihn mehrmals zu bereden, daß er das eine oder andere von seinen Sachen ausstelle, und die Kritik hätte jedenfalls dafür gesorgt, daß es noch Anerkennung finde, aber davon wollte der Alte nichts wissen. „Meine Bilder sind in guten Händen,“ sagte er. „Das ist für einen alten Malersmann genug und mehr wert als ein Platz in Kunstgeschichtskatalogen. Und wenn je ein künftiger Docent an der Akademie es für unumgänglich nötig hält, mich an diesen Platz zu stellen und kritisch zu beleuchten, so verderben Sie ihm doch nicht im voraus die Freude, nur ungenügenden biographischen Stoff zu finden und mir mit seinem Scharfsinn ein Schicksal und einen Namen zusammen zu basteln! Wer weiß, ob es ihm nicht einen Ruf auf eine ordentliche Professur einträgt und ihn in Stand setzt, das Weib seiner Liebe heimzuführen!“
Dabei blieb er. Er war eben Zeit seines Lebens im Kampf um das Glück einer von den Mindestfordernden gewesen, während die Mehrzahl es für besser hält, möglichst viel zu verlangen. Aber jedenfalls hatte ihm die kurze Spanne Glück, der er in jungen Jahren seinen etwaigen Künstlerehrgeiz opferte, ein stilles Feuerlein in der Seele hinterlassen, das ihn bis zuletzt durchwärmte. Und daß er mit dem Bilde, das zum Denkmal seines eigenen Jugendglücks geworden war, das junge Glück meines Kindes hatte begründen helfen, dies trug gewiß nicht wenig dazu bei, jenes stille Feuerlein der Erinnerung in seiner Seele noch einmal vor seinem Ende frisch anzufachen.“
| * | * | |||
| * |
Der alte Herr hatte seine Erzählung beendet. Draußen klopfte der Diener leise mahnend an die Thür: der Dampfer war in Sicht, ich mußte aufbrechen. Noch einmal trat ich an das Bild heran. Ein voller warmer Sonnenstrahl zitterte durch die Jalousie quer darüber hin, er belebte das Lächeln auf den Lippen der schönen Schenkin, und ein Hauch des in ihr verkörperten Jugendglücks traf mein Herz.
Gaunerzinken.
Vor einigen Jahren fanden Gendarmen an einer einsamen Waldkapelle im Steiermärkischen ein paar sonderbare (auf S. 891 abgebildete) Kritzeleien: einen Papagei, und zwar in einem Zuge gezeichnet, eine Kirche, einen Schlüssel, ein Häufchen von 3 Steinen und ein Wickelkind. Die Gendarmen waren erfahrene Männer und erkannten alsbald, daß es sich hier um einen sogenannten „Zinken“ handelte, um eine Mitteilung von Gaunern für Gauner, und zwar ließen Kirche und Schlüssel ohne weiteres auf einen beabsichtigten Einbruch schließen, der in einer Kirche bewerkstelligt werden sollte. Der Papagei war das Zeichen dessen, der zur That einlud. Rätselhaft war anfangs nur das Häufchen mit den drei Steinen und das Wickelkind. Ein Pfarrer, den das Gericht beizog, fand die liturgische Deutung: die drei Steine waren das im steiermärkischen Bauernkalender übliche Zeichen für den Hl. Stephanus, der bekanntlich den Märtyrertod des Gesteinigtwerdens starb, und das Wickelkind bedeutete das Christkind. Also: am Stephanstage (26. Dezember) wollte der Mann mit dem Papageiwappen einen Einbruch in einer Kirche unternehmen. Zusammenkunft am Christfest (25. Dezember) bei der Waldkapelle.
An diesem Christfest wurden vier berüchtigte Gauner bei der Waldkapelle erwischt und dingfest gemacht.
Nicht immer gelingt es so den Wächtern des Gesetzes, die geheimnisvollen Zeichen vor geschehener That zu finden und zu deuten. Das seltsam romantische Verständigungsmittel hätte sich sonst wohl kaum bis in unsere Tage herübergerettet, wenn es nicht doch noch oft genug seinen Zweck erfüllte. Allerdings werden die wappenartigen Bilder – wie oben der Papagei – nach und nach verdrängt durch den Gebrauch der Schrift: auch die Gauner werden mit der Zeit gebildeter. Aber sonst wandern noch immer allerlei Mitteilungen auf dem uralten Wege des Zinkens von einem Spitzbuben zum andern.
[891] Unter „Zinken“ versteht die Gaunersprache jede geheime Verständigung, nicht bloß die schriftliche, sondern auch diejenige vermittelst Finger-, Augen- und Gebärdensprache, durch Töne aller Art, Klopfen, Tierstimmen u. dergl. Am merkwürdigsten sind aber doch die graphischen Zinken, vielleicht auch am ältesten, denn sie führen zweifellos auf die alten Mordbrennerzeichen zurück, mit denen schon vor Jahrhunderten den Mitgliedern einer weitverzweigten Bande das nächste Opfer kundgemacht wurde. Ein schräges Kreuz mit ein paar Seitenstrichen am einsam stehenden Hof, das war genug, den Bauern dem Messer, Haus, Stall und Scheune dem Feuer zu überliefern. Auch die besonderen Wappenzeichen einzelner Mordbrenner kamen frühe schon auf, sicher schon im 15. Jahrhundert. Ein Beispiel dafür aus dem 17. Jahrhundert hat sich auf einer Thüringer Waldkapelle gefunden und ist uns erhalten geblieben. Da stand auf der ersten Zeile ein nach links weisender Pfeil, daneben vier Striche, endlich eine Mondsichel im letzten Viertel; d. h. in verständliches Deutsch übertragen: Mit dem letzten Viertel des Monds geht es gegen das vierte Haus in der Richtung des Pfeils. Darunter aber stand eine ganze Kette von „Visa“, von Unterschriften solcher, die von der freundlichen Einladung des ersten Schreibers Kenntnis genommen hatten und ihre Bereitwilligkeit erklärten, von ihr Gebrauch zu machen: ein Vogel, ein Würfel, ein Schlüssel, ein Topf und eine Kette.
Die zahmeren Enkel dieser unheimlichen Vorfahren leben heute noch. „Wer,“ so schreibt Dr. Hanns Groß in Graz in seinem „Handbuch für Untersuchungsrichter“ (Graz, Leuschner u. Lubensky), „an Kapellen, Scheunen, Kreuzen, Zäunen, Mauern, besonders an einsamen Orten und an Wegkreuzungen sich aufmerksam umsieht, findet Gaunerzinken in Menge. Freilich bedeuten sie nur selten mehr Mord und Brand, wohl aber, daß dieser oder jener Fechtbruder am soundsovielten hier war, in Begleitung oder allein, daß er in der angegebenen Richtung sich entfernte und am soundsovielten wieder zurückkommen will.“ Dazu kommen Andeutungen, in welchen Häusern das Betteln Erfolg habe, in welchen nicht, wo Gelegenheit zu einem Diebstahl sich biete u. dergl. m. Da steht z. B. eine offene Hand, darunter ein Pfeil nach rechts mit den Zahlen 4, 7, 11, 20 und ein Pfeil nach links mit den Zahlen 10, 6, 3; jeder Eingeweihte weiß hiernach genau, in welchen Häusern gut betteln ist. Oft wird zu diesem Zweck jedes Haus besonders markiert; ein leerer Kreis (vielleicht das Bild eines Geldstücks) bedeutet, daß hier etwas zu haben sei, ein schräges Kreuz, daß nichts zu machen sei, eine Verbindung beider, daß man hier wohl etwas bekomme, aber kein Geld, sondern höchstens Eßwaren oder abgetragene Sachen. Geige und Flöte dienen demselben Gegensatz zum Ausdruck: wo „der Himmel voller Geigen hängt“, da mag der Fechtbruder ruhig eintreten, nicht aber da, wo alles „flöten gegangen ist.“
Daß die Gaunerzinken auch heute noch durchaus nicht immer so verhältnismäßig harmloser Natur sind wie diese Bettelzeichen, geht schon aus der eingangs erzählten Geschichte hervor. Noch bedenklicher ist ein anderer Fall, der ebenfalls in Steiermark spielt und den Groß wie folgt erzählt:
„Vor mehreren Jahren wurde auf einsamer Waldstraße in der östlichen Steiermark ein Gendarm erstochen gefunden; er war durch unzählige Messerstiche getötet worden. Der Augenschein hatte ergeben, daß er sich am Rande der Straße niedergesetzt hatte, um sich eine Pfeife zu stopfen, sein Tabakbeutel war offen, der Tabak zerstreut, die Pfeife frisch und halb gefüllt. Er war wegen seines überaus pflichttreuen thatkräftigen Vorgehens namentlich bei den Landfahrern und Zigeunern gefürchtet und verhaßt und auch von Zigeunern, die ihn in der geschilderten Stellung meuchlings überfallen hatten, ermordet worden. – Wenige Tage nach seinem Tode wurde nicht weit vom Thatorte auf einer halbverfallenen Mauer eine rohe Zeichnung gefunden, deren Deutung nicht zweifelhaft sein konnte. Es war ein zwar fratzenhaft gezeichnetes, aber nicht zu verkennendes Gesicht, mit dem Hahnenfederhute der Gendarmen, die Züge des Ermordeten daran kenntlich, daß der martialische Schnurrbart desselben ungeschickt, aber unverkennbar nachgeahmt war. Ueber dem Kopfe waren vier Messer sehr deutlich gezeichnet. Daß diese Zeichnung nicht später, d. h. nicht nach dem Tode des Gendarmen entstanden war, hat der Umstand bewiesen, daß sie vom Regen arg verwaschen war, obwohl es in der Zeit vom Morde bis zur Auffindung der Zeichnung nicht geregnet hatte.“
Groß fügt diesem Berichte nicht mit Unrecht hinzu: „Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, daß es sich hier um eine Drohung, Aufforderung zur Hilfeleistung, vielleicht auch um eine Warnung gehandelt hat, und daß die rechtzeitige Auffindung dieses Zinkens den braven Gendarmen hätte warnen und sein Leben erhalten können, da er dann mindestens nicht allein bei Nacht jenen gefährlichen Weg zurückgelegt hätte.“
Die Schlußsteinlegung im neuen Reichstagshause. (Zu dem Bilde S. 888 und 889.) Bereits in Nr. 45 des nun zum Abschluß gelangenden Jahrgangs hat die „Gartenlaube“ die Vollendung des neuen Reichstagshauses zum Anlaß für eine Würdigung seiner künstlerischen und nationalen Bedeutung genommen und dieses selbst den Lesern nebst den verschiedensten Räumlichkeiten aus seinem Innern im Bilde vorgeführt. Die weihevoll symbolische Handlung, welche nunmehr am 5. Dezember durch die vom Kaiser geführten drei Hammerschläge auf den dafür bereit gehaltenen Schlußstein im Kuppelraum der Wandelhalle vollzogen worden ist und die das Hauptbild der heutigen Nummer den Lesern vors Auge stellt, soll uns weiter die „Weihe des Hauses“ vergegenwärtigen, mit der das herrliche Gebäude in Gegenwart seines Erbauers am Tage der Eröffnung der neuen Reichstagssession von seiten der Reichsregierung und des Reichstags selbst seiner hohen Bestimmung übergeben worden ist. Mit demselben Hammer, mit dem vor zehn Jahren – am 9. Juni 1884 – von Kaiser Wilhelm I. die Grundsteinlegung des Hauses besiegelt worden war, vollführte nun sein Enkel den letzten Hammerschlag an dem Bau! Und, wie es in der kaiserlichen, beim Beginn der Feier vom neuen Reichskanzler, dem Fürsten Hohenlohe, verlesenen Urkunde heißt, soll dieser nun als „ein Denkmal der großen Zeit“ aufragen, „in welcher als Preis des schwer errungenen Sieges das Reich zu neuer Herrlichkeit erstanden ist, eine Mahnung den künftigen Geschlechtern zu unverbrüchlicher Treue in der Pflege dessen, was die Väter mit ihrem Blute erkämpft haben.“
Zu der Feierlichkeit, welche mittags um 1 Uhr begann, war der mittlere Teil der großen Wandelhalle festlich drapiert worden. Für den Kaiser und die Kaiserin, die Prinzen und Prinzessinnen in ihrer Begleitung war an der östlichen Front des Kuppelraums unter einem Baldachin eine Estrade errichtet. Die obersten Vertreter der Regierung, des Heers und der Marine, frühere Minister und Reichstagspräsidenten, unter diesen auch Simson, sowie der Maler Adolf Menzel befanden sich unter den geladenen Gästen – Fürst Bismarck hatte wegen des schweren Trauerfalls, der ihn betroffen, die Einladung absagen müssen. Auch die Mitglieder des Bundesrats gruppierten sich um die kaiserliche Estrade, während gegenüber, rechts und links von der westlichen Eingangsthüre zum Kuppelraum die Mitglieder des Reichstags Aufstellung nahmen. Wallot, die Mitglieder der Reichstagsbauverwaltung und die Meister des Maurer- und Steinmetzgewerkes hatten ihren Platz neben dem Schlußstein, an dessen Stelle sich später ein Denkmal Kaiser Wilhelms I. erheben soll.
Nach der Verlesung der Urkunde wurde dieselbe in einer Kapsel verwahrt und in die dafür hergestellte Höhlung des Schlußsteines versenkt. Dann überreichte der Bevollmächtigte Bayerns beim Bundesrat, Graf Lerchenfeld, indem er den Bau als „Wahrzeichen der Einheit des Deutschen Reiches“ pries, dem Kaiser die Kelle, mit welcher dieser aus der vom Meister des Maurergewerks gehaltenen Mulde den Mörtel in die Vertiefung des Schlußsteines warf, worauf die Meister der beiden Gewerkschaften den Schlußstein versetzten. Der Präsident des Reichstags, v. Levetzow, der seine Landwehrmajorsuniform trug, ergriff nunmehr das Wort und reichte dem Kaiser feierlich auf einer silbernen Platte den Hammer dar. In seiner Ansprache ward auch der Großartigkeit des Bauwerks selber gedacht. „Seine Grundmauern sind fest,“ fuhr er fort, „seine Hallen weit, seine Zimmer hoch, und fest in Treue, weit in Voraussicht, hoch in den Gedanken sei immer das, was je und je in diesem Hause möge beraten und beschlossen werden.“ Der Kaiser, hinter welchem wir auf unserem Bilde die Kaiserin und den Fürsten Hohenlohe sehen, erhob dann den Hammer; den dritten Schlag begleitete er mit den Worten: „Pro gloria et patria!“ Unter den letzten, die in programmmäßiger Reihenfolge den Hammerschlag ferner vollzogen, befand sich der geniale Erbauer des Hauses, Paul Wallot, der in zehnjähriger unermüdlicher Arbeit mit schöpferischem Künstlergeist das machtvolle Bauwerk ausgeführt hat, dessen von Würde und Anmut beseelter Stil der „Freude am Reich“ architektonischen Ausdruck verleiht. Auf unserem Bilde steht der Künstler rechts vom Präsidenten des Reichstags.
Das Brennen der Tannenzweige. Aus unserem Leserkreise wird an uns die Frage gerichtet, woher es wohl komme, daß frisches Fichten- und Tannenreisig unter so stürmischen, geradezu explosionsähnlichen Erscheinungen zu brennen pflege. Gerät z. B. am Christbaum eine Zweigspitze in Brand, so lodert sie auf unter züngelnden Flammen und lebhaftem Geknatter; dabei entströmen den brennenden Nadeln Gase mit so großer Kraft, daß die Flamme eines dicht daneben befindlichen Wachslichtes hin und her bewegt wird, ja mitunter erlöschen kann.
Dieser das Auge fesselnde Vorgang läßt sich auf folgende Weise erklären: während die grünen Blätter unserer Laubbäume bekanntlich nicht brennen, thun dies die Nadeln der Koniferen darum, weil sie in reichlichen Mengen ätherische Oele und harzige Massen, also leicht entzündliche Stoffe, enthalten und verhältnismäßig arm an Wasser sind. Die ätherischen Stoffe entzünden sich zuerst und lassen dabei die rasch von Nadel zu Nadel hineilenden Flämmchen entstehen; dann gerät auch die Nadelmasse selbst in Brand, wobei das in den Zellenräumen enthaltene Wasser durch die Hitze plötzlich in Dampf verwandelt wird. Der Wasserdampf mengt sich mit den Dämpfen des ätherischen Oels und verläßt die Nadeln unter stürmischen Erscheinungen; nähert man solchen Nadeln die Flamme einer Kerze, so sieht man oft, daß daraus Spitzen herausgetrieben werden, als ob man mit einem Lötrohr hineinbliese. Daß der Wasserdampf der Haupterzeuger dieser Erscheinung ist, erhellt schon daraus, daß sie um so weniger deutlich hervortritt, je älter und darum trockener das brennende Reisig ist. Das Knistern des brennenden Fichtenzweiges ist also auf dieselben Ursachen zurückzuführen wie das Knattern feuchten Holzes im Ofen. Die vereinte Wirkung der leicht entzündlichen ätherischen
[892] und harzigen Massen sowie des plötzlich erzeugten Dampfes bietet ein großartiges, furchtbar schönes Schauspiel bei Waldbränden, wo die Flammen unter lautem Prasseln die Bäume verschlingen. Auch das Zerbersten ganzer Baumstücke in winzige Splitter bei Blitzschlägen sicht man durch solche plötzliche Dampfbildung zu erklären. Der Blitz soll einen großen Teil des im Baumsafte vorhandenen Wassers augenblicklich in Dampf verwandeln und dieser urplötzliche Uebergang des Wassers aus dem tropfbar-flüssigen in den gasigen luftförmigen Zustand bringe eine regelrechte Explosion zustande, die das Holz so stark zersplittere. *
Die Frau als Erfinderin. Daß es in Amerika, wo den Frauen fast alle Berufszweige offen stehen, wo es Predigerinnen, Aerztinnen, Advokatinnen und Beamtinnen jeder Art giebt, wo sie als Agentinnen von Lebensversicherungen thätig sind, Bauten ausführen, Bankgeschäfte leiten, sogar als Schiffskapitäne das Kommando führen – daß es in Amerika auch nicht an Erfinderinnen fehlt, ist selbstverständlich. Bei Gelegenheit der hundertjährigen Jubelfeier des amerikanischen Patentamtes in Washington wurde ein Verzeichnis aller Erfindungen, die in diesem Zeitraum patentiert worden waren, veröffentlicht und dabei auch eine Liste der Frauen, die praktischen Anteil an den Verbesserungen und Neuerungen genommen haben und dafür Patente erhielten. Ihre Zahl beträgt 2400, allerdings nur ein kleiner Bruchteil der 480000 Personen, die in der angegebenen Zeit Patente erwarben. Aeußerst lehrreich ist es indessen, zu sehen, worauf die Frauen vornehmlich ihren Erfindungsgeist richteten. Die Toilette, und was damit zusammenhängt, spielt eine große Rolle, gelten doch 120 Patente allein dem Korsett; weitere 65 beziehen sich auf die Verbesserung der Nähmaschine. Zahlreiche Damen machten sich durch Erfindungen auf dem Gebiete der Krankenpflege, durch die Vervollkommnung der Geräte für Haus und Küche, Keller und Garten, für die Pflege und die Beschäftigung der Kinder verdient. Aber auch nach anderen Richtungen hin, die ganz außerhalb der häuslichen Thätigkeit, weitab von der gewöhnlichen Interessensphäre der Frauen liegen, hat sich weiblicher Scharfsinn bethätigt. Rettungsleitern und andere Hilfsvorrichtungen in Feuersgefahr, verbesserte Sägen, Nähmaschinen für Sattler, Silbertypen für Buchdrucker, Dampfkesselkonstruktionen, Alarmvorrichtungen für Bahnkreuzungen, Schiffsschrauben, unterseeische Teleskope, Maschinen zur Anfertigung von Papiertüten, zur gründlichen Reinigung der Baumwolle, zur Herstellung von Zucker- und Mehlfässern, Apparate für Rauchverzehruug sind von Frauen erdacht oder sinnreich verbessert worden. Viele dieser Leistungen haben sich glänzend bewährt und den Erfinderinnen Ansehen und Reichtum eingebracht. Zugleich zeigen diese Beispiele, denen sich noch manche andere hinzufügen ließen, die vielseitige Befähigung der Frau, ihren praktischen Sinn, ihre Thatkraft und Willensstärke, wenn ihrer Entwicklung freie Bahn gegeben wird.
Kinderaugen und Kindergewehre. Zu den schlimmsten und gefährlichsten Verletzungen des Auges zählen diejenigen, die durch Eindringen von Kupferstückchen verursacht werden; denn diese lassen sich nicht wie Eisensplitter mit Hilfe des Magnets entfernen. Am häufigsten ereignen sich solche Unfälle bei Kindern, die Zündhütchen durch Aufschlagen knallen lassen oder mit schlecht konstruierten Kindergewehren spielen. Gegen die zuerst erwähnte Spielerei haben wir in der „Gartenlaube“ wiederholt unsere Stimme erhoben. Diesmal möchten wir noch auf die Kindergewehre hinweisen. Der Augenarzt J. Hirschberg erklärte jüngst in einem Fachblatte, daß nach seinen Erfahrungen Kindergewehre, die nach alter Art mit Zündhütchen abgefeuert werden, ein wahres Danaergeschenk sind.
Er fordert die Aerzte auf, in Familien auf Abschaffung eines derartigen Spielzeugs zu dringen. Der erfahrene Arzt duldet nur Kindergewehre mit Remington-Verschluß, wo die Zündhutpatrone in geschlossener Kammer liegt, und Schießübungen der Knaben unter Aufsicht von Erwachsenen.
Diese Ratschläge sollten in den weitesten Kreisen bekannt und von den Eltern wie von den Fabrikanten befolgt werden! *
Winterfreuden. (Zu dem Bilde S. 881.) Der Künstler zeigt uns ein echt deutsches Bild: tiefer Schnee deckt die Giebel der kleinen Stadt, die Mauern, Hecken und Bäume; in den Häusern klagen die Alten über die harte Kälte, die kurzen Tage, den ganzen trübseligen Winter. Aber die Schulbuben sind anderer Meinung: frisch die Schlitten herunter und nun hinaus in den herrlich festen Schnee! Einer hinter dem andern sausen sie die steile Gartenstraße hinunter, freilich nicht ganz ungefährdet.
Denn hier wie anderwärts stehen die Stiefkinder des Glücks am Wegrande und suchen durch einen wohlgezielten Wurf das Ueberlegenheitsgefühl der andern etwas herabzustimmen. Schadet diesen nichts! . . so wenig als die vor Kälte schmerzenden Füße und die blaugefrornen Hände. Unermüdlich ziehen sie ihre Schlitten den Berg wieder hinauf, fechten zwischendurch einmal eine Schneeballenschlacht mit den Wegelagerern aus und lassen diese schließlich als großmütige Sieger mit aufsitzen. Erst bei sinkender Dunkelheit, fast steif vor Kälte und hundemüde kehren sie heim, ungerührt von den mütterlichen Klagen über verdorbene Kleider und nicht wieder zu trocknende Stiefel. Laßt sie ruhig fahren! So lange der Winter in Stadt und Land ein solches Bild darbietet, so lange hat es mit der vielbeschrienen „Entartung“ gute Wege! Der deutsche Schuljunge besteht aus solidem Stoff und läßt sich seine von Generationen her geerbten Lebensfreuden nicht verkürzen. Schön ist er gewöhnlich nicht, aber ein ganzer Kerl, und als solchen hat ihn der Künstler nach der Natur aufgefaßt und getreu vor unsere Augen gebracht. Bn.
Wecken und Erinnern mittels Elektricität. Damit ein in einem Gasthofe wohnender Gast in Bezug auf die Zeit, zu welcher er geweckt sein oder an irgend etwas erinnert werden will, nicht auf die Pünktlichkeit des Personales angewiesen sei, sollen nach dem Vorschlag eines Ingenieurs in den Fremdenzimmern der Gasthöfe elektrische Wecker aufgestellt werden, welche durch einen eigenartigen Stöpselapparat vom Gaste selbst mit einer Kontaktuhr so in Verbindung gesetzt werden können, daß der Wecker nur zu den beabsichtigten Zeiten, da aber bestimmt wirkt. Die Anlage kann so eingerichtet werden, daß sie zu beliebig vielen Zeitpunkten innerhalb 12 oder 24 Stunden zu wecken vermag. Aehnlichkeit mit dieser Vorrichtung hat der „Erinnerer“, welchen ein amerikanischer Elektriker ersonnen hat. Dieser „Erinnerer“ ist für Aemter, Läden, Fabriken, Gasthöfe etc. bestimmt und soll jedermann dagegen schützen, daß er eine Sache vergesse, welche zu einer bestimmten Zeit erledigt werden soll. Das Erinnern wird durch eine Klingel bewirkt, welche sich aber nicht neben dem Erinnerer zu befinden braucht, sondern auch an einem andern Orte aufgestellt werden kann. In industriellen Betrieben sind zu gewissen Zeiten des Tages oder der Nacht Arbeiten auszuführen, deren unpünktliche Verrichtung einen schädlichen Einfluß auf die zu erzeugenden Produkte hat. Man begreift, wie nützlich in solchen Fällen der Erinnerer werden kann. Er dürfte auch in meteorologischen Beobachtungsstationen am Platze sein, damit das Ablesen von Temperatur und Luftdruck, die Messung von Windstärke und Regenmenge etc. rechtzeitig erfolgt. F. K.
Auf Wiedersehen! (Zu unserer Kunstbeilage.) Sie schwenkt das weiße Tüchlein dem scheidenden Liebsten nach, dessen Barke aus dem kleinen venetianischen Kanal hinaus ins offene Meer steuert. Aber von Traurigkeit spürt sie offenbar nicht viel dabei, die schwarzäugige Luisella, die ihr Röckchen so kokett zusammenfaßt, weil da unten auf dem Kanal zu ihren Füßen noch mehr Leute vorbeifahren, die eine graziöse Stellung zu würdigen wissen. So blickt sie dem scheidenden Pietro wohlgemut nach, bis er um die Ecke biegt, und kehrt dann auf flinken Füßen in ihren alten verfallenen Palast zurück, aber nicht um dort einsam zu trauern, sondern um Mantille und Fächer zu holen und sich den Abschiedsschmerz durch eine kleine Plauderstunde mit den Freundinnen auf dem Markusplatz zu vertreiben, wo die Musik so schön spielt und die vielen Leute durcheinander wogen. Außerdem – der gute Pietro kommt ja in ein paar Monaten wieder! Wollen wir ihm wünschen, daß er dann sein so leicht getröstetes Bräutchen noch in treuer Liebe seiner harrend findet. Eine Wette darauf einzugehen, wäre allerdings sehr unvorsichtig gehandelt! Aber im schlimmsten Fall wird sich Pietro ebenfalls zu trösten wissen, und das ist das beste von der Sache!
Inhalt: Um fremde Schuld. Roman von W. Heimburg (Schluß). S. 877. – Das abziehende alte Jahr. Bild. S. 877. – Winterfreuden. Bild. S. 881. – Die Vorläufer unserer Neujahrskarten. Von Hans Boesch. S. 882. Mit Abbildungen S. 882, 883 und 884. – Das Bild des alten Malers. Erzählung von Ernst Lenbach. S. 884. Mit Abbildungen S. 885, 886, 887 und 890. – Die Schlußsteinlegung im neuen Reichstagshause. Bild. S. 888 und 889. – Gaunerzinken. S. 890. Mit Abbildung S. 891. – Blätter und Blüten: Die Schlußsteinlegung im neuen Reichstagshause. S. 891. (Zu dem Bilde S. 888 und 889.) – Das Brennen der Tannenzweige. S. 891. – Die Frau als Erfinderin. S. 892. – Kinderaugen und Kindergewehre. S. 892. – Winterfreuden. S. 892. (Zu dem Bilde S. 881.) – Wecken und Erinnern mittels Elektricität. S. 892. – Auf Wiedersehen! S. 892. (Zu unserer Kunstbeilage.)
Mit dieser Nummer, die wir unseren Lesern in Stadt und Land, in Heimat und Fremde mit frohem Neujahrsgruß ins Haus senden, gelangt wiederum ein Jahrgang der „Gartenlaube“ zum Abschluß und ein neuer – der dreiundvierzigsten – meldet seinen Beginn. Unsern Gruß an die Leser begleitet der herzlichste Dank! Auch in dem vergangenen Jahr hat die große „Gartenlaube“-Gemeinde ihrem Blatte die treue Anhänglichkeit bewahrt, welche der feste Grund ist, auf dem wir bauen. Und in gleicher Treue wollen auch wir die altbewährten Grundsätze festhalten, kraft deren das deutsche Volk in der „Gartenlaube“ ein Familienblatt besitzt, wie es an innerer Gediegenheit und echter Volkstümlichkeit keine andere Nation aufzuweisen vermag.
Wir werden auch ferner bestrebt sein, die „Gartenlaube“ zum Hort einer erfrischenden, fesselnden und durchaus gesunden Volks- und Familienlektüre zu machen und das Beste und Volkstümlichste, was unsere deutsche Unterhaltungslitteratur hervorbringt, unseren Lesern zu bieten. Es wird weiter unsere wichtigste Aufgabe bleiben, die Fortschritte der Wissenschaft und Technik auf allen Gebieten für die Volkswohlfahrt und das Vorwärtskommen jedes Tüchtigen, für das öffentliche und das Familienleben nutzbar und fruchtbar zu machen. Und drittens soll es auch weiterhin gelten, die idealen Errungenschaften unsres Geisteslebens zu verfolgen und zu verbreiten, sie dem allgemeinen Volksbewußtsein zu vermitteln und als unvergängliches Gut zu sichern. Auf dieser Verbindung idealer und praktischer Ziele beruhte von jeher die Beliebtheit der „Gartenlaube“ im deutschen Haus, ihre Bedeutung für das nationale Leben, wie ihre weltweite Verbreitung bis in die entlegensten Vorposten deutscher Bildung und deutscher Sitte.
Der neue Jahrgang wird neben gelungenen Schöpfungen neu auf dem Plan erschienener hochbegabter Schriftstelle wieder eine stattliche Reihe hervorragender Roman und Novellen unserer beliebtesten und gefeiertsten Erzähler und Erzählerinnen und damit eine Fülle anregendster Unterhaltung unseren Lesern bringen. Aus unserem reichen Schatze nennen wir nur folgende:
- Haus Beetzen. Von W. Heimburg. – Fata morgana. Von E. Werner. – Buen Retiro. Von M. Bernhard. – Loni. Von Anton von Perfall. – Sturm im Wasserglase. Von Stefanie Keyser. – Die Geschichten des Herrn Direktors. Von Ernst Lenbach. – Freiheit. Von A. v. Rlinckowström. – Die braune Marenz. Von Charlotte Niese. – Um eine Kleinigkeit. Von J. Torrund. – Der Fähnrich als Erzieher. Von Hans Arnold. –
Der Titel des Romans, welchen Ludwig Ganghofer gegenwärtig für die „Gartenlaube“ vollendet und der diesmal in der Gegenwart spielt, ist vom Verfasser noch nicht endgültig festgestellt worden.
Für Aufsätze belehrender Art dürfen wir uns gleichfalls des weiteren treuen Beistands unserer bewährtesten alten Mitarbeiter erfreuen, und wo der Tod schmerzlich empfundene Lücken gerissen, waren wir eifrig bemüht, aus dem jüngeren Geschlecht unserer Schriftsteller und Gelehrten frischen Ersatz zu gewinnen. Wie von jeher wird die „Gartenlaube“ durch populär-wissenschaftliche Artikel anerkannter medizinischer Autoritäten für die Erhaltung und Pflege der Gesundheit wirken. Die interessanten Artikelfolgen: „Tragödien und Komödien des Aberglaubens“, „Erfinderlose“, „Dunkle Gebiete der Menschheitsgeschichte“, „Erfindungen und Fortschritte der Neuzeit“ werden fortgesetzt; der hohe Zweck der Aufsätze „Unschuldig verurteilt“ wurde inzwischen erreicht. Ein neues Unternehmen dieser Art: „Vor der Berufswahl. Warnungen und Ratschläge für unsere Großen“ wird schon in einer der nächsten Nummern zu erscheinen beginnen und in seiner praktischen Tendenz gewiß in allen Familien, wo Kinder heranwachsen, freudig begrüßt werden.
Wird es somit auch weiterhin unsere Aufgabe sein, der „Gartenlaube“ ihren durch Jahrzehnte erworbenen Ruf einer guten und nützlichen Familien- und Volkslektüre zu erhalten, so werden wir anderseits weiter bemüht sein, ihren Charakter als illustriertes Blatt immer mehr zu vervollkommnen. wie uns die neue Umschlag-Beilage gestattet, im größeren Umfang als früher wichtigste Tagesereignisse und Zeiterscheinungen im Bild vorzuführen, so sollen unsere fein ausgeführten Textillustrationen, sowie unsere schwarzen und farbigen Kunstbeilagen vornehmlich dazu dienen, durch rein künstlerische Schöpfungen Sinn und Verständnis für echte Kunst zu verbreiten.
Eine Kunstbeilage musikalischer Art wird als besondere Ueberraschung den Lesern der „Gartenlaube“ im nächsten Heft geboten und auch denen, die nicht Klavier spielen, als Geschenk für musikalische Freunde willkommen sein. Dies ist der
Der Schöpfer unserer schönsten und volkstümlichsten Tanzmelodien, der Wiener Walzerkönig Johann Strauß, angeregt und gehoben durch die Sympathien, die ihm zur Zeit seines Jubiläums im letzten Herbst aus allen Kreisen des deutschen Volkes entgegengebracht wurden, hat diesen neuen Walzer, in dem die fröhliche Feststimmung jener Tage herzerfrischend nachklingt, eigens für die „Gartenlaube“ komponiert, damit sie seiner heiteren Schöpfung allerorts den Weg in das musikliebende deutsche Haus vermittele.
Und so schließen wir den nunmehr vollendeten Jahrgang mit der frohen Zuversicht, daß auch dem neuen die Treue und Anhänglichkeit unserer Leser bewahrt bleiben, daß überall freundlichen Widerhall finden werde unser Gruß
Leipzig, im Dezember 1894. Die Redaktion der „Gartenlaube“.
Ob auch der Türmer es verträumt
Und Winternacht herrscht weit und breit,
Das neue Jahr naht ungesäumt
In jugendschöner Herrlichkeit.
Frohlockend schwärmen ihm voran
Der Freude Genien, leicht beschwingt,
Und sorgen, daß auf seiner Bahn
Der Glocke Jubelgruß erklingt.
Ein Glanz von reiner Zuversicht
Strahlt auf der Stirn dem neuen Jahr,
Ein froh Verheißen leuchtend bricht
Aus seinen Augen, hell und klar.
Der Hoffnung Blütenkeime weckt
Sein warmer Blick, wohin er fällt –
Es ist kein Winkel so versteckt,
Drin es nicht seinen Einzug hält.
Drum, Seele, öffne freudig Dich
Dem Segensgruß, der Dich beglückt,
Ob Deine Jugend auch entwich
Und Gram und Sorge Dich bedrückt.
Entreiß’ dem Kummer Deinen Sinn
Nun froh das neue Jahr Dir naht –
Und neues Glück ist Dein Gewinn
Und neuer Wunsch und neue That!
Johannes Proelß.