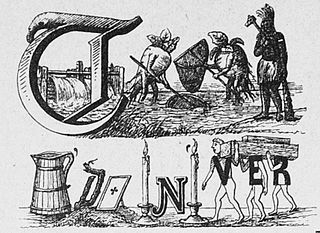Die Gartenlaube (1892)/Heft 27
[841]
| Halbheft 27. | 1892. | |
Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Jahrgang 1892. Erscheint in Halbheften à 25 Pf. alle 12–14 Tage, in Heften à 50 Pf. alle 3–4 Wochen vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Festen Schrittes ging Julia, nachdem sie das Zimmer des Doktors
verlassen, aus dem Hause, durch den Garten. Athemlos langte
sie in der Villa drüben an und fragte nach ihrem Bruder. Er war
zu Hause; sie fand ihn auf dem Sofa, Cigaretten rauchend und
lesend. Er erschrak vor dem bleichen drohenden Mädchengesicht.
„Was ist denn los?“ fuhr er auf.
„Du wirst Deinen Koffer packen und sogleich abreisen,“ sagte sie, sich gewaltsam zur Ruhe zwingend.
„Weshalb denn?“
„Weil Du nicht länger einen anständigen Menschen betrügen sollst. Ich weiß alles! Du hast mit Therese ein Stelldichein gehabt – man hat Dich gesehen!“
Er machte ein erstauntes Gesicht, aber seine Blässe bestätigte vollauf, daß dem so sei. „Der Teufel auch, was ist denn da weiter?“ brummte er ärgerlich. „Uebrigens – wer hat mich denn gesehen?“
„Fritz!“
Er lachte kurz auf. „Na, dann kommt’s eben schon jetzt
[842] zum Klappen. Woher weiß übrigens der Doktor, daß es Therese war?“
„Er weiß es nicht.“
„Na, was lamentierst Du dann so?“
Sie blickte ihn entsetzt an. „Fritz glaubt, ich sei da gewesen mit einem –“ Die Stimme versagte ihr.
„Ach, das ist ja köstlich! Du hast ihn hoffentlich bei dem Verdacht gelassen?“
„Ja!“ sagte sie bebend, „weil er es nicht überleben würde, daß Therese sich so schamlos benimmt.“
Frieder richtete sich in seiner ganzen Größe auf. „Schamlos? Nein, mein liebes Kind, diese Angelegenheit verstehst Du nicht, deshalb erlaube Dir auch kein Urtheil! Es ist viel von Dir, die Schuld auf Dich zu nehmen, ich bin Dir dankbar dafür und werde Dir diesen klugen Streich nie vergessen – Therese aber verschone mit Deiner Kritik! Sie kam auf meine Bitte in das Gartenhaus, damit wir endlich ungestort besprechen konnten, wie unsere Zukunft sich gestalten soll; sie liebt mich und beabsichtigt, sich von Fritz zu trennen – voilá tout!“
„Sie liebt Dich?“ fragte das Mädchen, vor deren Augen wirre Schatten tanzten, „das ist nicht wahr, das kann sie nicht gesagt haben, und wenn, so hat sie sich’s nur eingeredet. Du mußt fort, Frieder, heute noch, wenn Du ein Ehrenmann bist! Ich schicke Dir Deine Sachen nach. Therese wird zur Besinnung kommen, ich weiß es – – aber so mach’ doch Anstalten, es eilt!“ Und sie holte in fieberhafter Hast seinen Hut und Ueberzieher.
„Rege Dich nur nicht auf,“ sagte er gelassen, „es geht alles seinen richtigen Weg. Ich reise, wenn es Zeit ist und die Verhältnisse sich geklärt haben.“
„‚Seinen richtigen Weg‘ nennst Du das?“ rief sie und trat vor ihn mit sprühenden Augen. „Ist das recht, dem besten edelsten Menschen sein Glück abwendig zu machen?“
„Es ist die Vergeltung!“ antwortete er und drehte sich eine neue Cigarette. „Er hat mir die Braut abwendig gemacht; wie er es fertig gebracht, weiß ich nicht, jedenfalls aber unter der Maske des Biedermanns, die ihn trefflich kleidet. Uebrigens ist die Vergeltung ohne mein Zuthun gekommen – Therese hat mir gestanden, in ihr sei beim ersten Wiedersehen die alte Liebe erwacht.“
Julia wandte sich mit einer stummen Gebärde des Abscheus zum Gehen; sie fühlte sich zum Sterben elend.
„Wo willst Du denn hin?“ rief er ihr nach. „Ich rathe Dir, mache keine Thorheiten, sonst –“
Sie gab keine Antwort. Ihre Absicht war mißglückt, nun gab es nur noch einen Weg – Therese! Aber wie sie oben vor der Thür des Boudoirs stand, hörte sie die Stimme des Doktors, der sich besorgt nach dem Ergehen der Frau erkundigte, die ihn verrathen. Julia biß die Zähne zusammen und stieg wieder hinunter.
In ihrer Herzensangst wollte sie zur Räthin gehen, aber dann hatte sie doch soviel Besinnung, sich zu sagen, daß diese Frau das ganze Haus sofort in Aufruhr bringen würde, ja daß keine Möglichkeit mehr sei, das geschehene Unrecht gut zu machen, daß sein Glück doch verloren sei für immer. Und dennoch, es mußte etwas geschehen! Auf einmal fiel ihr der alte Krautner ein, und sie lief zur Hausthür.
„Wohin, wohin?“ erscholl da die Stimme der Räthin hinter ihr. „Bei uns ist Nachtwandeln nicht Mode, mein Fräulein! Die Mädchen aus unserem Hause bleiben abends ehrbar in der Stube.“ Und an ihr vorüber gehend, schloß die Räthin die Thür ab und steckte mit geflissentlicher Deutlichkeit den Schlüssel in die Tasche.
Nun wußte Julia, daß die alte Frau gehorcht hatte, daß noch heute abend die Mädchen in der Küche die willkommene Neuigkeit mit allen möglichen Ausschmückungen sich zuflüstern würden. Sie hätte aufschreien mögen vor Zorn und Weh. In diesem Augenblick kam der Doktor von oben herunter. Er schritt nach seinem Arbeitszimmer und wandte den Kopf nicht nach ihr, als er sagte. „Ich bitte, daß meine Frau heute abend nicht mehr gestört wird.“
Sie sah ihm stumm nach, dann ging sie in ihre Schlafstube; es war ihr nicht möglich, Tante Riekchen „Gute Nacht“ zu wünschen, nicht möglich, das Lager aufzusuchen. Ihr war, als müßten die engen Wände sie erdrücken, die Luft schien ihr unerträglich heiß. Mit nervöser Hast riß sie das Fenster auf. Dann begann sie im Zimmer auf und ab zu schreiten, ruhelos, mit gerungenen Händen. Von Zeit zu Zeit fuhr sie mechanisch über die schmerzende Stirn, auf der fencht das kurze Haar lag. Es war längst Mitternacht vorbei, als sie das stumme Wandern endlich aufgab.
Sie trug einen Stuhl an ihre Kommode und zog die oberste Lade heraus. Dort lagen sie alle wohlgeordnet, die kleinen Schätze ihrer freudenarmen Jugend. Gedankenlos nahm sie dies oder jenes Pappkästchen in die Hand und musterte den Inhalt. Da waren die geliebten verbotenen Ohrringe, da war die Nadel der Mutter, der kleine Dolch mit dem Mosaikgriff; dort ein paar Gedichtbücher, die hatte ihr Fritz geschenkt zur Konfirmation, endlich ein Buch mit leeren Blättern, das auf braunem Lederdeckel den goldgepreßten Titel „Tagebuch“ zeigte.
Es war eine Weihnachtsgabe Theresens gewesen, eines jener Geschenke, die gedankenlos ausgesucht und nur gegeben werden, weil doch nun einmal etwas geschenkt werden muß; sie hatte es am ersten Feiertag mit den übrigen mehr oder weniger nutzlosen Gaben in die Kommode gelegt, nicht ohne es vorher mit bitterem Lächeln zu betrachten. Was sollten ihr die Blätter, die so leer bleiben würden wie ihr Leben! Was hatte sie aufzuschreiben! Und dann hatte sie doch einmal die Feder eingetaucht und mit der großen kräftigen Schrift, die ihr eigen war, ein paar Worte hineingeschrieben:
„Wie meine Tage vergehen?
Ich will es künden Euch gleich –
Es macht mich kein einziger ärmer,
Und auch kein einziger reich!
Und wißt Ihr, warum ich so trübe,
Warum ich so trotzig mag sein?
Ich hatte viel Durst nach Liebe,
Und niemand schenkte mir ein.
Wohl sah ich im Glase blinken
Des Lebens goldigen Wein,
Sah alle die andern trinken –
Mich aber lud keiner ein.
Nur einmal hat es geschienen,
Als käm’ urplötzlich das Glück –
Es bot mir einer den Becher,
Den vollen, mit freudigem Blick.
Und zaub’risch spielten die Farben
Wohl auf des Kelches Grund –
Fassen wollt’ ich ihn, heben
Und trinken mein Herze gesund.
Doch wie ich mich beugte, zu nippen,
Da brach das Glas in Stück’ –
Und durstig blieben die Lippen
Und ferne blieb das Glück.
Das ist’s, warum ich so träbe,
Warum ich so trotzig mag sein;
Ich wollte nicht Mitleid für Liebe –
Nun bin ich ewig allein!“
Sie lächelte über das Gedicht, aber fast mitleidig, und wunderte sich, daß sie einmal etwas Gereimtes zustande gebracht hatte. Dann kam ihr der Gedanke, wie sie sich schämen müsse, wenn jemals eines anderen Menschen Auge das lese, und ihre Finger zuckten, das Blatt aus dem Buche zu reißen, es zu vernichten. Aber sie ließ die Hand doch wieder sinken – ein Gedanke packte sie, den sie vergebens abzuwehren trachtete. Warum denn, warum wollte sie durchaus das Opferlamm, den Friedensengel spielen? Warum jene Frau zwingen, ihrer Treue eingedenk zu bleiben? Was ging es sie an, wenn Therese sich von ihm trennte, um einem anderen anzugehören? Wurde er dann nicht frei? Und er würde den Schlag überwinden, gewiß! Ein Mann wie er stirbt nicht, wenn er etwas verliert, das ohnehin werthlos für ihn sein mußte. Und selbst wenn er nie von der Treulosigkeit seiner Frau erführe – was konnte ihm fernerhin eine Frau sein, die erst zurückgeführt werden mußte zu ihrer Pflicht, gewaltsam zurückgeführt? Eine glückliche Ehe konnte das nie wieder werden, nie! Er hätte der feinfühlige Mensch nicht sein müssen, der er war, um nicht zu empfinden, daß ein nur mühsam zusammengeflicktes Pflichtgefühl die Frau an seiner Seite hielt! War es also das Schlechteste für ihn, wenn er schonungslos jetzt erkannte, daß er betrogen sei? Hatte sie denn überhaupt das Recht, ihm die Wahrheit zu verschweigen? Die Sorge, ihn vor dem Verlust des Liebsten zu bewahren, Mitleid, Erbarmen, das für sich selbst nichts mehr will, nichts mehr sucht – das alles war heute auf sie eingestürmt, als sie das Tuch für ihr Eigenthum erklärt hatte. Aber war sie dabei nicht eine Thörin gewesen, das Opfer einer überspannten Anwandlung?
Ihr Herz bäumte sich auf gegen die Trostlosigkeit der Zukunft, die nun noch öder, einsamer für sie werden mußte – es raunte ihr allerhand süße hoffnungsselige Träume ins Ohr. Frei würde er sein, ihr würde er eines Tages gehören, und bei Gott, sie wollte ihm die Hände unter die Füße breiten, ihn alles vergessen machen, ihm alles verzeihen und sein Kind, das –
Ach, das Kind!
[843] Das Kind sollte seine Mutter verlieren?
Und was für eine Mutter! sagte das rebellische Herz.
Aber sie war doch seine Mutter, und so ganz verkümmert konnte Theresens Seele doch nicht sein, daß sie nicht einst um des Sohnes willen die Stunde segnen würde, in der sie ihrem Lieblingstraum entsagt hatte, um bei dem Gatten zu bleiben. –
Und Julia hob den Kopf, und die heißen trockenen Augen sahen entschlossen in dem kleinen Raume umher.
Was wird aus Dir? fragte die verlockende Stimme.
Sie wußte es nicht. Sie hatte schon so vieles ertragen, warum nicht auch das noch, daß man sie für eine leichtsinnige, ehrvergessene Person hielt? – Doch nein, das würde sie nicht ertragen, seine Verachtung nie! Es wäre am besten, wenn sie sterben würde! In diesem Falle wäre es doch keine Feigheit, gewiß nicht!
O, das schöne Leben, die goldene Jugend! Wieviele Jahre lagen noch vor ihr, und wenn sie hinausginge, auf freien Füßen, irgendwo in der Welt mußte sie doch einen Platz finden, wo es Ruhe für sie gab, wo sie athmen konnte und die Sonne sehen und die schöne, schöne Welt!
Da – was war das? Droben über ihrem Zimmer wurde eine Thür heftig zugeschlagen, und nun war deutlich die weinende Stimme Theresens vernehmbar. Jetzt wohlbekannte Tritte durch den Flur herunter, das Knarren einer Thür – Fritz war in seine Studierstube gegangen. Was mochte das bedeuten? Sollte Therese – – Julias Glieder waren plötzlich schwer wie Blei; sie stand unbeweglich und lauschte. Das Schluchzen droben ward immer heftiger, jetzt unterschied sie auch die Stimme der alten Kinderfrau.
Julia war auf einmal entschlossen, wandte sich kurz um und ging hinauf. Im ganzen Hause war tiefe nächtliche Stille. Die Lampe im Flur brannte, sie wurde immer erst des Morgens ausgelöscht; Fritz wünschte dies so, für den Fall, daß er nachts zu einem Kranken gerufen würde. Julia stieg die Treppe empor; auf der obersten Stufe saß die schwarze Hauskatze und blinzelte sie verschlafen an; die alte Dielenuhr schlug drei Uhr, als Julia vorüberging.
Die Schmerzenslaute Theresens klangen jetzt ganz deutlich heraus, unangenehm wie die eines verwöhnten Kindes, das seinen Willen nicht durchsetzen kann. Julia nahm ihren Weg durch die Kinderstube. Im Schimmer der Nachtlampe sah sie das goldige Köpfchen des kleinen schlummernden Buben in den weißen Kissen und das leere Bett seiner Wärterin. Die Thür nach dem Schlafzimmer Theresens stand angelehnt, und die Stimme der alten Frau sagte gerade: „Aber, Frau Doktor, so beruhigen Sie sich doch nur und trinken Sie das Wasser! Was nutzt denn so ein Weinen? Sie werden sich nur krank machen.“
Julia ging ohne weiteres hinein. „Was ist Dir denn Therese?“ fragte sie, an das Bett der jungen Frau tretend, die ganz aufgelöst in Thränen schien und wie eine Verzweifelnde die Hände rang.
„Na, Gott sei Dank, Fräulein, daß Sie kommen!“ brummte jetzt die alte Frau, setzte das Zuckerwasser auf die Platte des Betttischchens und verschwand in ihrer Kinderstube.
Therese war emporgefahren und starrte Julia an.
„Ich hörte Dein Weinen unten,“ sagte diese, indem sie vorsichtig die Thür hinter der Alten schloß. „Was ist Dir? Bist Du krank?“
„Nein, aber ich werd’s schon werden nach dieser Behandlung!“ stieß Therese hervor und zupfte an den Spitzen, mit denen die blaue seidene Bettdecke besetzt war.
„Wer hat Dich denn so schlecht behandelt?“
„Wer? Lächerlich! Fritz natürlich! Wenn man sich nicht alles gefallen läßt, so ist man eben ungezogen, kindisch! Und ich habe weiter nichts gesagt als das: Warum er so ewig lange zu schreiben habe – er kam wieder einmal erst vor einer halben Stunde. Und da“ – sie begann wieder zu schluchzen – „da gab ein Wort das andere, und da hab’ ich schließlich gesagt – –-“
Die junge Frau verstummte und ein trotziger entschlossener Ausdruck erschien auf ihrem Gesicht.
„Da hast Du gesagt,“ sprach Julia sehr langsam, „es wäre das Beste, Du würdest Dich von ihm trennen und den Lieutenant Adami heirathen.“
Therese sah die Sprecherin an, als stände ein entsetzliches Gespenst vor ihrem Lager. „Was willst Du damit sagen?“ stieß sie hervor.
„Nichts weiter als das, was Du seit heute nachmittag bestimmt weißt und worauf Du schon seit Wochen hinarbeitest. Nur fängst Du das jammervoll kleinlich an,“ fuhr sie fort. „Mit solch erbärmlichen Plänkeleien den Mann, der Dich mit seiner ganzen Seele liebt, soweit bringen zu wollen, daß er in eine Scheidung willigt, ist grausam, sinnlos. Hast Du nicht den Muth, es ihm ruhig zu sagen? Du hattest doch den Muth, mit Frieder bereits alles zu bereden!“
Therese war wie ohnmächtig zurückgesunken. „Wer hat Dir das verrathen?“
„Der Zufall – und Frieder bestätigte es.“
Es war jetzt ganz still im Zimmer. Julias Augen irrten durch das trauliche Gemach; dann heftete sie ihren Blick wieder auf die Frau, die unbeweglich dalag und sie mit angstvollen verstörten Augen anstarrte.
„Willst Du mich anhören?“ fragte Julia, ohne ihre Stellung am Fuße des Bettes zu verlassen; sie stützte nur leicht ihren Arm gegen den dunklen Nußbaumknauf. „Ich möchte Dich bitten Therese – –“
„Mach’ mir keine Vorwürfe,“ unterbrach die junge Frau sie heftig, „ich kann nichts dafür, daß ich den Frieder liebe – Du verstehst das freilich nicht – Du nicht.“
„Ich verstehe es nicht, nein! Das heißt, ich verstand es einst, daß Du den Frieder liebtest – –“
„Ihr habt ja alle nicht gewollt, daß ich ihn heirathen sollte,“ murmelte sie.
„Das ist nicht wahr!“ antwortete Julia fest.
„Nicht wahr? Mein Vater drohte mir sogar mit Enterbung, und Du – weigertest Dich, mir zu helfen.“
„Ehrliche, standhafte Neigung hätte Deinen Vater bezwungen – –“
„Lächerlich! Du hast gut reden – aber jung wie ich damals war . . .“
„Das ist keine Entschuldigung für Dein Verhalten. Und jedenfalls – Du hast den Fritz genommen und wirst ihn auch behalten, Therese.“
„Nein! Ich kann nicht, ich liebe ihn nicht mehr! Ich bitte Dich, verlasse mich! Du hast nie ein Herz für mich gehabt und fühlst nicht mit mir, willst es nicht! Geh’, bitte, geh’!“
„Nicht eher, als bis Du mir versprichst, an Frieder zu schreiben, daß er sofort abreise!“
„Nein! Nein!“
„Aber kannst Du denn überhaupt einen Athemzug thun in der zweifelhaften Stellung, in der Du Dich befindest?“ rief Julia außer sich. „Also entweder schreibst Du jetzt an Frieder und machst dieser Thorheit für immer ein Ende – oder aber Du sagst Fritz morgen alles wahr und offen!“
„Niemals – ich fürchte mich!“ stieß Therese hervor, und die Zähne schlugen ihr zusammen.
„Dann werde ich zu Deinem Vater gehen.“
„Das wirst Du nicht thun! Was geht Dich die Sache an? Mit welchem Rechte spielst Du Dich als Sittenrichterin über mich auf, Du, die Du selbst nicht besser bist!“
Julia sah die junge Frau hilflos an. „Ich?“ sagte sie.
„Ja, Du! Oder denkst Du, ich weiß nicht, daß Du Fritz leidenschaftlich liebst? Daß Du ihn mir nie gegönnt hast?“
Eine fahle Blässe legte sich auf Julias Gesicht.
Wieder eine Pause. Aus dem Nebenzimwer tönte das weinerliche Stimmchen des Kleinen herüber.
„Therese,“ sagte Julia, und herzustürzend kniete sie am Bette nieder. „Hör’ doch – an Dein Kind hast Du nicht gedacht, an Dein Kind, das Ihr beide liebt!“
Da warf sich die junge Frau ungestüm zur Seite. „O, ich wollte, es wäre nie geboren!“ schrie sie auf.
„Du versündigst Dich, Therese –“
„Es mag sein; es mag auch sein, daß ich schlecht bin, aber ich kann, ich will nicht anders.“
„Und Dein alter Vater?“
„Mein Vater?“ Und Therese lachte höhnisch auf. „Mein Vater, der ist verliebter in Deinen Bruder als ich – hast Du das noch nicht bemerkt?“
„Ja, er hat ihn gern; aber wüßte er, daß er einem Betrüger Gastfreundschaft gewährt –“
„Einem Betrüger? Wir betrügen keinen! Wenn Fritz nicht so grenzenlos von sich eingenommen wäre – seit Monaten hätte er es merken müssen, daß ich ihn nicht mehr liebe.“
Julia rang nach Fassung. „Noch einmal, Therese, willst Du Frieder schreiben, daß er reise?“
[844]

A. Achenbach. C. Jutz. J. Leisten. M. Volkhart. A. Frenz. F. Montau. F. Schnitzler. O. Erdmann.
E. Hünten. B. Vautier. G. Oeder. O. Achenbach. A. Baur. Chr. Kröner. F. Brütt. J. Gehrts. F. Vezin. A. Lins.
F. Sonderland. C. Gehrts. Th. Rocholl.
Festbowle im „Malkasten“ zu Düsseldorf.
Originalzeichnung von H. Otto.
[845] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [846] „Nein, kein Wort! Und als Mann von Ehre würde er auch gar nicht gehen. Glaubst Du, daß er mich jetzt in dieser Lage allein läßt? Die Bitte wäre vergebens. – Aber sei beruhigt; ich kehre in das Haus meines Vaters zurück, und alles wird sich in Frieden ordnen lassen – nur quäle mich jetzt nicht länger! Uebrigens,“ setzte sie hinzu, „die Sache muß bald ihren Abschluß finden, damit es sich entscheiden kann, ob Frieder wieder Soldat wird oder ob wir auf Reisen gehen, je nachdem – –“
„So will ich morgen früh noch einmal zu Frieder hinüber,“ unterbrach Julia. „Ein Funke von Besonnenheit wird ja noch in ihm sein und von Rücksicht auf das Haus, dessen Gastfreundschaft er genießt.“
Therese zuckte die Schultern und lehnte sich in die Kissen zurück. An der Thür zögerte Julia und blickte noch einmal hinüber zu der verblendeten Frau, aber die hielt die verweinten Augen fest geschlossen, und die Hände lagen zur Faust geballt auf der Decke. Da schloß sie wortlos die Thür.
„O, Du armer Bub’!“ flüsterte das Mädchen, im Kinderzimmer über das Bett des Knaben gebeugt, und aus den Kissen heraus schluchzte die Wärterin. „Ach, Fräuleinchen, wenn eines so muthwillig sein Glück zerschlagen will – – Sie glauben’s nicht, was der Herr die Zeit her ausgestanden und welche Engelsgeduld er gehabt hat mit der Frau.“
„Sie ist krank, Doris, es wird wohl wieder anders!“
„Ja, ja – wenn sie ihren Willen kriegt, sonst nicht!“ –
Julia ging hinunter in ihr Zimmer, aber sie wußte nicht, was beginnen. Schlafen? Ihre Nerven waren überreizt, sie hätte es nicht vermocht. Sie begann Toilette zu machen; das kühle Wasser that ihren heißen Wangen gut, die noch brannten von der Unterredung mit Therese. Wie gräßlich war diese Welt! An was konnte man denn noch glauben, wenn nicht mehr an die Treue der Frau, an die Liebe der Mutter?
Sie war ans Fenster getreten und schaute über die Gärten weg, die im Nebel lagen. Nichts vom Strome und von der Aue war zu sehen, nur ein bläuliches Dunstmeer, das alles verbarg. Was würde der Tag heute bringen? Noch lag er verschleiert. Aber wenn der Abend sinkt – wer weiß, wie anders es dann hier ist. –
Im Studierzimmer saß bei der erlöschenden Lampe, deren gelblichrother Schein sich mit dem fahlen Morgenlicht mischte, der Doktor, vor sich die Hefte, darin er geschrieben, die Feder noch in der Hand.
Er dachte an ganz anderes als an die wissenschaftliche Frage, über die er vorhin geschrieben hatte und über die er auf dem nächsten ärztlichen Kongreß reden wollte. Was war mit Therese vorgegangen? Das war kein Eigensinn und keine Laune mehr, das war ein ernstliches Nervenleiden, und baldige Abhilfe that noth! – Wo war sein goldenes Glück geblieben? Die reizenden Stunden droben in ihrem kleinen Boudoir, die jauchzende Freude von Mutter und Kind, daran er sich nicht satt sehen konnte? Er grübelte. Wann hatte er nur die ersten Anzeichen ihrer veränderten Stimmung bemerkt? Und dann tauchte ein blasses schönes Antlitz vor seinem Auge auf, ein paar blitzender dunkler Augen – Julia. Er schüttelt unmuthig den Kopf und greift zur Feder, ein Gemisch von Verachtung und schmerzlichem Mitleid überkommt ihn.
Wohin mit ihr?
Läßt man sie hier? Aber man weiß ja nicht, welcher Art ihre Beziehungen sind – wer soll sie hüten? Die alte gelähmte Tante? Die strenge, dem Mädchen gegenüber allzustrenge Mutter?
Ja, das kommt davon – sie ist nicht besser als ein Dienstmädchen gehalten worden; sie hat keinerlei Vergnügen beanspruchen dürfen wie andere junge Mädchen ihres Alters, nun rächt sich’s. Und doch – es kann ja nicht möglich sein! Ihre Züge können so nicht täuschen!
„Ach, was hat man für Noth mit dem Weibervolk!“ sagte er laut, als wollte er versuchen, sich mit einem Scherz aus seinen trübseligen Gedanken zu reißen. „Die eine krank, die andere – noch schlimmer!“
Und er erhob sich mit den schweren Gliedern eines Menschen, der die Nacht anstatt im Bett auf einem Stuhle verbracht hat, schob die Papiere zusammen und schickte sich an, hinaufzugehen.
Im Flure stand seine Mutter mit verärgertem Gesicht, das graue Morgenkleid flüchtig zugeknöpft, die Haube mit den lila Bändern schief auf dem lässig gekämmten Haare.
„Nun ist’s aber doch an der Zeit, Fritz, daß Du mit Julias Vormund redest, und wenn Du es nicht thust, werde ich hingehen. Heute früh, wie die Mädchen aufstehen, ist die Hausthür nach dem Garten unverschlossen und das Zimmer von Fräulein Julia leer. Haältst Du sie abends fest, so läuft sie des Morgens davon – ums Himmelswillen, wer hätte das gedacht!“
Er sah traurig überrascht aus. Da erblickte er in der Hand der Mutter zusammengeknüllt das unselige Tuch von gestern.
Sie bemerkte seinen fragenden Blick. „Das hab’ ich eben aufgehoben, dort an der Treppe hat’s gelegen,“ fuhr sie empört fort. „So geht die Julia mit den Sachen um. Und wenn’s noch ihr Tuch wär’, aber das hatte ihr die Therese geborgt aus Gnad’ und Barmherzigkeit, und –“
„Das Tuch gehört Therese?“ fragte er.
„Ja wohl!“ ertönte von oben die Stimme der Jungfer Theresens, und die robuste Blondine kam die Treppe herunter und streckte die Hand nach dem Tuch aus. „Frau Doktor haben’s gestern abend schon vermißt und haben gesagt, ich sollt’ es suchen.“
„Das Tuch gehört meiner Frau?“
„Ja, Herr Doktor, das Fräulein hat’s nur einmal an dem Abend getragen, als der Herr Lieutenant in der ‚Traube‘ geredet hat. Am andern Tage hat sie’s schon wiedergebracht, und nun –“
„Wann hat meine Frau das Tuch verloren?“ Die Stimme des Mannes klang so tonlos, daß die alte Dame ihn verwundert ansah.
„Ich weiß nicht,“ berichtete das Mädchen; „aber ich meine, gestern abend hat’s die gnädige Frau noch umgehabt, als sie in den Garten gegangen ist.“
„Es ist gut, ich selbst will das Tuch meiner Frau geben.“
Er nahm es und that ein paar Schritte der Treppe zu, drehte sich dann unschlüssig wieder um und endlich stieg er doch hinauf. Der Räthin war es, als strauchle er, und sie sah, wie er tastend nach dem Geländer griff.
Therese lag noch im Bett; das Zimmer roch nach Eau de Cologne und Aether. Mit schweren Schritten kam Fritz herein, ging zum Fenster und riß die Vorhänge auseinander, daß das Tageslicht hereinströmte. Und nun wandte er sich zu der jungen Frau, und seine Hand hielt ihr das Tuch entgegen, aber sie zitterte, diese Hand.
„Ist dies Dein Tuch. Therese?“
„Weshalb denn?“ fragte sie. „Warum?“
„Ist dies Dein Tuch, Therese?“
„Ja!“
„Und seit wann vermißt Du es?“
Sie zuckte die Achseln. „Ich glaube, seit gestern,“ antwortete sie gleichgültig. Dann erweiterten sich ihre Augen schreckhaft. „Um Gotteswillen, Fritz!“ stieß sie hervor – das war der Blick, der ihr schon einmal ein Grauen eingejagt hatte!
„Besinne Dich,“ sagte er, „Du wirst mir nachher genau erzählen, wo Du das Tuch verloren hast. Ich komme wieder, wenn ich ruhiger geworden bin.“
Und das Tuch auf einen Tisch schleudernd, verließ er das Zimmer. Drunten im Flure suchte er nach Stock und Hut, und dann schritt er durch die Gassen auf die Landstraße hinaus. Rechts bog ein Feldweg ab, von kahlen Obstbäumen umsäumt; in diesen lenkte er ein. Er riß im Gehen den Hut vom Kopfe und ließ sich den Februarwind um die Stirn wehen, immer weiter wandernd – immer weiter. Und vor seinen Augen flatterte es wie ein weißes goldumsäumtes Tuch, vor seinen Augen stand der Platz, an dem er es gefunden – das kleine halbfinstere Gemach mit dem altmodischen Sofa, so weltentrückt, so heimlich wie möglich. und da, vor dem Sofa, hatte das Tuch gelegen! Und nun kamen sie, die Erinnerungen, und schlangen Glied um Glied zu einer unheilvollen Kette.
War er denn blind und taub gewesen? Alles, alles fiel ihm ein. Da war er einmal rasch in das Eßzimmer getreten, und da hatte sich der Frieder just mit möglichster Gelassenheit von seinen Knien erhoben und gesagt, er könne das Zwirnknäuel nicht finden .... ja, ja, der Frieder – der Frieder!
Der Doktor war wie ein Toller gelaufen; er stand plötzlich am Eingang eines kleinen Dorfes, in dem er eine Schwerkranke hatte. – Mochte sie sterben und verderben! –
Er wandte wieder um. Da rannte ihm ein Kind nach, ein Bübchen mit blondem Haar und blauen Augen. „Herr Doktor, [847] Du sollst doch hereinkommen zur Mutter,“ bat es, ihn am Rock fassend. Und der Mann starrte das Kind an und ging hinter ihm her in das kleine Haus. Er hatte an seinen Buben denken müssen.
Als er wieder hinaustrat, schlug er den kürzesten Weg nach Hause ein. Das Kind! Ja freilich, das arme Kind! Und es stieg ihm feucht in den Augen auf.
Er befand sich in kürzester Frist wieder in der Stadt, und wäre er nicht von seinen eigenen Gedanken so hingenommen gewesen, er würde bemerkt haben, daß ihn die Leute groß anstarrten und daß die Frauen in den kleinen Bürgerhäusern klirrend die Fenster hinter ihm aufrissen. – Aus einem Fischerhause am Rhein trat ein alter Mann heraus. Er triefte vor Nässe und sein weißes Haar war ohne Bedeckung. Als er des Doktors ansichtig ward, stand er erst verlegen still, dann kam er näher.
„Herr Doktor,“ sagte er stockend, „ich glaube, daheim werden Sie erwartet.“
„Ich? Bei mir zu Hause?“
„Ja, Herr Doktor; man hat Sie überall gesucht, weil – aber erschrecken Sie nicht, Herr Doktor, ich mein’, es ist eines von Ihren Leuten krank geworden.“
Der Doktor griff mechanisch an den Hut und eilte heimwärts, eine tödliche Angst im Herzen. Da hörte er, wie eine alte Frau sagte. „O Gott! Ich möchte der auch nicht sein, der ihm das verkünden muß!“ – Was war geschehen? Hatte Therese . . .?
In wenigen Sekunden hatte er sein Haus erreicht. Wohin sich wenden? Von der Hinterthüre her zogen sich nasse Spuren über die Treppe in den ersten Stock. Also droben . . .
An der Mündung der Treppe stand sein Schwiegervater. Der alte Mann faßte krampfhaft den Arm des Heraufstürmenden. Man sah, er wollte sprechen, aber er konnte nicht; die Thränen rannen ihm über die Wangen. „Im Salon,“ stieß er endlich hervor und winkte mit der Hand. „Geh’ nicht zu hart mit ihr ins Gericht, sie ist gräßlich bestraft.“
Inmitten des reichen, blau dekorierten Gemaches hatte man das Bett des Kindes hingestellt, daneben einen Tisch mit Kissen und Tüchern. Der Mann schwankte plötzlich und stützte sich stöhnend auf das Gitter des Bettchens.
„Du bist es?“ schrie er auf und riß den kleinen starren Körper empor, „Du – Du mußt es sein?“
Auf der anderen Seite des Bettes, die Hände in das halb aufgelöste Haar gekrallt, lag eine bebende schluchzende Frau. „Fritz, vergieb, vergieb!“
Er sah sie nicht an, noch immer hielt er das Kind im Arme, mit bleichem Gesicht nach einem Lebenszeichen suchend. Umsonst! Das kleine Herz hatte für immer aufgehört, zu schlagen!
Stumm legte er den Toten auf das Lager zurück, raffte ein Tuch vom Dache, deckte es über das stumme kalte Gesichtchen und verließ das Zimmer. Hinter ihm blieb es ganz still.
Drunten schloß er sich in seine Studierstube ein und warf sich dann mit einem dumpfen Stöhnen auf das Sofa. Stundenlang lag er so, ohne sich zu rühren, ohne zu denken, ohne sich auch nur zu fragen, wie das Entsetzliche habe geschehen können. Man pochte an die Thüre – er gab keine Antwort.
Endlich am späten Abend kam seine Mutter und rief mit zitternder Stimme: „Fritz, Fritz – komm zu Julia, sie braucht Deine Hilfe!“
Die alte Frau fuhr förmlich zurück, als ihr Sohn öffnete und sie die Verstörung in seinem Gesicht sah. „Gott im Himmel, Fritz,“ schluchzte sie, „Fritz, nimm Deinen Verstand zusammen, denke doch an Deine alte Mutter!“
„Was ist’s mit Julia?“ fragte er hart.
„Lieber Gott, sie hat ja doch das Würmchen retten wollen und ist selbst beinah’ ertrunken! Vorhin war sie bei Besinnung, aber jetzt liegt sie wieder so starr da!“
Er fuhr mit der Hand an die Stirn, dann ging er in das Stübchen des Mädchens. Die alte Dame schloß die Thür hinter ihm, und er trat allein an das Bett. Auf der Kommode flackerte eine Kerze und beleuchtete das blasse Mädchengesicht, das mit einem unheimlich starren Ausdruck in den Kissen ruhte.
„Julia!“ sagte er leise. Da schlug sie die Augen auf und erkannte ihn.
„Fritz!“ Und sie streckte ihm die Hände entgegen. „Fritz, ich wär’ so gern an seiner Statt gestorben.“ Und jahrelanges Leid brach sich Bahn in dem heißen Schluchzen, das nun folgte.
Er vermochte nicht zu sprechen, aber er bückte sich und zog ihre Hand an seine Lippen.
„Ja, siehst Du, Fritz,“ sagte die Räthin eine halbe Stunde später zu ihrem Sohn, als die alte Doris „ihren Bub’“ in den kleinen Sarg gelegt hatte, „siehst Du, Fritz, sie hatte das Kind an der Hand, ich traf sie noch an der Treppe und fragte: ‚Therese, willst Du das Kind bei dem Winde mit hinausnehmen?‘ ‚Nur bis zu Papa,‘ antwortete sie mir. Und da beruhige ich mich denn und gehe in die Küche und sehe noch, wie sie den Mittelweg so hastig dahinläuft, daß das Kerlchen ihr kaum folgen kann. Und dann habe ich noch einmal das rothe Mützchen hinter dem Strauchwerk schimmern sehen, aber an weiter nichts gedacht. Auf einmal hör’ ich das Julchen schreien und sehe sie hinausrasen den Weg entlang, und wie ich alte Frau dahinter herkomme, da liegt das Julchen im Wasser, und ich sehe das rothe Mützchen des Buben schwimmen und die Leute in einem Nachen herankommen. Und das Julchen ist ganz verschwunden gewesen, und endlich hat sie’s heraufgebracht, das Kind, und wie sie’s ihr abgenommen hatten, da ist sie noch einmal verschwunden und dann wieder aufgetaucht, und da hat sie nach der Stange gestoßen, nach der sie hätte greifen sollen, und der alte Fischer sagte, sie hätte sich um keinen Preis retten lassen wollen, und ganz wie tot haben sie sie hereingetragen. Und den alten Onkel Doktor und den neuen Kollegen, die hatten wir gleich, aber Du warst nicht zu finden. Freilich – es hätte ja auch nicht geholfen bei unserem Engelchen.“
„Willst Du denn nicht zu Therese hinaufgehen?“ fragte sie dann. „Gott im Himmel, sie ist ja schuld daran, denn sie hatte es ganz vergessen, daß sie den Buben mitgenommen, und da ist das kleine Dingelchen allein an den Rhein gepaddelt – aber denke doch, wie nöthig sie ein bißchen Trost hat!“
„Laß, Mutter,“ sagte er, „meinen Trost braucht sie nicht.“
Da band sie sich ein schwarzes Tuch über das Kleid und ging selbst hinauf zu ihrer Schwiegertochter. Aber als sie ein Zimmer nach dem andern öffnete, da war es überall leer, unheimlich leer und still.
„Wo ist die Frau Doktor?“ fragte sie endlich mit klopfendem Herzen in die Küche hinein, wo die Mädchen müßig saßen mit verstörten Gesichtern.
„Drüben bei ihrem Vater,“ antwortete die Köchin.
Die alte Frau ging in die Villa hinüber. Therese war in ihrem Mädchenzimmer; sie wolle niemand sehen hieß es, Herr Krautner aber lasse bitten. Die Räthin trat bei dem alten Herrn ein. Erschreckt sahen sich die beiden an. „Um Gotteswillen, ist’s noch nicht genug an einem Unglück?“ fragte die Räthin, in banger Ahnung das unheilverkündende Gesicht des Alten betrachtend.
Dieser wandte sich kurz um, und da er nicht sprechen konnte, begann er zu pfeifen. Endlich trat er wieder vor die Frau.
„Damals, als mein Hannchen gestorben ist, Frau Nachbarin, da hab’ ich gemeint, etwas Schlimmeres könnt’s nicht geben. Heute weiß ich, daß das ein kleiner Schmerz gewesen ist, gar kein Vergleich zu dem, der mein Herz jetzt zerreißt. Es trifft auch Sie. Meine Tochter – Gott weiß, wie sie so geworden – ist heute morgen zu mir gekommen und hat gesagt, sie will fort vom Fritz – – Sonst habe ich schelten können und zanken, heut’ aber ist mir’s so gewesen, daß ich keine Silbe gefunden habe. Und wie sie gesagt hat, daß sie den Frieder Adami liebt und ihn nach der Scheidung heirathen will, da habe ich erst recht nichts sagen können; nur inwendig, da habe ich mich angeklagt und mich einen Esel geheißen, der da meinte, alles gut zu machen, und nicht bedachte, daß man kein Menschenherz auskennt, selbst nicht sein eigen Fleisch und Blut. Und erst zuletzt habe ich gefragt: ‚Und Dein Kind, Therese?‘ Und da ist’s gerade gewesen, wie sie das Bübchen tot aus dem Wasser gefischt haben.“
Die alte Dame war sprachlos in einen Stuhl gesunken. „O mein Bub’! Mein armer Bub’!“ kam es dann langsam von ihren Lippen. Und der alte Mann drückte ihr die Hand und nickte still mit dem grauen Kopf. Endlich sagte er:
„Ich kann nichts dafür, von mir aus ist sie rechtlich gewöhnt, und ich war so glücklich, als sie den braven Mann bekam. Wenn es helfen könnte – wie gerne wollt’ ich mein altes Leben hingeben! Aber, Frau Nachbarin, es giebt einen über uns, welcher die Schicksale lenkt, sagte mein Hannchen immer. – Stillhalten, Frau Nachbarin, stillhalten!“
Die Verarbeitung der Kohlen im Ruhrgebiet.
Auf Grund der verschiedensten Berechnungen haben die Gelehrten geschlossen, daß in einer nicht allzufernen Zeit die letzten schwarzen Diamanten dem Schoß der Erde entnommen und durch unsere und voraussichtlich auch unserer Nachkommen Leichtlebigkeit in Form von Kohlensäure und leider auch als Rauch der Atmosphäre zurückgegeben sein werden. Auch sie gehen dahin zurück, von wo sie genommen sind, soweit wenigstens, als sie menschlichen Händen erreichbar und für die Gewinnung lohnend erscheinen. Wenn alsdann ein Geschichtschreiber nach ein paar Schlagwörtern suchen wird, um die Faktoren zu bezeichnen, welche um die Wende des 19. Jahrhunderts das Kulturleben der Völker beherrschten, so wird er wohl die beginnende Herrschaft der Elektricität hervorheben müssen, die zutreffenden Ausdrücke aber werden Kohle und Eisen sein. Und Kohle noch in höherem Sinne als Eisen. Wir können uns wohl eine Kohlengewinnung in großem Stil vorstellen, ohne die gewaltige Entwicklung der Eisenindustrie unserer Tage, nicht jedoch die massenhafte Eisenproduktion ohne Kohle. Kohle ist angehäufte Kraft in schlummerndem Zustande, welche aber jeden Augenblick durch den Verbrennungsprozeß aufgeweckt zu werden vermag. So ist der Kohlenbergbau das belebende Element für jede Großindustrie.
Diese und ihnen nahestehende Gedanken dürften in dem Jahrhundert der Technik und der Naturwissenschaften Gemeingut aller Gebildeten sein. Weniger allgemein bekannt jedoch pflegt es zu sein, daß ein großer Theil der aus dem Erdinnern herausgeholten Kohle vor dem Verbrauch eine Reihe von Vorbereitungsarbeiten durchzumachen hat, so daß die in den Handel kommenden Formen der Kohle bereits die Bedeutung eines Fabrikats erlangt haben. So bringt eine große Zeche des Ruhrgebietes, welche mit einer Belegschaft von 1800 Arbeitern täglich 24 000 Centner Kohlen gewinnt, nur 6000 Centner als „Förderkohle“, d. h. in der Form, wie sie aus dem Schacht gehoben werden, zum Verkauf. Die übrigen 18 000 Centner werden erst einer umfangreichen Bearbeitung unterworfen. Diese „Aufbereitungsanstalten“ machen den „über Tage“ liegenden Theil einer Zeche vielleicht noch sehenswerther als die bekannteren Einrichtungen, welche die Förderung der Kohle aus dem Schacht, die Entfernung des Grubenwassers, die Lüftung der unterirdischen Bauten etc. zum Zweck haben.
Noch vor etwa 20 Jahren war von einer Aufbereitung der Kohlen nur in ganz beschränktem Sinne die Rede. Man fand wohl hier und da Siebe, welche die Kohlen in Sorten von verschiedener Stückgroße zerlegten, so wie sie für besondere Verwendungsarten sich vorzugsweise eigneten. Die heutigen ganz gewaltig vervollkommneten Einrichtungen sind, wie so häufig, ein Ergebniß der Noth, des Kampfes ums Dasein. Als in den siebziger und achtziger Jahren die große Geschäftsstille eintrat, als die Menge der geförderten Kohlen die Nachfrage weit überstieg und die Preise soweit herabgingen, daß von einem Gewinne nicht mehr die Rede sein konnte – hat es doch Zeiten gegeben, in denen der Preis auf den fünften Theil des jetzigen Werthes herabgesunken war – da suchten einzelne Zechen einen Vorsprung vor ihren Mitbewerbern dadurch zu gewinnen, daß sie den Abnehmern eine Ware von außergewöhnlicher Reinheit und diese noch in einer Sortierung der Stücke darboten, welche den Wünschen der Kunden in weitgehender Weise entgegenkam.
Natürlich wuchsen dadurch die Ansprüche des Publikums, und gleichzeitig wurde auch die Konkurrenz zu denselben Einrichtungen gezwungen. Soweit kam es wohl nicht, wie uns auf einer Zeche scherzhaft gesagt wurde, daß die Käufer jedes Stück Kohle – jede „Nuß“ – für sich in Watte verpackt und in Seidenpapier gewickelt verlangten: richtig jedoch ist, daß kleine Steinchen, die in der Kohle zurückgeblieben waren, auf dem Wege der Beschwerde als corpus delicti mit Postpaket den Zechen eingesandt worden sind. Diese Fluth der Ansprüche hat sich gegenwärtig verlaufen. Was sie jedoch erzeugt hat, ist geblieben, nämlich ein hoher Grad von Vervollkommnung in der vorbereitenden Verarbeitung der Steinkohle. Diese mag im Folgenden betrachtet werden.
Ein Förderschacht enthält zwei Räume – „Trümmer“ – in denen sich zwei eiserne Gestelle, „Förderkörbe oder Förderschalen“, an kräftigen Drahtseilen auf- und abwärts bewegen. Jedes Gestell, selber etwa 2000 bis 3000 kg schwer, pflegt 4 bis 8 kleine Förderwagen zu tragen, von denen jeder etwa 300 kg wiegt und etwa 500 kg Kohle aufzunehmen vermag. An beiden Seiten der Förderschale sehen wir noch die sogenannten „Fangeinrichtungen“, dazu bestimmt, wenn ein Seilbruch eintreten sollte, das Gestell auch dann noch an den Führungsbalken, zwischen denen dasselbe auf und ab gleitet, zum Stillstand zu bringen und vor dem Fall in die Tiefe – die tiefsten westfälischen Kohlenschächte erreichen jetzt über 700 Meter – zu bewahren.
Wir stellen uns vor den Schacht und sehen zu unserer Rechten ein Fördergestell heraufsteigen. Dasselbe trägt mit Kohlen gefüllte Wagen. Die Arbeiter ziehen dieselben herunter, fast gleichzeitig schieben andre Arbeiter leere Wagen wieder an deren Stelle, und die Förderschale versinkt in die Tiefe, um, dort angelangt, ihre leeren Wagen wieder durch gefüllte zu ersetzen. Nach kurzer Zeit taucht zu unserer Linken ein Gestell, wieder mit gefüllten Wagen, empor, um wie das vorige behandelt zu werden. Das Spiel wiederholt sich so in kurzen Zwischenräumen; jedesmal werden etwa 2000 bis 4000 kg Kohlen ans Tageslicht heraufgehoben. Die durchschnittliche Schachttiefe kann man etwa zu 400 Metern annehmen – 100 Meter mehr oder weniger spielen hier keine entscheidende Rolle; dieselbe kann von dem Fördergestell, welches etwa 9 Meter in der Sekunde durcheilt, bequem in einer Minute durchmessen werden, und ebensoviel Zeit mag das Herausziehen der vollen und das Nachschieben der leeren Wagen beanspruchen. Der Leser vermag nun selber auszurechnen, wie ein solcher Schacht stündlich 6 bis 12 Doppelwaggons Kohlen, jeden zu 10 000 kg, zu fördern vermag.
Verfolgen wir nun die gewonnenen Kohlen auf ihrem weiteren Wege! Ein Theil derselben, „Förderkohle“ genannt, wird sofort auf eine geneigte Ebene entleert und gleitet ohne weiteres in untergestellte Eisenbahnwagen – jede Zeche hat ihre besonderen Anschlußgeleise an die Eisenbahn –, um den Verbrauchsstellen zugeführt zu werden. Der Inhalt der meisten Wagen jedoch wird auf ein schwach geneigtes Sieb, „Rätter“, gestürzt, welches Löcher von 80 mm Weite enthält und durch regelmäßige Stöße fortwährend in Erschütterung versetzt wird. Nur die größeren Stücke vermögen über diese Oeffnungen hinwegzugleiten. Ein [849] eigenthümlicher Transport- und Verladeapparat führt dieselben ebenfalls einem Eisenbahnwagen zu. Unterwegs jedoch werden beigemengte Steine von Knaben abgehoben und beseitigt. Das Vorkommen solcher Steine, „Berge“ genannt, in allen Größen bis zum Staub herunter ist ein sehr lästiger Uebelstand des Kohlenbergbaus, und auf ihre Entfernung bezieht sich der Theil der Aufbereitung, der als „Wäsche“ bezeichnet wird.
Es ist unmöglich, die Beimengung solcher „Berge“ gänzlich zu vermeiden. Die Kohlen liegen ja eingebettet in Gestein, oben wie unten von dunklem Schieferthon begleitet; nicht selten finden sich Lagen davon in der Kohle selbst, dann als „Bergmittel“ bezeichnet. So kann es nicht ausbleiben, daß beim Hauen und Sprengen nothwendig auch Steine in die Kohlen gelangen.
Die auf dem „Rätter“ abgesonderte „Stückkohle“ ist nun der werthvollste Theil, der einen höheren Preis erzielt, auch geringeren Qualitäten zur Erhöhung des Werthes beigemengt wird. Der Rest jedoch von weniger als 80 mm Durchmesser, welcher durch die Löcher des Rätters hindurchfiel, bildet den Gegenstand der weiteren Aufbereitung. Derselbe wird zunächst von Schöpfbechern – „Elevatoren“, „Paternosterwerken“ – ergriffen und in die Höhe gehoben. Diese Becherwerke gleichen denen eines Baggers, welche Schlamm vom Boden des Wassers herauffördern und dem Leser vielleicht schon bei irgend einer Gelegenheit bekannt geworden sind.
In unserem Falle entleeren die Becher ihren Inhalt in große, etwas schräg liegende eiserne Trommeln, deren Mäntel drei Abtheilungen von Löchern, von oben nach unten gerechnet mit zunehmender Weite, zu enthalten pflegen. Indem die Kohlen auf dem Boden der beständig in Drehung befindlichen Trommel abwärts gleiten, sortieren sie sich in 4 Partien verschiedenen Durchmessers, von denen die kleinste Sorte die erste Abtheilung der Löcher, die folgende die zweite etc. passiert. Was auch für die Oeffnungen der dritten Abtheilung noch zu grob ist, fällt als vierte Sorte aus der Trommel selber heraus. Gewöhnlich wird durch Verbindung mehrerer Trommeln diese Zerlegung – „Separieren“ oder „Classieren“ genannt – noch weiter geführt, sodaß etwa 7 Sorten erzeugt werden. Die dicksten (80 bis 40 mm) heißen „Knabbeln“ oder „Würfel“, die folgenden (40 bis 25 mm und 25 bis 15 mm) „Nuß I“ und „Nuß II“; dann folgen „Schmiedekohlen“ (15 bis 8 mm), weiter mehrere Sorten „Feinkorn“ und endlich „Staubkohlen“. Wenn nun auch in neuester Zeit die maschinellen Einrichtungen dieser „Separation“ Aenderungen erlitten haben, so haben die letzteren doch in Westfalen noch keine weitere Verbreitung zu erlangen vermocht. Das geschilderte Verfahren ist hier das allgemein übliche. Die Vornahme der Separation ist zugleich eine unumgängliche Vorbedingung für den sog. „Waschprozeß“, d. h. die Scheidung der Schieferstücke von der Kohle. Diese Trennung läßt sich nämlich nur dann mit Sicherheit ausführen, wenn beide Theile, Kohle und Schiefer, innerhalb nicht zu weiter Grenzen gleiches „Korn“, d. h. gleiche Dicke der Stücke, besitzen. Das Verfahren beruht auf dem allbekannten Naturgesetz, nach welchem die Spreu vom Weizen gesondert wird. Wirft man ein Gemenge von Körnern und Spreu durch die Luft, so überwinden die schwereren Körner den Widerstand derselben leichter, fliegen mithin weiter weg; das Gemenge zerlegt sich in eine dem Arbeiter näher liegende Schicht Spreu und eine entferntere Lage Korn.
Derselbe Zweck läßt sich auch noch anders erreichen. Richten wir einen kräftigen Luftstrahl gegen das Gemenge, so treibt derselbe die leichtere [850] Spreu weiter fort, das Korn bleibt zurück. Hierauf beruhen die bekannten Kornreinigungsmühlen. Nun läßt sich aber mit der leichten Luft gegen die schweren Kohlenstücke und die noch schwereren Schiefer nichts ausrichten. Man wählt daher eine hierfür geeignetere Substanz, das Wasser.
Würden wir ein Gemenge aus Kohlen- und Schieferstücken von annähernd gleicher Größe in Wasser zum Sinken bringen, so würden die schwereren Schiefer den Widerstand des Wassers leichter überwinden und schneller hinabeilen. Nach kurzer Zeit hätte sich unser Gemenge in eine untere Schicht Schiefer und eine obere Lage Kohlen geschieden.
Auch die zweite der vorigen Zerlegungsarten können wir mit Wasser zur Ausführung bringen. Stellen wir uns ein Gefäß vor mit durchlöchertem Boden, darauf ein Gemenge von Kohlen- und Schieferstücken, welche so dick sind, daß sie die Löcher nicht passieren können! Lassen wir nun durch die Sieböffnungen des Bodens Wasser mit hinreichender Geschwindigkeit emporsteigen, so wird dasselbe beide Theile heben, die leichteren Kohlen aber in derselben Zeit weiter nach oben schaffen als die Schiefer. Wir können die Einrichtung so abpassen, daß die Kohlen bis zum Rande des Gefäßes gehoben und hier von dem überströmenden Wasser mit fortgerissen werden. Die Schiefer werden alsdann noch einige Zoll tiefer liegen. Lassen wir hier einen zweiten Theil des Wassers durch einen Schlitz in der Seitenwand hinausströmen, so läßt sich das Ganze bei geschickter Regulierung so einrichten, daß dieser zweite tiefer gelegene Wasserstrom die Schiefer hinauswirft und in ein besonderes Gefäß – den „Bergetrog“ – befördert.
Was wir hier darlegten, ist das Wesen der sogenannten „Setzkästen“, welche bei der Trennung der Erze von taubem Gestein längst benutzt, aber erst neuerdings für die Kohlen in Anwendung gekommen sind.
Um den geschilderten Prozeß praktisch auszuführen, liegt neben jenem Kasten mit Siebboden noch ein zweites Gefäß, in welchem ein Stempel wasserdicht auf und niedergeht. Bei jedem Niedergange drückt derselbe Wasser durch das Sieb und bewirkt so die angestrebte Trennung. Für die Reinigung der ganz kleinen Körner ist diese Einrichtung etwas abgeändert, da ein weiteres Sieb die Kohlen sammt Schiefer durchfallen ließe, ein hinreichend enges jedoch dem Wasser nicht leicht genug den Durchgang gestattete.
Diese „Feinkornsetzmaschinen“ haben ein weitmaschiges Sieb, darauf aber eine Lage von schwedischem Feldspath. Man hat gefunden, daß dies Gestein vermöge seiner Schwere für den vorliegenden Zweck sich am besten eignet; auch haben die Stücke desselben eine wohlabgepaßte Größe. Die Lücken zwischen den Stücken des Feldspaths öffnen und schließen sich, je nachdem der Wasserstrom emporsteigt oder zurückfließt. Die Schiefer treten dabei in diese Lücken ein, durchdringen das Feldspathlager und wandern schließlich durch die weiten Maschen des Siebes, während die Kohle auch hier oben hinausgespült wird.
Durch diesen Waschprozeß erleiden nun die Kohlen eine ganz wesentliche Verbesserung, welche sich zahlenmäßig an einer Abnahme ihres Aschengehaltes nachweisen läßt. Zumal die „Feinkornsetzmaschinen“ lassen sich so fein regulieren, daß ein geübter Waschmeister innerhalb gewisser Grenzen jeden vorgeschriebenen Aschengehalt zu erzeugen verstehen wird. Dementsprechend sind nun auch die Ansprüche der Abnehmer gestiegen. Koks z. B., aus ungewaschenen Kohlen dargestellt, würden heutzutage wegen des hohen Aschengehalts keinen Käufer mehr finden.
Wo ein hoher Grad von Reinheit verlangt wird, nimmt man absichtlich häufig erst eine weitgehende Zerkleinerung vor, um auf der „Feinkornsetzmaschine“ um so sicherer auch die kleinsten Schiefertheilchen entfernen zu konnen.
Was wird nun aus der so gereinigten und sortierten Kohle? Die größeren Stücke, die „Würfel“, „Nüsse“ und „Schmiedekohlen“, finden in der Küche der Hausfrau, beim Schmied etc. in der vorliegenden Form leicht Verwendung. Aber die ganz feine, zum Theil staubförmige Kohle? Hier erhebt sich eine ernste Schwierigkeit. Ein so feines Pulver läßt sich, bei der gewöhnlichen Einrichtung wenigstens, nicht verbrennen, da die Verbrennungsluft durch die engen Zwischenräume nicht hindurchgeführt werden kann. Nun ist aber reichlich ein Drittel, ja fast die Hälfte aller Kohlen „Feinkohle“; somit ist die Verwendung derselben eine wichtige Lebensfrage der Kohlenindustrie. Glücklicherweise liegt heutigen Tages nach zwei Richtungen für diese „Feinkohle“ ein solcher Bedarf vor, daß derselbe durch die von selber entfallenden Mengen häufig nicht gedeckt werden kann, sondern oft noch ein Theil der größeren Stücke dazu der Zerkleinerung unterworfen werden muß. Diese Verwendungsarten sind die Verkokung und das Briquettieren.
Reden wir zunächst von den Koks. Wer kennt sie nicht, diese halbmetallisch glänzenden Stücke, wie sie in poröser, lockerer Form als Nebenerzeugniß von jeder Gasanstalt in Menge geliefert werden, um z. B. unsere Füllöfen zu speisen? Dennoch ist dies nur ein geringer [851] Bruchtheil aller überhaupt erzeugten Koks. Unsere Hochöfen, welche das Roheisen liefern, bedürfen der Koks in solchen Massen, daß die Zechen die großartigsten Einrichtungen zur Herstellung derselben getroffen haben. Auch würden die Gaskoks für die Hochöfen keine Verwendung finden können, da sie viel zu locker sind, um unter dem Druck der Erzmassen, welche jene über 20 Meter hohen Oefen füllen, nicht zu Pulver zermalmt zu werden und so dem Winde, welcher hindurch geblasen werden muß, den Weg zu versperren. Eine unmittelbare Verwendung stückförmiger Steinkohlen würde an demselben Uebelstande scheitern; auch sind diese unvorbereitet schon um deswillen nicht brauchbar, weil sie immer in mehr oder weniger hohem Grade Schwefel enthalten; die messingartigen, oft ins Bläuliche spielenden Anlauffarben mancher Kohlen verrathen dies dem kundigen Blick sofort. Dieser Schwefel würde nun unfehlbar ins Eisen gelangen und dasselbe brüchig machen. Nur manche „Anthracitkohlen“ sind so fest und schwefelfrei, daß sie ohne Vorbereitung den Hochöfen zugeführt werden können.
Auch die Koksdarstellung hat ihre Geschichte: von der einfachen Darstellung in Meilern geht es aufwärts bis zu den jetzigen Koksöfen. Unsere heutigen Einrichtungen weichen in den Einzelheiten mannigfach von einander ab; im Prinzip jedoch stimmen sie alle überein. Die Koksdarstellung ist etwa die Umkehrung der Leuchtgasfabrikation. Bei der letzteren erhitzen wir eine geeignete Kohle, die „Gaskohle“, in thönernen Retorten. Es entweicht alsdann bei diesem „Destillationsprozeß“ außer Substanzen, welche sich als Wasser, Theer und Ammoniakwasser in den kühleren Theilen der ganzen Einrichtung ablagern, ein brennbares Gas, welches einige Reinigungsprozesse durchmachen muß, um alsdann in die Röhrenleitung geführt zu werden und unseren Leucht- und Heizzwecken zu dienen. Dabei hinterbleiben in der Retorte jene porösen Koks. Dieselben behandeln wir hier als Abfall, verbrennen einen Theil davon, um unsere Retorten zu heizen, und verkaufen den Rest. Umgekehrt richten wir bei der Verkokung unser Hauptaugenmerk auf möglichst reiche Gewinnung dieser Koks, lassen das entweichende Gas als Nebenerzeugniß gelten und verbrennen dasselbe, um unsere Retorten soweit zu erhitzen, als es der Prozeß erfordert.
Dieser Vorgang nun spielt sich in den sogenannten „Koksbatterien“ ab. In Westfalen am meisten verbreitet sind die sogenannten Coppée-Oefen. Etwa 30 bis 60 derselben bilden eine „Batterie“. Es sind, wenn wir nebensächliche Theile übergehen, wagerecht liegende Zellen, etwa 10 m lang, 60 cm breit und 170 cm hoch. Jede Zelle („Retorte“, „Ofen“) faßt etwa 6000 kg Kohle; sie ist von feuerfesten Wandungen ringsum umschlossen und hat vorn wie hinten eine verschließbare, ebenfalls feuerfeste Thüre. Die Wände zwischen zwei benachbarten Zellen enthalten Hohlräume, auch zieht ein Kanal („Sohlkanal“) unter jeder Zelle durch. Soll eine solche Batterie in Gebrauch genommen werden, so werden zunächst die Zellen bis zur Weißgluth erhitzt. Alsdann bringt man durch drei in der Decke angebrachte Oeffnungen („Füllschächte“) die Kohlen in fein vertheiltem Zustande hinein und verschließt diese „Füllschächte“ wie auch die beiden Thüren luftdicht.
Unter der Hitze der weißglühenden Wände beginnt alsbald der „Destillations“-Prozeß – Gas entweicht. Dieses Gas leitet man nun durch schlitzförmige Oeffnungen, welche oben an den Wänden der Zellen angebracht sind, zunächst in die Hohlräume der Wandungen und von da auch in den „Sohlkanal“. Gleichzeitig führt man durch besondere Oeffnungen von außen soviel Luft zu, daß eine fast vollständige Verbrennung des Gases erzielt wird. Die Batteriezellen sind nun seitlich wie auch unten von Flammen umgeben. Das Gas der Kohle wird hier noch vollkommener ausgetrieben als in den Retorten der Gasanstalt. Nachdem das brennende Gas in der Batterie seine Schuldigkeit gethan hat, läßt man es keineswegs in die freie Luft entweichen, denn es enthält noch viel Wärme und kann noch wichtige Dienste leisten. Man sammelt es daher in einem unterirdischen Kanal, leitet es unter die Dampfkessel, welche den Kraftbedarf für die maschinellen Anlagen der Zeche zu liefern haben, und diese abziehende Hitze der Batterie („Abhitze“) reicht noch vollkommen für die Heizung sämmtlicher Kessel aus, so daß der bedeutende, sonst für dieselben erforderliche Aufwand an Brennmaterial gespart werden kann. Man schätzt [852] diesen Gewinn so hoch, daß Hüttenwerke, welche Koks in größerer Menge bedürfen, einen Theil derselben in eigenen Koksbatterien erzeugen, um ihre Kessel ebenfalls durch die „Abhitze“ feuern zu können.
Während der Verkokung backt nun die Kohle zu einer Art von Kuchen zusammen.
Nach 48 Stunden ist der Prozeß vollendet. Die Zellen werden alsdann auf beiden Seiten geöffnet, damit man den Inhalt herausdrücken kann. Zu dem Zweck ist eine besondere Dampfmaschine, eine Art Lokomotive, hinter der Batterie aufgestellt, mit der man hin und her fahren und hinter jeder Zelle Aufstellung nehmen kann. Diese Maschine treibt an einer langen Zahnstange einen Stempel vom Querschnitt der Zelle durch dieselbe hindurch und schiebt so am entgegengesetzten Ende die noch glühende, teigartige Koksmasse hinaus. Löschmannschaften richten sofort einen Wasserstrahl gegen dieselbe, um Verlusten durch Verbrennung an der Luft zu begegnen.
Die noch glühenden Zellen werden alsbald wieder mit Kohlen gefüllt, und das vorige Spiel beginnt von neuem.
Um dies Füllen bequem und rasch ausführen zu können, geht eine Eisenbahnanlage über die ganze Batterie hinweg. So können die Kohlen unmittelbar über die Füllschächte gefahren und in dieselben hinabgestürzt werden.
Die gewonnenen Koks sind nun, zumal sie beim Entleeren der Zellen durch den Stempel eine Pressung erlitten, fest und ziemlich schwefelfrei. Freilich sind diese Vortheile durch einen Verlust erkauft worden. Man rechnet im Ruhrgebiet, daß etwa 30% der Kohle verloren gehen; die Ausbeute, das „Ausbringen“, an Koks beträgt somit etwa 70%, kann jedoch unter günstigen Umständen 85% und noch darüber erreichen. Neuerdings ist es übrigens gelungen, das Verfahren noch erheblich zu verfeinern. Durch Einrichtungen ähnlich denen, wie sie bei der Leuchtgasfabrikation bestehen, vermag man dem bei der Verkokung freiwerdenden Gas, ehe es seinen Dienst bei der Heizung der Oefen übernimmt, seinen Gehalt an Theer und Ammoniakwasser und außerdem noch an Theerölen abzunehmen, welch letztere mit ihren Ableitungen, z. B. dem Benzol, in der Bereitung der Anilinfarben eine wichtige Rolle spielen.
Nicht jede Kohle eignet sich zur Koksbereitung. Bedingung ist, daß dieselbe in der Hitze zusammenbackt und dabei soviel Gas entweichen läßt, als zur Erzeugung der nöthigen Hitze gerade erforderlich ist.
Einen Ueberschuß an Gas hat man nicht gern, da derselbe einen unnöthigen Verlust, eine Abminderung des „Ausbringens“, zur Folge hat. Eine mäßig „fette“ Kohle eignet sich am besten. Ganz ungeeignet jedoch sind die „mageren“ Kohlen, die nicht backen und kein oder nur wenig Gas geben. Dies war nun früher für die „mageren“ Zechen recht schlimm, da sie für die große Menge ihrer „Feinkohlen“ kein rechtes Unterkommen zu finden wußten. Zwar kann man von denselben soviel einer fetten Kohle beimischen, daß das Ganze nunmehr verkokbar wird, Rücksichten auf den Herstellungspreis aber werden dies in den meisten Fällen verbieten. Gewöhnlich werden die nicht backenden Feinkohlen zur Darstellung der Briquetts (Preßkohlen) benutzt, wozu man allerdings an einigen Stellen auch fette Kohlen verwendet.
Die Briquetts werden aus feinem Kohlenpulver hergestellt. Da dasselbe jedoch für sich auch in der Hitze nicht backt, so bedarf es eines Zusatzes, der diese Verbindung der kleinsten Theilchen zu einer festen Masse zu bewirken vermag. Allgemein wird dazu ein fester, spröder Asphalt genommen, „brai sec“ genannt, der in der Hitze schmilzt und von dem etwa 5 bis 7%, je nach der Beschaffenheit der Kohle, zugesetzt werden. Dieser Asphalt wird als Nebenerzeugniß bei der Leuchtgasfabrikation gewonnen und unterscheidet sich von Theer wesentlich dadurch, daß er schon bei gewöhnlicher Temperatur fest ist. Früher schwer verkäuflich, ist diese Substanz jetzt so gesucht, daß sie einen bestimmenden Einfluß auf den Preis der Briquetts ausübt und selber in den letzten Jahren im Werth auf das Doppelte gestiegen ist.
Das Gemenge von Kohle und Asphalt wird auf einen großen sich drehenden Tisch gebracht, über den eine lange Flamme hinwegstreicht. Dadurch wird dasselbe bis zur Backfähigkeit erhitzt, um nun den Pressen zugeführt zu werden, welche die Masse entweder zu würfelförmigen Stücken oder zu Knollen von Faustgröße („Eibriquetts“) formen. Solche Tische entwickeln jedoch aus dem Asphalt des Gemenges einen recht lästigen Rauch. Daher zieht man neuerdings vor, die Erweichung der Masse in geschlossenen Trommeln durch stark überhitzten Dampf zu bewirken.
Die Pressen nach Couffinhal-Biétrix[WS 1] sind in Westfalen am verbreitetsten. Sie pressen die Kohle erst von oben und dann auch noch von unten mit einem Druck von 180 kg auf den Quadratcentimeter zusammen. Eine solche Presse liefert in der Minute 28 Briquetts zu 5 kg, also 140 kg in der Minute oder 8400 kg in der Stunde, d. h. in der zehnstündigen Arbeitsschicht 84 000 kg oder über 8 Doppelwaggons.
Im Ruhrgebiet giebt es Zechen, welche 3 solcher Pressen gleichzeitig im Betriebe haben. Schon hieraus folgt wohl die ausgedehnte Verwendung, welche sich dies Fabrikat in wenigen Jahren erobert hat.
Ein gutes Briquett muß so fest sein, daß es, von einem kräftigen Manne so hoch wie möglich geworfen, beim Aufschlagen nicht zerbricht. Diese Festigkeit in Verbindung mit der regelmäßigen Form der Stücke, welche eine knappe Raumausnutzung beim Verladen gestattet, macht die Briquetts zum Versand auf weite Entfernungen besonders geeignet. Freilich neigen sie auch wegen ihres Asphaltgehaltes zur Entwicklung von Ruß, und dies ist doch in vielen Fällen ein fühlbarer Uebelstand.
Wir sehen also, daß von der rohen Förderkohle vielverzweigte und oft lange Wege zu den Kohlensorten führen, welche der Mensch zu seinen mannigfachen häuslichen und industriellen Bedürfnissen benutzt. Und wenn wir diese Wege in ihrer Gesammtheit überblicken, so erkennen wir ein gemeinsames Ziel, dem sie zustreben. Es heißt: höchste Ausnutzung der kostbaren Schätze der Tiefe, peinliche Sparsamkeit mit den schwarzen Diamanten!
Alle Rechte vorbehalten.
Vom „Malkasten“ zu Düsseldorf.
Der Rhein, der alte Vater Rhein! Wie mancher Wanderer hat ihn gepriesen, wie mancher Dichter ihn besungen in begeisterten Weisen! Wer ihn schaute, dem senkte sich der Reiz seiner Landschaft, der poetische Zauber seiner Burgen und Schlösser, seiner Geschichte und Sage tief ins Herz.
Aber schauen wir genauer zu, so gilt der Lobpreisungen unerschöpfliche Fluth doch meist nur einem Theile des Stromes. Jene Strecken vom Niederwalddenkmal bis zum Drachenfels sind es vornehmlich, welche die Harfen der Sänger erklingen lassen. Für den Wanderer und für den Dichter hört der Rhein auf beim Siebengebirge oder allenfalls bei der „Stadt mit dem ewigen Dom“. Was unterhalb liegt, das ist gleichsam nur ein Anhang, ein Nachwort, das man im Nothfall auch ungelesen lassen kann.
Und doch birgt auch dieser Anhang noch der Perlen genug! Da ist das malerische Kaiserswerth, das denkwürdige Xanten, da ist vor allem das liebliche Düsseldorf mit seinen grünenden Gärten, mit seinen Künstlern und ihrem prächtigen Heim, dem „Malkasten!“.
Die älteren Leser der „Gartenlaube“, die heute mit mir dem „Malkasten“ einen Besuch abstatten, sind nicht ganz unbekannt daselbst. Noch 1885 haben sie einen Blick in seine Kegelbahn geworfen, und auch früher schon haben sie sich manchmal mit ihm beschäftigt. Aber immer kommt man gern wieder. Denn wahrlich, es lohnt der Mühe! Es ist ja eine leidige Thatsache, daß von dem Nimbus, welcher für den Fernerstehenden das Künstlerdasein umwebt, so manches Stück bei näherer Betrachtung dahinschwinden muß. Aber dem idyllischen Besitzthum der Düsseldorfer Künstlerschaft droht dieses Schicksal nicht. Je näher man es kennt, desto mehr wird man es liebgewinnen.
Es war im Jahre 1848. Die nationale Bewegung hatte ihren machtvollen Aufschwung genommen, und in den edelsten und besten Männern lebte der Glaube an den Anbruch einer neuen großen Zeit für unser geeintes deutsches Vaterland.
„Damals hatte sich in Düsseldorf ein Komitee gebildet aus allen Kreisen der Bevölkerung, um der freudigen Begeisterung, die sich aller bemächtigt hatte, einen öffentlichen Ausdruck zu geben, und zwar durch ein Verbrüderungsfest am 6. August. Die Künstlerschaft wurde aufgefordert, durch ihre Theilnahme und Hilfe dem Feste einen besonderen Glanz zu verleihen. So wurde denn am Abende des 6. August auf der Alleestraße zwischen dem heutigen Theater und der Kunsthalle eine Kolossalstatue der Germania enthüllt und bei lodernden Fackeln bejubelt und besungen. Schließlich senkten sich die Fahnen aller deutschen Länder vor dem Banner mit dem Adler des neuerhofften Reiches.
Nach dieser Huldigungsfeier zogen die Künstler nach dem heute noch bestehenden Lokal zur ‚Bockhalle‘, und hier kam bei patriotischen Reden und fröhlichem Becherklang der Gedanke zum Ausdruck: gleich wie die deutschen Stämme sich einigen sollten, so möchte auch im Kreise der Künstlerschaft sich eine Vereinigung bilden, die ihre Glieder einander persönlich näher führen würde, damit sie nach des Tages ernster Arbeit Erholung und Anregung fänden in treuer Gemeinschaft. Der sofort gegründete Verein wurde nach des Altmeisters Carl Hübner geistreichem Vorschlag ‚Malkasten‘ getauft. Alle Farben sollten vertreten sein, alle Farben zur Geltung kommen, alle ein gleiches Recht haben.“ Mit diesen Worten schilderte am letztjährigen Stiftungsfest der damalige Vorsitzende O. Erdmann die Gründung des Vereins. „Im Laufe der Zeit,“ fuhr er dann fort, „sind manche Ideale, die im Jahre 1848 erträumt wurden, verloren gegangen, manche Enttäuschungen mußten verwunden werden. Der Malkasten hat alle Stürme glücklich überstanden und unerschüttert festgehalten an seinem Wahlspruch und seiner Fahne.“
So ist denn auch in seiner Entwicklungsgeschichte ein stetes Emporblühen zu immer prächtigerer Entfaltung zu beobachten. Von hervorragender Bedeutung in diesem Verlauf ist die Erwerbung seines jetzigen eigenen Hauses. In den ersten Jahren seines Bestehens hatte er ein zwar sorglos gemüthliches, aber doch ziemlich fragwürdiges Dasein geführt, indem er als Miether in verschiedenen Gastlokalen Unterkunft suchte. Da, in der Mitte der fünfziger Jahre, wurde ihm vom Schicksal die Gunst zutheil, ohne viel Mühe die bekannte ehemals Jacobische Besitzung in Pempelfort als Eigenthum erwerben zu können.
Eine Klippe, die sich anfangs noch drohend zeigte, wurde bald glücklich umsteuert. Der Verein mußte nämlich, um den Besitz antreten zu können, sich Körperschaftsrechte verschaffen. Das zu diesem Zweck eingereichte Gesuch fand aber bei der Regierung eine wenig günstige Aufnahme. War doch in den reaktionären Jahren der Demokratenriecherei die sich so ungebunden bewegende Künstlergesellschaft in den Geruch eines höchst gefährlichen Verschwörernestes gekommen! Leute von der verfänglichen Färbung eines Freiligrath hatten hier als Stammgäste verkehrt; ja man wollte sogar in dem Wappenthier des „Malkastens“, einem Adler, der in den Krallen ein Bierseidel und einen Hausschlüssel trägt, ein [854] frevelhaft karikiertes preußisches Wappen aufstöbern! Als aber bei näherer Erkundigung die befriedigendsten Aufschlüsse über die scheinbar so hochverrätherischen Respektlosigkeiten gegeben werden konnten und es sich herausstellte, daß in der sich harmlos vergnügenden Künstlervereinigung nicht eine Spur von Blutdurst, Tyrannenhaß und Umsturzplänen zu finden sei, da wurde das eingereichte Gesuch nicht länger beanstandet.
In jener reizenden Parkanlage mit ihren mächtigen Baumgruppen, ihren stillanmuthigen Teichpartien, ihren lauschigen Plätzchen im Gebüsch oder am Wasserfall, in dem die muntere Düssel über Steingerölle stürzt – wie dies alles schon Goethe als Gastfreund Jacobis in „Wahrheit und Dichtung^ so begeistert geschildert – dort wurde nun ein echtes Künstlerhaus erbaut. Bald bethätigte sich natürlich auch immer lebhafter die Lust, das eigene Heim in würdiger Welse auszuschmücken. Dekorative Wandgemälde von Leutze und Ad. Schmitz, „Albrecht Dürers Huldigung“ darstellend, zierten den Speisesaal; im Laufe der Jahre kam eine ganze Reihe neuer Bilder von Kröner, Fahrbach, Simmler, von Gebhardt, Volkhart u. a. hinzu, die in harmonischem Zusammenwirken mit schweren Rüstungen, seltenen Trophäen und anderen Schmuckgegenständen dem großen Festsaal eine machtvolle Wirkung verleihen. Und hatte schon bisher der „Malkasten“ den Ruf genossen, daß er es verstehe, die heitersten, schönsten Künstlerfeste zu feiern, so wußte er von jetzt ab, da ihm ein so herrliches Eigenthum zu Gebote stand, sich in der Eigenschaft als Festgeber weit und breit einen hervorragenden Namen zu erwerben. Bei solchen Gelegenheiten werden in der Regel selbst dieses Hauses Wände zu enge, und mit Bedauern sieht sich dann der Einladende genöthigt, seiner Gastfreundschaft Grenzen zu setzen. Günstiger sind in dieser Beziehung die Sommerfeste gestellt, weil der Park räumlich eine bedeutende Ausdehnung hat, und sie gestalten sich denn auch gewöhnlich zu Festlichkeiten, wie sie so abwechslungsreich und farbenprächtig eben nur die sprudelnde Künstlerlaune ins Leben zu rufen weiß.
Unter den bisherigen Veranstaltungen gebührt unstreitig die Krone dem großartigen Kaiserfest im Jahre 1877, wo der „Malkasten“ den glorreichen Gründer des Deutschen Reiches in seinem Heim begrüßen durfte, wo alle Künste sich vereinten um jenen unvergeßlichen Abend zu einer des Gastes wie des Gastgebers würdigen Huldigungsfeier zu erheben. Damals erhielt das „Achtundvierziger Kind“ seine Weihe; in der ganzen Welt wurde sein Name bewundernd genannt, und mit besonderem Stolz wurde als ehrenvollster Schmuck der anerkennende Dankesbrief des greisen Monarchen an der Wand des Hauptsaals angebracht.
Die Hauptleiter des Festes, W. Camphausen und C. Hoff, wurden dem „Malkasten“ leider zu früh entrissen; unter ihrem thatkräftigen Wirken hat er eine hohe Blüthe erreicht.
Gewissermaßen ein Familienfest, das meist nur die Mitglieder in engstem Kreise zusammenführt, bringt alljährlich der Lenz, dessen triumphierenden Einzug der „Malkasten“ durch eine Riesen-Maibowle feiert. Mitten in ein solches Frühlingsfest hinein versetzt uns der Zeichner unseres Bildes. Da lagert im Hintergrunde, den Eintretenden heiter bewillkommnend, laubumkränzt und mit dem Wahrzeichen des „Malkastens“ geschmückt, das große Vereinsfaß, unter dem sich die inhaltvolle Bowle befindet. An dieser, deren stattliches Bäuchlein eine schier unerschöpfliche Menge des edlen Rebensaftes faßt, sehen wir O. Erdmann unter der bewährten Beihilfe des behäbigen Kellermeisters noch in voller Thätigkeit, den Labetrunk für all die durstigen Kehlen in ausreichendem Maße zu brauen. Im ganzen Saale aber sprudelt unerschöpfliche Heiterkeit. Alt und jung mischt sich in buntem Durcheinander. Die ältesten Malkästner, die einst schon an der Wiege des jetzt so blühend emporgewachsenen Sprößlings gestanden haben, werden wieder jung in diesem frischen fröhlichen Kreise.
Da leuchtet vor allem der geistvolle Kopf des Führers der Düsseldorfer Landschafterschule, Andreas Achenbachs, hervor; auch um den „Malkasten“ hat er sich glänzende Verdienste erworben, denn seinem entschlossenen Eingreifen ist es in erster Linie zu danken, daß der Ankauf der Jacobischen Besitzung möglich wurde. Der Verein bewies denn auch seine Dankbarkeit gegen den edlen Wohlthäter bei Gelegenheit seines siebzigsten Geburtstages, indem er ihn zu seinem Ehrenmitgliede ernannte und ihm eine Jubelfeier veranstaltete, wie sie wohl selten einem Künstler zutheil geworden ist.
An seiner Seite erblickt man den Altmeister der Düsseldorfer Genremalerei, Benjamin Vautier, dessen liebenswürdiger Humor schon so manches Herz gefangen genommen hat. Links von ihm steht der Schlachtenmaler E. Hünten, weiterhin erkennen wir Oswald, den jüngeren Achenbach, den Meister in der packenden Darstellung italienischen Lebens; neben ihm Chr. Kröer, der den deutschen Wald und seine flinkfüßigen Bewohner verherrlicht. Ihnen reihen sich der Historienmaler Albert Baur und der Landschaftsmaler G. Oeder an, sowie die jüngeren Malkästner Carl Gehrts, Th. Rocholl, Jacobus Leisten, Joh. Gehrts, F. Montan, A. Frenz, F. Brütt, Volkhart, Jutz, H. Otto, Schnitzler, F. Vezin, A. Lins und viele andere. Ja, wer nennt die Namen all in dem malerischen Gewirr!
Am Klavier sitzt der Humorist Fritz Sonderland, dessen muntere Laune in scherzhaften musikalischen Leistungen sich ausströmt. Und hat er sein Spiel unter jubelndem Beifall geendet, so ertönen von der Veranda her die allen vertrauten Klänge des Malkastenmarsches, einer Komposition von Jul. Tausch, welche, in Liedform übertragen, von der Künstlerliedertafel unter Musikdirektor H. Willemsens sicherer Leitung zum Vortrag gebracht wird.
Da erschallt aus den Reihen der Ruf: „Op der Bühn!“, eine Zauberformel von unfehlbarer Wirkung. Der Vorhang hebt sich und eine flott improvisierte Aufführung auf der Bühne führt die Stimmung zum Gipfel der Heiterkeit. Diesen Vorgang hat schon der wackere Chronist, der verstorbene Meister Wilh. Camphausen, in seiner „Chronica de rebus Malcastaniensibus“ mit den ergötzlichen Versen geschildert.
Und sind wir des Berathens müde,
Treibt gleich die Narrheit neue Blüthe
In einem lust’gen Bummelstück.
Da lacht der Schalk aus jeder Ritze
Mit Pritschenschlag und Schellenmütze
Und lose Schelmerei im Blick.
So zeigt sich denn der „Malkasten“ als ein ergiebiger Boden für eine zwanglose, echt künstlerische Fröhlichkeit, die nach ernstem Schaffen eine anregende erfrischende Erholung bietet. Und mancher launige Funke, der uns aus Bildern der Düsseldorf Meister entgegenblitzt – er wäre wohl ungeboren geblieben ohne den „Malkasten“ und seine Feste.
[855]
Alle Rechte vorbehalten.
Im Ballon.
Es ist zehn Uhr vormittags. Eine leichte Brise läßt den Ballon sachte sich hin und her wiegen. Am Himmel zeigen sich vereinzelte Haufenwolken in verschiedenen Größen. Kein bewunderndes Publikum steht schaulustig um uns herum, kein Musiktusch wird unsere Abfahrt verherrlichen; nur die wenigen Freunde, welche uns behilflich sind, werden uns vielleicht mit neidischen Blicken nachsehen. Wozu auch eine Bewunderung? Wir fühlen uns wegen der beabsichtigten Fahrt keineswegs als Helden, die einer großen That entgegengehen.
Die Hülle unseres Ballons ist von erprobter Festigkeit und sorgfältig gedichtet, das Netzwerk ist aus den besten Leinen, der Korb dauerhaft und den Anstrengungen einer Schleppfahrt gewachsen, das Ventil schließt nach dem Gebrauch wieder vollkommen ab. Auf die Mitnahme eines Ankers haben wir verzichtet und dafür unseren Korb mit einem 100 Meter langen und zwei Finger starken rauhen Gleitseil ausgerüstet. Ein solches Tau schmiegt sich überall dem Boden an, ob hart oder weich, bedeckt oder unbedeckt, und bringt, wenn es in seiner vollen Länge auf der Erde liegt, den Ballon noch bei einer Windstärke zum Halten, bei welcher ein Anker, gleichviel von welcher Art, in großen Sätzen wie toll hinter dem Ballon herkollert. Für besonders windiges Wetter besitzt unser Ballon eine Zerreißvorrichtung, durch welche wir imstande sind, vom Korbe aus die Hülle von oben bis unten aufzureißen. Durch den Riß entströmt das Gas mit großer Schnelligkeit, und der Ballon, der, kurz vorher zu einem mächtigen Segel aufgebauscht, den Korb nebst seinen Insassen unbarmherzig durch dick und dünn schleppte, liegt in 3 bis 4 Sekunden entleert auf dem Boden. Die Tagesarbeit einer fleißigen Näherin heilt die klaffende Wunde wieder vollkommen.
Mit der Ausrüstung unseres Ballons sind wir fertig. Wir nehmen in dem Korbe Platz. Jetzt geht es noch an ein Hauptgeschäft vor der eigentlichen Abfahrt, an das sogenannte Abwägen unseres Fahrzeuges, d. h., es wird der Korb soweit entlastet, daß der Ballon ganz wenig Auftrieb zeigt; es geschieht dies, um über die Menge des mitzunehmenden Ballastes Aufschluß zu bekommen.
Bei ruhiger Luft macht das Abwägen nicht die geringste Schwierigkeit. Bei Wind dagegen ist es infolge des seitlichen Winddruckes sehr zeitraubend und ungenau. Doch alles nimmt ein Ende, auch das Abwägen!
Auf „Los!“ lassen unsere Freunde den Korbrand aus den Händen, und der Ballon, der eben noch unruhig an den Korbstricken gezerrt hat, steht kerzengerade über der Gondel. Vollkommene Ruhe ist um uns eingetreten; nicht die geringste Spur einer Bewegung macht sich uns bemerkbar. Nur unsere Gehilfen bei der Abfahrt und mit ihnen der Erdboden versinken unter uns. Die Aussicht wird weiter. Jetzt sehen wir in die Nachbargärten, jetzt in die Straßen der Stadt, nun auf die nächsten Dörfer, den weitgestreckten Wald, ja schon über diesen hinaus auf die hellglänzende Fläche des Sees, und nur das Hügelland jenseit desselben begrenzt noch auf eine kleine Weile unseren Ausblick.
Wir treiben langsam nach Westen. Bald erblicken wir auch in der Ferne das Silberband des breiten Stromes. Hinter uns liegt die Stadt mit ihren rauchenden Essen und dem dunklen Gewimmel von Menschen und Wagen auf den Plätzen und in den Straßen; dort unten breiten sich die mannigfach gefärbten Felder aus, dazwischen ziehen hellschimmernde Straßen und Wege. Der kleine Teich, über den wir eben hinwegtreiben, scheint gar kein Wasser zu haben, so klar sehen wir das Bild seines Grundes. Auf der leichtgekrümmten Eisenbahnlinie strebt ein langer Güterzug hinaus ins Freie. Deutlich klingt das Rollen seiner Räder und jetzt ein kurzer Pfiff seiner Maschine zu uns herauf.
„Ein Ballon! Ein Ballon!“ hört man drüben in dem kleinen Dorfe die Kinder schreien, dazu schnattern die Gänse und bellen die Hunde.
Das Barometer zeigt 700 Meter Höhe, und da es in dieser Stellung auch fernerhin bleibt, so haben wir ein sicheres Zeichen, daß unser Ballon seine Gleichgewichtslage erreicht hat.
Es vergeht einige Zeit. Aber während wir in das schon so oft gesehene Schauspiel unter unseren Füßen von neuem versunken sind, lehrt uns ein zufälliger Blick auf das Barometer, daß die Nadel desselben ihre vorige Stellung nicht mehr innehat, sie zeigt kaum mehr 500 Meter. Kein Zweifel, wir fallen. Wir werfen Sand aus, zuerst nicht viel, 1 bis 2 Kilogramm; da diese Menge aber nicht die gewünschte Wirkung hervorruft, erhöhen wir die Ballastausgabe auf 8 Kilogramm; jetzt hält das Barometer still, nun kehrt es langsam auf seinen früheren Stand bei 700 Metern zurück und geht hierauf noch um 100 Meter darüber hinaus. Da in demselben Augenblick auch die Sonne, welche uns für einige Minuten durch eine dichte Wolke entzogen war, unseren Ballon wieder erwärmt, so ist ein erneutes Fallen vorläufig nicht zu befürchten. Wir haben Muße, über das soeben stattgehabte Sinken unseres Fahrzeuges sowie über die senkrechten Bewegungen eines Ballons überhaupt uns Rechenschaft zu geben.
Nehmen wir an, wir hätten bei der Abfahrt unseren Ballon vollkommen genau abwägen können und hätten dann 10 Kilogramm Sand ausgeworfen. Wie hoch wäre der Ballon, dessen Kugel einen Inhalt von 1500 Kubikmetern besitzt, gestiegen? So hoch, bis er in eine Luftschicht kommt, in welcher die von ihm verdrängten 1500 Kubikmeter Luft um 10 Kilogramm weniger wiegen als unten am Boden. Die Luft ist ja nicht überall gleich dicht, sondern die unteren Schichten werden durch die oberen zusammengepreßt, nehmen also auch an Gewicht zu. Je höher nun der Ballon steigt, um so geringer wird das Gewicht der von ihm verdrängten 1500 Kubikmeter Luft, er wird also nicht bis an die Grenze des Luftmeeres empordringen, sondern nur soweit steigen, bis er in eine Schicht kommt, in welcher die verdrängte Luftmasse um so viel weniger wiegt, als er vorher entlastet worden ist. In unserem Falle wären wir auf ungefähr 150 Meter über den Boden emporgestiegen; denn hier wiegen 1500 Kubikmeter Luft um 10 Kilogramm weniger als die gleiche Masse auf dem Boden.
Wie geht nun das Steigen selbst vor sich? Entflieht der Ballon rasch in die Höhe? Prellt er nicht infolge dieser Schnelligkeit über die Grenze hinaus, in welcher er seine Gleichgewichtslage wieder erhalten sollte?
Im allgemeinen kann man sagen, daß die senkrechten Bewegungen des Ballons sowohl auf- wie abwärts nie sehr rasch werden können. Leute, welche einen Ballon pfeilschnell steigen oder fallen gesehen haben wollen, haben sich, vorausgesetzt, daß der Ballon in letzterem Falle nicht beschädigt war, getäuscht oder nahmen eben einen sehr langsamen Pfeil zum Vergleich. Wird die Belastung eines Ballons vermindert, so leitet dieser sofort die Aufwärtsbewegung ein; dieselbe nimmt stetig an Raschheit zu, bis der Luftwiderstand, welcher beim Steigen von oben her auf den Ballon wirkt, so groß ist wie der durch den ausgeworfenen Ballast hervorgerufene Auftrieb. Es ist leicht ersichtlich, daß für die Stärke dieses Luftwiderstands das größere oder kleinere Maß, das der Querschnitt des Ballons aufweist, von wesentlicher Bedeutung ist. Bei einer plötzlichen Erleichterung um 80 Kilogramm – das Gewicht eines Menschen – würde unser Ballon mit seinem Querschnitt von 150 Quadratmetern immerhin erst eine größte Geschwindigkeit von 4 Metern in der Sekunde nach aufwärts erhalten.
Diese größte Geschwindigkeit, welche ein Ballon infolge von Entlastung erlangt, erreicht er sehr bald. Aber trotz dieser kurzen Zeit ist er währenddessen bereits in eine leichtere Luftschicht eingetreten; er besitzt also schon nicht mehr den anfänglichen Auftrieb, seine Bewegung wird wieder langsamer, und diese Erscheinung geht so fort, bis er seine neue Gleichgewichtslage erreicht, in welchem Augenblick auch seine Schnelligkeit gleich Null wird. Es ist also einleuchtend, daß ein Hinausprellen des Ballons über die Gleichgewichtslage nicht stattfinden kann.
Während des Steigens dehnt sich das Gas in dem Ballon aus infolge des geringer werdenden Luftdruckes, ähnlich einem Gummiball, welcher, vorher in der Hand fest zusammengedrückt, sich vergrößert, wenn wir mit dem Drucke nachlassen. Da aber der Ballon schon bei der Abfahrt auf dem Erdboden vollständig gefüllt war, so würde das Gas bei längerem Steigen die Hülle [856] zersprengen, um ins Freie zu gelangen. Die untere Oeffnung des Ballons, durch welche derselbe auch gefüllt wurde, bleibt daher stets offen, damit das an Raum wachsende Gas ausströmen kann. Wir riechen auch das Gas in der Gondel, und dieser Umstand ist das sicherste Zeichen, daß wir nach aufwärts streben.
Bei einem länger dauernden raschen Steigen kann der nach abwärts in den Korb gerichtete Gasstrom für die Insassen gefährlich werden. Nur darin ist die Ursache der Opfer an Menschenleben zu suchen, welche wissenschaftliche oder andere Hochfahrten gefordert haben. Durch das entgegenkommende Gas wurden die kühnen Reisenden vergiftet und betäubt, trotz der vorsorglichen Mitnahme von Sauerstoff, dessen spärlicheres Vorhandensein in größeren Höhen man früher als die Hauptgefahr bei Hochfahrten ansah. Man darf demnach die beabsichtigte Strecke nach aufwärts nicht auf einmal zurücklegen, sondern muß zeitweise entsprechende Pausen einlegen, in welchen sich die Athmungsorgane wieder durch frische, gute Luft erholen können.
Bisher haben wir das Verhalten eines Ballons betrachtet, welcher prall gefüllt ist. Etwas verschieden hiervon sind die Bewegungen, wenn die Ballonhülle aus irgend einem Grunde nicht mehr vollständig mit Gas gefüllt ist, ein Fall, welcher bei jeder Ballonfahrt eintritt, wie wir weiter unten näher sehen werden.
Nehmen wir an, unserem Ballon von 1500 Kubikmetern Inhalt fehlen noch 50 Kubikmeter an einer vollständigen Füllung, und wir entlasten ihn um 10 Kilogramm. Er steigt nun fürs erste so hoch, bis das sich ausdehnende Gas die Hülle vollkommen ausfüllt, dann erhebt er sich noch soweit, bis die nun prall gewordene Hülle eine Luftmasse verdrängt, welche um 10 Kilogramm leichter ist als die gleiche Luftmenge in jener Höhe, in welcher der Ballon prall geworden war.
Woher kommt nun diese Erscheinung?
Nachdem wir, wohlgemerkt in diesem Falle nicht mit 1500 Kubikmetern, sondern nur mit 1450 Kubikmetern Gas wegfuhren, seien wir beispielsweise auf 150 Meter angelangt, in einer Höhe, in welcher jener prall gefüllte Ballon, wie wir gesehen haben, bereits sein Gleichgewicht erreicht hat. Nun ist allerdings auch unser jetziger Ballon in eine dünnere Luftschicht gekommen und das Gas hat im allgemeinen an Tragkraft verloren, allein eben infolge der dünneren Luft hat sich das Gas ausgedehnt und füllt nun die Hülle allmählich aus, bleibt also dem Ballon erhalten, während es im ersteren Falle aus der unteren Oeffnung abfloß. Es nimmt also die Tragkraft des Gases an und für sich ab, allein die Gasmasse im Ballon nimmt an Ausdehnung zu, und wenn wir mit Zahlen nachrechnen wollten, würden wir finden, daß unser Ballon auch auf 150 Meter immer noch 10 Kilogramm Auftrieb besitzt wie unten bei der Abfahrt, und so fort bis auf 300 Meter, wo er dann ganz ausgefüllt ist. Bis hierher ist auch die Geschwindigkeit nach aufwärts eine gleichbleibende, entsprechend der stetigen Größe des Auftriebes von 10 Kilogramm. Erst von hier ab zeigt der Ballon bis 420 Meter dasselbe Verhalten wie jener Ballon, der mit praller Hülle von der Erde abfuhr.
Und nun noch einige Worte über das Fallen des Ballons.
Wir haben gesehen, daß der Ballon sich in seiner Gleichgewichtslage befindet, wenn er sich nicht mehr nach aufwärts bewegt. Sobald nun der Auftrieb sich verringert, so sinkt der Ballon nach abwärts. Eine Auftriebsverminderung tritt in den weitaus meisten Fällen durch Abkühlung des Gases ein; infolge von Erniedrigung der Temperatur zieht sich das Gas zusammen, wird schwerer als im wärmeren Zustande. Eine solche Temperaturerniedrigung ist sehr häufig, und sie entsteht gewöhnlich dadurch, daß eine Wolke den Ballon beschattet, während er vorher von der Sonne beschienen war, oder dadurch, daß er aus einer tieferen und wärmeren Luftschicht in eine höhere und kältere eintritt.
Wenn nun der Ballon aus irgend einem Grunde, sagen wir um 5 Kilogramm, an Auftrieb verliert und zu sinken beginnt, so sollte man meinen, er müßte auch nach unten eine Gleichgewichtsgrenze finden; denn die Luft wird ja nach unten zu immer dichter; allein wenn man nachrechnet, so findet man, daß der Ballon, wenn er z. B. um 200 Meter gefallen ist, allerdings sich in einer Luftschicht befindet, welche schon so dicht ist, daß die Auftriebsminderung von 5 Kilogramm längst ausgeglichen sein müßte; allein die Gasmasse in der Hülle ist durch die dichter werdende Luft ebenfalls entsprechend zusammengedrückt worden, und wir dürfen jetzt nicht mehr mit 1500 Kubikmeter Gas rechnen, sondern mit weniger, so daß die Rechnung ergiebt, daß der Ballon, auch wenn er um 200 Meter herabgesunken ist, immer noch einen Auftriebsverlust von 5 Kilogramm zeigt wie in den früheren oberen Schichten. Er wird demnach immer tiefer sinken, bis er endlich den Boden erreicht. Dabei ist es gleichgültig, ob der Ballon um 1 Gramm oder um 10 Kilogramm an Auftrieb verloren hat; sobald er durch Auftriebsverlust ins Sinken kommt, fällt er unter normalen Verhältnissen bis auf die Erde. Nun ist auch der unangenehme Einfluß selbst der geringsten Abkühlung leicht zu erklären.
Was die Schnelligkeit betrifft, mit welcher diese Abwärtsbewegung vor sich geht, so ist dieselbe natürlich verschieden und richtet sich nach dem Verlust an Auftrieb. Doch hat sie noch ihre weiteren Eigenthümlichkeiten. Sie ist nämlich weder gleichmäßig, noch wird sie ähnlich der freien Fallbewegung gleichmäßig beschleunigt, sondern sie wächst zeitweise sogar über die Größe hinaus, welche der Auftriebsminderung entsprechen würde, nimmt aber dann wieder rasch ab, um von neuem anzuwachsen und so fort in stetem Wechsel. Es möge hierbei bemerkt werden, daß die größte Fallgeschwindigkeit unseres Ballons von 1500 Kubikmetern Inhalt, wenn wir denselben, ohne das Ventil zu ziehen, sich selbst überlassen, 4 Meter in der Sekunde nicht übersteigt, so daß wir, auch wenn der Ballon gerade im Maximum des Fallens die Erde erreichte, doch keinen stärkeren Stoß erleiden würden, als wenn wir von einem Stuhle herabsprängen.
Näher auf diese Erscheinung einzugehen, würde hier zu weit führen.
Und nun nach dieser etwas trockenen Abschweifung zurück zu unserer Fahrt.
Der Ballon hatte also zu fallen begonnen, worüber uns das Barometer belehrte; durch Auswerfen von 8 Kilogramm Sand haben wir den Ballon veranlaßt, nicht nur seine frühere Höhe von 700 Metern wieder zu ersteigen, sondern auch, entsprechend dem verausgabten Ballaste, noch um 100 Meter darüber hinauszugehen, so daß wir jetzt auf 800 Meter über dem Erdboden dahintreiben.
Diese Aufwärtsbewegungen des Ballons waren am Barometer unmittelbar abzulesen; indessen zeigt dieses ein Fallen oder Steigen nicht sofort an, und es ist deshalb angenehm, daß es noch andere Mittel giebt, mit deren Hilfe man den Eintritt oder das Vorhandensein einer Vertikalbewegung sofort erkennen kann. Ein sehr gutes Merkmal hat der Ballonfahrer an sich selbst. Sobald man nach abwärts die Höhe ändert, fühlt man einen schwachen, aber deutlichen Druck auf das Trommelfell, hervorgerufen durch den Ueberdruck der äußeren dichteren Luftschicht, während im Innern des Körpers noch die geringere Spannung der höheren Region anhält. Ein weiteres Anzeichen für eine Auf- oder Abwärtsbewegung bildet ein schwacher Luftzug in entgegengesetzter Richtung. Solange nämlich der Ballon die gleiche Höhenlage beibehält, macht sich nicht die geringste Luftbewegung bemerkbar, selbst wenn er mit dem schnellsten Sturmwind dahin treibt, da er dieselbe Geschwindigkeit wie die ihn umgebende Luft besitzt. Bewegt sich dagegen der Ballon in senkrechter Richtung, so wird sofort beim Fallen ein schwacher Luftzug von unten und beim Steigen ein solcher von oben fühlbar. Um nun diese Luftbewegung sofort deutlich wahrnehmen zu können, bringt man außen an dem Korbe mehrere Meter lange und kaum fingerbreite Streifen aus recht leichtem Papier an. Solange der Ballon die Höhe nicht verändert, hängen diese Streifen regungslos nach abwärts, nur durch ihre Struktur leicht gekrümmt; steigt er, so beginnen die Bänder zu zittern und strecken sich gleichzeitig in die Länge; macht er aber Miene, zu fallen, so wird das Zittern noch stärker, die Streifen krümmen sich immer mehr, nähern sich allmählich mit ihrem unteren Ende dem Korbrande und flattern schließlich lustig in die Höhe. Gewöhnlich ist jetzt erst das Fallen am Barometer bemerkbar. Diese Papierstreifen sind also ein ebenso einfaches wie feinfühliges Instrument.
Während wir nun im Vertrauen auf unsere ruhig hinabhängenden Papierschwänze mit Muße das unter uns wegziehende Gelände betrachten, kommt es uns vor, als rücke der breite Strom, dem wir eben zutreiben, mit seinen waldigen Ufern immer näher zu uns herauf, auch einzelne Häuser und Baumgruppen, welche gerade unter uns liegen, werden scheinbar immer größer und deutlicher. Ein Blick auf das Barometer läßt keinen Zweifel: wir fallen und haben
[857][858] uns dem Boden schon bis auf 400 Meter genähert. Wenn wir also kein unfreiwilliges Bad nehmen wollen, müssen wir Sand auswerfen. Wir thun es, zuerst 5 Kilogramm – keine Wirkung; nochmals 5 Kilogramm – wieder umsonst! Endlich nach weiterer Verausgabung von 15 Kilogramm bleibt das Barometer stehen, auch unsere treulosen Verräther, die Papierstreifen, strecken sich, ein ganz schwacher Luftzug macht von oben sich bemerkbar: wir steigen! Wir erreichen unsere vorige Höhe von 800 Metern und gehen noch weitere 200 Meter darüber hinaus. In einer Höhe von 1000 Metern über dem Boden treiben wir über den Strom und haben bei dem günstigen Winde bald das andere Ufer erreicht. Was war nun geschehen?
Alle kühlen Stellen der Erdoberfläche, wie feuchte Wälder, sumpfige Strecken, Flüsse, Seen u. s. w., erniedrigen auch die Temperatur der darüber befindlichen Luft. Die dadurch schwer gewordene Luftschicht sinkt nach abwärts, von oben strömen neue noch warme Luftmassen hinzu, welche das gleiche Schicksal erleiden. So entsteht über den genannten Geländestrecken eine starke Luftströmung, welche von oben gegen die Wasserfläche gerichtet ist. In einen solchen Wirbel ist auch unser Ballon gerathen, und wir verstehen jetzt, warum die Papierstreifen nicht nach aufwärts geflattert sind, wie sie es doch bei einem Fallen des Ballons thun sollten. Der Ballon ist eben mit der gesammten, ihn umgebenden Luftmasse nach abwärts gezogen worden, hat also zu dieser selbst seinen Ort nicht verändert.
Je größer nun die abkühlende Fläche oder auch je geringer die Geschwindigkeit der darüber hintreibenden Luft ist, in desto größere Höhen hinauf machen sich jene Wirbel bemerkbar. Hätten wir uns in einer Höhe von etwa 1000 Metern dem Flusse genähert oder hätten wir noch stärkeren Wind gehabt, so hätten wir wohl gar nichts von der Anziehungskraft des Stromes bemerkt. Sollten wir nun wieder in den Bereich einer derartigen Fläche kommen, so werden wir unsere Augen unverwandt auf das Barometer richten, um sofort einem Fallen des Ballons entgegenwirken zu können. Vorläufig haben wir aber weder große Waldstrecken noch ausgedehntere Gewässer zu befürchten.
Wir treiben auf das industriereiche M. zu. Schon tönt deutlich das Getöse des lebendigen Verkehrs zu uns herauf; grell von der Sonne beschienen liegen die Häuser und Fabriken zu unseren Füßen, wie Ameisen wimmeln die Tausende von Fußgängern auf Straßen und Plätzen. Doch kaum befinden wir uns über der eigentlichen Stadt, so nimmt unsere bisher ziemlich rasche Vorwärtsbewegung auf einmal sehr merklich ab. Es vergeht geraume Zeit, bis wir über eine Straße oder Häusergruppe hinweggekrochen sind. Als wollten sie ihr früheres Versehen wieder gut machen, flattern die Papierstreifen lustig immer höher und höher: eine recht angenehme Aussicht, inmitten einer zahlreichen Menschenmenge zu landen, ganz abgesehen von den vielen Telephon- und Telegraphendrähten, welche die Stadt nach allen Richtungen überziehen! Allein die Streifen täuschen uns zum zweiten Male, denn ein Blick auf das Barometer belehrt uns, daß wir ganz langsam, aber stetig steigen.
Diese Erscheinung hat nun folgenden Grund. Die Sonne, welche auf die zahllosen Dächer, auf die kahlen Straßen und Plätze hinabbrennt, erzeugt einen warmen und ziemlich heftigen Luftstrom nach aufwärts, und dieser stört die herrschende Windrichtung. Hätten wir nur die seitlichen Ränder der aufsteigenden Luftsäule berührt, so wären wir um dieselbe wie um einen Brückenpfeiler herumgetrieben worden; da wir aber gerade auf die Mitte der Säule zu hielten, so sind wir in das Innere derselben gelangt, und mit unserer Vorwärtsbewegung war es allmählich vorbei. Nur etwas nach aufwärts werden wir gehoben; da der Ballon dieser Bewegung weniger rasch nachkommt als die leichten Papierstreifen, so flattern uns dieselben voraus, mithin die gleiche Erscheinung, als wenn wir fallen würden.
Wir müssen trachten, uns dem Banne dieses großen Ofens zu entziehen. Wie leicht einzusehen, bleibt hierzu kein anderer Weg als nach oben hinaus. Wir werfen also so lange Ballast aus, bis wir in eine Höhe gelangen, in welcher sich der aufsteigende Luftstrom entsprechend abgekühlt hat, mithin die allgemeine Windrichtung wieder die Oberhand bekommt. Durch Verausgabung von 25 Kilogramm Sand gelingt unser Plan. Bei einer Höhe von 1300 Metern zeigt uns ein Blick auf die Erde, daß wir schneller und schneller über die Stadt hinwegtreiben und dieselbe bald hinter uns lassen.
Von unserer einsamen Höhe herab können wir schon nicht mehr unterscheiden, was auf dem Boden Hügel und Thal, was Ebene ist. Die ganze Gegend ist platt wie ein Brett, und nichts läßt die lachende Hügellandschaft mit dem reizenden tief eingeschnittenen Bachthal ahnen, welche uns schon manchen genußreichen Ausflug geboten hat.
Doch nicht lange bleiben wir einsam auf unserer Fahrt, es kommt Gesellschaft. Wir nähern uns dem eben genannten Thälchen. Ueber demselben ist eine mächtige Haufenwolke eben in der Bildung begriffen, und wenn wir so weiterfahren, treiben wir mitten in sie hinein. Das hätte ja weiter nichts zu sagen, denn so massig sie aus der Entfernung aussieht, so luftig und gehaltlos nimmt sie sich in ihrem Inneren aus. Allein in ihrem Inneren treiben starke Luftwirbel ihr Spiel, und diese werden oft so heftig, daß sich die Ballonfahrer fest in dem Korbe anklammern müssen, um nicht zu unsanft umhergeschleudert zu werden. Dazu würde der Ballon innerhalb der Wolke eine starke Abkühlung erleiden, und das Ende vom Liede wäre, daß wir der Mutter Erde sehr nahe kommen würden und nur durch abermalige Verausgabung einer erheblichen Menge des so werthvollen Sandes wieder höhere Regionen erreichen könnten.
In Anbetracht aller dieser Umstände verzichten wir auf eine nähere Besichtigung der immer näher kommenden Haufenwolke; durch Auswerfen von 5 Kilogramm Sand erheben wir uns über dieselbe, ohne in eine weitere Berührung mit ihr zu kommen; sie scheint unter uns weg zu treiben, während gleichzeitig der Ballon auf einmal mehr nach Norden umbiegt, eine Richtungsänderung, welche wir deutlich an dem Wege des Ballonschattens auf der Erde wahrnehmen können. Es ist kein Zweifel, wir sind in eine Luftschicht eingetreten, welche in einer anderen Richtung als die eben verlassene dahinströmt. Diese Erscheinung kann fast bei jeder Ballonfahrt beobachtet werden.
Das Barometer zeigt jetzt 1700 Meter Höhe.
In das eigentliche Gebiet der oberen Luftschicht sind wir noch nicht gelangt; denn ein Blick nach Norden lehrt uns, daß die dort befindliche, weit ausgedehnte Wolkendecke, von uns aus gesehen, sich mehr nach links hin bewegt und daß wir dieselbe bald über uns haben werden. Sobald dieser Fall eingetreten ist, müssen wir uns auf ein Sinken des Ballons gefaßt machen, da wir dadurch die Sonne verlieren werden und der Ballon sich abkühlen muß. Kaum beginnt auch die Sonne unseren Blicken zu entschwinden, so flattern schon die Papierstreifen lustig in die Höhe, Ohrendruck stellt sich ein, das Barometer verläßt die Marke 1700 Meter. Wir müssen 12 Kilogramm Ballast auswerfen, um dem Fallen Einhalt zu thun; auf 1900 Meter kommen wir ins Gleichgewicht. Wir sind nun kaum mehr als 200 Meter von dem unteren Wolkenrand entfernt. Da! ein leichtes Klatschen und Trommeln über unseren Köpfen! Es sind Regentropfen, welche auf die straffgespannte Hülle fallen. Wenn wir noch lange zögern, so wird unser Ballon bald so von Wasser beschwert sein, daß der noch vorhandene Ballast nicht mehr ausreichen wird, uns in der Höhe zu erhalten. Also Sand hinaus! Wir wollen versuchen, durch die Wolkendecke nach oben durchzudringen. 8 Kilogramm sind bereits ausgeworfen, schon umgeben uns leichte Schleier, fast wie Rauch. Jetzt wird der Nebel dichter und dichter, und bald ist es um uns wie an einem nebligen Novembermorgen in den Straßen der Stadt. Nicht einmal die Leinen, welche in einer Entfernung von 8 Metern vom Netze herabhängen, sind noch zu sehen. Es wird merklich kühler; also aufgepaßt, um einem erneuten Fallen des Ballons sofort entgegen treten zu können! Richtig! Wir sind noch keine Minute in der Wolke, und schon flattern unsere Papierstreifen nach aufwärts. Wir werfen 10 Kilogramm Sand hinaus, die Streifen senken sich und werden wieder ruhig. Noch einmal machen sie Miene, zu uns herauf zu kommen, doch mit einem weiteren Opfer von 5 Kilogramm lassen sie sich beschwichtigen. Nun scheint es heller um uns zu werden. In der That, der Nebel wird lichter; schon sehen wir den blauen Himmel über uns, wir selbst befinden uns aber noch in einem tief eingeschnittenen Thale der Wolkenmasse. Immer höher steigen wir. Jetzt begrüßt uns die Sonne von neuem. Welch ein Anblick! Soweit das Auge reicht, ein weites weites silberglänzendes Meer in majestätischer Ruhe, nur hie und da von kleinen dunkleren Inseln unterbrochen, scharf begrenzt am Horizont durch den tiefblauen, wolkenlosen Himmel, über uns die [859] Sonne mit mächtigem Glanze, rings um uns her eine heilige Stille! Wahrlich, man fühlt sich recht klein in solchen Augenblicken! Sogar unser lieber Freund, der sonst immer sofort mit einem schlechten Witze bei der Hand ist, schaut trunkenen Auges hinaus auf das göttliche Schauspiel.
So treiben wir fast eine ganze Stunde dahin, immer in der gleichen Höhe von 2500 Metern, ohne nur ein Korn Sand auswerfen zu müssen. Als endlich der Ballon leicht zu fallen beginnt, hindern wir ihn nicht daran. Wir hätten zwar noch Ballast genug, um noch einige Zeit fahren zu können; allein da uns jeder Ausblick auf die Erde versperrt ist, so müssen wir uns nach dem Austreten aus den Wolken noch auf einige kleine Ueberraschungen bei der Landung gefaßt machen. Deshalb ist es immerhin vortheilhaft, mit möglichst viel Ballast im Korbe zum Landen zu schreiten.
Schon ist der Korb wieder in die Wolken eingetaucht; da erhebt sich der Ballon von neuem und schwimmt über eine Nebelbank hinüber, um dann wieder auf die Wolkendecke herabzusinken und zum zweiten Male in die Höhe zu gehen. Die Sonne hat eben den Ballon bedeutend erwärmt; wenn sich derselbe dem Anschein nach auch in der freien Luft nicht mehr halten kann, in der kälteren Wolkenschicht hat er doch noch zuviel Auftrieb, um durch dieselbe hindurchzusinken. Wenn wir nicht abwarten wollen, bis er sich soweit abgekühlt hat, daß er durch die Nebelmasse hindurchfällt, so müssen wir das Ventil öffnen und etwas Gas herauslassen. Wir thun dies auf die Dauer von 10 Sekunden. Jetzt versinken wir wirklich in die graue Masse. Das gleiche Bild wie vor einer Stunde! Doch erscheint uns nach all dem Glanze über den Wolken der dichte Nebel noch düsterer und undurchdringlicher als bei der vorigen Durchfahrt. Neugierig schauen wir nach unten, ob nicht bald die Erde sichtbar wird. Schon bemerkt man dunkle Flecken durch den Nebel hindurch, anscheinend kleine Waldparzellen. Jetzt wird der Ausblick klarer: wir erkennen einzelne Dörfer, kleine Wasserlinien, gleichzeitig eine Eisenbahn, welche in großen Windungen durch das Gefilde zieht. Wo sind wir? Ja, wer das sagen könnte! Wenn uns die Gegend nicht schon zufällig bekannt ist oder so auffällige Punkte zeigt, daß man dieselben nach der Karte erkennen kann wie z. B. bedeutendere Wasserläufe, größere Städte, Eisenbahnknotenpunkte etc., so ist nichts herauszubringen. In unserem Falle hat aber auch die Frage, wo wir sind, weniger Bedeutung, als die: eignet sich die Gegend unter uns zur Landung?
Nun, darüber können wir uns beruhigen. Es sind wohl kleinere Wälder, einzelne Bauernhöfe, auch Dörfer zahlreich über das Gelände hingestreut, aber dazwischen ist überall noch genügend freier Raum.
Da wir uns noch auf 1500 Meter Höhe befinden, so lassen wir unsern Ballon weiter fallen, ohne einen ganz bestimmten Landungspunkt ins Auge zu fassen; nur das nehmen wir uns vor, noch diesseit eines etwa 4 Kilometer entfernten Flüßchens zu landen; und erst wenn wir uns auf 500 bis 600 Meter dem Boden genähert haben, suchen wir uns einen bestimmten Platz heraus.
Aufmerksam betrachten wir die Erde. Jetzt befinden wir uns noch 1000 Meter von ihr entfernt und treiben gerade über ein ausgedehntes Waldstück, dann kommt ein kleiner Bauernhof, und hieran schließen sich abgemähte Getreidefelder und Wiesen bis zu jenem Flüßchen, nur unterbrochen von einzelnen Büschen, also ein recht annehmbares Landungsgebiet. Aber ohne eine kleine Ueberraschung sollte es doch nicht abgehen, denn während wir bis jetzt die Richtung nach Norden einhielten, schwenkt auf einmal unser Ballon und treibt in derselben Richtung weiter, welche wir schon heute morgen beim Abfahren hatten; der Unterwind hat also seine Richtung bis jetzt beibehalten. Ueber die Bewegungsrichtung der unteren Luftschichten hätten wir uns allerdings gleich nach dem Austreten aus den Wolken leicht überzeugen können, wenn wir ein großes Blatt Papier hätten vorausflattern lassen. Diese Versäumniß ist jetzt nur noch auf eine kleinere Entfernung nachzuholen. Wir beeilen uns, dies zu thun; je weiter das Blatt sinkt, um so strenger hält es sich in der bereits erkannten Richtung.
Nach Westen zu ist die Sache schon etwas verwickelter. Denn gerade vor uns in der neuen Bahn legt sich ein nicht besonders breiter, aber weit nach rechts und links sich hinziehender Waldstreifen vor. Das Barometer zeigt noch 600 Meter. Von dem Gehölz sind wir noch etwa 1 Kilometer entfernt. Entweder müssen wir durch Ventilziehen noch vor dem Walde herunter oder wir hemmen durch Ballastauswerfen den Fall des Ballons und trachten über das Gehölz hinüberzukommen. Zu langem Ueberlegen ist keine Zeit. Der Wind wird immer stärker, das Barometer steht auf 400 Meter. Da! eine neue Ueberraschung! Das 100 Meter lange Gleitseil schleift bereits mit seinem Ende auf dem Boden! Wir landen also in einer Gegend, die um 300 Meter höher liegt als unsere Abfahrtsstelle. Darum ist uns auch gegenüber den Barometerangaben der letzten Viertelstunde der Erdboden unverhältnißmäßig nahe erschienen! Gleichzeitig erweist sich die vermeintliche Wiese vor dem Walde als ein überschwemmtes und sumpfiges Gelände. An ein Landen vor dem Walde ist also nicht zu denken. Durch Auswerfen von 15 Kilogramm Sand bringen wir den Ballon wieder etwas in die Höhe. Bald geht es lustig über die Wipfel des 20 bis 30 Meter hohen Tannengehölzes. Die letzen Baumwipfel streift das Ende unseres Gleitseiles. Im nächsten Augenblick haben wir das Stoppelfeld hinter dem Wald erreicht; vor uns ist mindestens 600 Meter freier Raum, dann wieder kleine Baumgruppen und ein einzelnes niedriges Haus. Auf diesem Felde wollen wir unsere Fahrt beschließen. Wir öffnen das Ventil; in seiner ganzen Länge legt sich das Gleitseil jetzt auf die Erde, die Geschwindigkeit des Ballons wird bereits langsamer; gleich darauf stößt der Korb zum ersten Male auf dem Boden auf. Mit einem kräftigen Klimmzug an den Korbstricken parieren wir diesen nicht besonders heftigen Stoß. Doch vollkommen vermag das Gleitseil bei dem starken Winde den Ballon nicht zu halten, langsam, aber stetig, unterbrochen von kleinen Aufstößen auf den Boden, rückt der Korb immer näher dem Bauernhaus zu, dessen Bewohner ängstlich der Dinge harren, die da kommen sollen, und bereits Miene machen, Reißaus zu nehmen. 300 Meter ist das Haus noch entfernt. Doch nun ist auch der Kampf zwischen Gleitseil und Wind beendigt. Wieder stößt der Korb auf; ein kräftiger Zug an der Zerreißleine, wenige Sekunden vergehen und der Ballon, kurz vorher eine große Kugel, liegt platt gedrückt wie ein Kuchen auf der Erde, und geärgert fegt der Wind über die Stoppeln.
Nachdruck verboten.
Alle Rechte vorbehalten.
Die Marquise von Custine.
Bei dem freundlichen Dorf Anisy in der Normandie, nicht sehr weit von Paris, hatte Monseigneur von Sabran, Bischof von Laon und erster Almosenier der Königin Marie Antoinette, ein Landhaus mit schönem Garten und Park. Einen großen Theil der Sommerzeit pflegte dort seine Schwägerin zu wohnen, die Gräfin Eleonore von Sabran, deren um fünfzig Jahre älterer Gemahl wenige Jahre nach der Verheirathung mit ihr gestorben war. Die junge Witwe betrauerte ihn nicht lange, dazu hatte er ihrem Herzen nicht nahe genug gestanden, und dazu war auch ihr Charakter ein viel zu lebensfreudiger. Mit zwanzig Jahren Witwe zu sein, verlieh ihr einen Reiz mehr zu denen, welche ihr die Natur und eine feine Erziehung gegeben hatten. Denn sie war eine anmuthsvolle Erscheinung mit einer Fülle seidenweicher blonder Haare, mit schwarzen Augen, schönem Gesicht, von lebhaftem und geistsprühendem Wesen. Am Hofe von Versailles, in der Gesellschaft von Paris, die unter Ludwig XVI. noch so berückenden Glanz entfaltete, spielte sie eine große Rolle, nicht bloß durch ihre vornehme Familie, sondern auch durch die Fülle von Eigenschaften, welche sie in den Salons ihrer Zeit zum Muster einer feinen Dame machten.
[860] Zwei Kinder hatte der alte Graf Sabran, als er in Reims bei der Krönung Ludwigs XVI. im Juni 1775 vom Schlage gerührt wurde, seiner jungen Gattin hinterlassen, einen Sohn Namens Elzear und eine Tochter, Delphine. Frau von Sabran ward durch ihre Neigung für die Genüsse einer Weltdame nicht abgehalten, sich ihren beiden Kindern mit mütterlicher Liebe zu widmen. Delphine wurde zwar, wie es die Sitte erheischte, einem Kloster zur Vollendung ihrer Erziehung übergeben; doch nahm die Mutter sie frühzeitig wieder zu sich, um die verheißungsvoll erblühende Rose in dem Sonnenschein und der Luft ihres Hauses und seines gesellschaftlichen Lebens sich entfalten zu lassen.
Mit der Eitelkeit einer jungen Mutter, die immer von Verehrern umschwärmt war, immer etwas wie für ihren Geist so auch für ihr Herz bedurfte, verfolgte sie die Entwicklung ihrer Tochter. Selbstverständlich plante sie eine glänzende Verheirathung derselben.
Delphine, am 18. März 1770 in Paris geboren, trat in ihr sechzehntes Jahr, es war also Zeit für die Brautkrone. Der Sitte gemäß hatte die Mutter den ihr geeignet erscheinenden Gemahl für ihre Tochter zu suchen. Gräfin Sabran lernte einen hohen und mit Ehren genannten Offizier der königlichen Armee kennen, den Marquis von Custine, und mit ihm zugleich seinen achtzehnjährigen Sohn Philipp. Dieser bot eine vortreffliche Partie für Delphine, denn die Custines gehörten zu den ersten Familien Lothringens und waren bei Metz sehr begütert; jedes der beiden Kinder des Marquis hatte auf ein Vermögen von 700000 Livres mütterlicherseits zu rechnen.
Die Unterhandlungen begannen, und in der That wurde der Marquis für die Verbindung beider Familien gewonnen. Die jungen Leute faßten überdies Neiguug zueinander. Philipp von Custine war ein trefflicher, ernster, hochbegabter junger Mann, der Delphinens holde Anmuth zu würdigen wußte, und sie mit ihrem kindlichen Sinn konnte in ihm wohl das Ideal eines Mannes finden, an dessen Seite sich glücklich leben ließ. Am 22. Juli 1787 fand die Trauung in Anisy statt. Der bischöfliche Oheim gab dabei nicht nur den Segen, sondern seiner Nichte auch 200000 Livres Mitgift. Die Hochzeit wurde gefeiert mit ländlichen Festen à 1a Trianon, wie Marie Antoinette sie in Mode gebracht hatte. In arkadischer Idylle verlebte das junge Ehepaar seine ersten Jahre, und die junge Frau schwelgte in der Wonne, welche ihr das neue Dasein bot. Gab es einen Verdruß für sie, so war es höchstens der über die wiederholte längere Abwesenheit ihres Mannes, wie sie dessen diplomatischer Dienst und seine Pflicht, als Abgeordneter der Nationalversammlung, zu welcher er ebenso wie sein Vater gewählt worden war, manchmal mit sich brachte. Wie klein aber war dies Wölkchen an ihrem Himmel, während dunkel und mächtig schon die Wetterbank der Revolution am Horizonte emporstieg!
In Anisy machte man sich darüber keine Sorgen.
Die ersten Blitze zuckten, die Donner der neuen Zeit ließen jene Gesellschaft erbeben, die durch alte Privilegien, Reichthum und Genuß geistiger wie sinnlicher Art sich ein Paradies auf Erden zu schaffen gesucht hatte. Es floß Blut in Paris; wilde Sturmstöße riefen Schrecken und Angst hervor, und das Flüchten der Vorsichtigen aus der königlichen Umgebung begann. Auch die Gräfin von Sabran ließ sich von ihrer Tochter nicht mehr zurückhalten und floh mit dem heimlich ihr vermählten Marquis von Boufflers nach Rheinsberg zum Prinzen Heinrich von Preußen, ihrem und ihres Mannes Gönner. Der Krieg brach aus. Der Marquis von Custine zog als General mit den Revolutionstruppen siegreich über den Rhein bis nach Mainz und Frankfurt, und mit ihm zog in patriotischer Begeisterung als sein Adjutant sein Sohn, der Gemahl Delphinens.
Sie beunruhigte sich über dies alles nicht. Die Idylle, welche seit dem Tage ihrer Hochzeit dank der Sorgfalt ihrer Mutter und der Aufmerksamkeit ihres Gatten sie umgab, war wie etwas Unantastbares, wie eine geweihte Oase in der Welt, die ringsum zur Wüste wurde. Ja, die Mutterfreude über den ihr geschenkten Sohn Astolfe vermehrte und vertiefte noch das Glück der reizenden juugen Frau. Der bischöfliche Oheim sorgte für alles, was die von ihrem Gatten und ihrer Mutter Verlassene an gewohnter gesellschaftlicher Unterhaltung bedurfte. Es gab bei der kleinen heiteren liebenswürdigen Marquise Besuche nach wie vor, noch aus den Kreisen, die zur alten Gesellschaft gehörten, liebliche Feste, geistreiche Abendunterhaltungen, verliebtes Necken, galante Huldigungen. Und während der französische Feudalstaat schon in allen Fugen krachte, die jäh unter vulkanischen Stößen aufklaffenden Abgründe schon den Thron verschlangen – in Anisy herrschte noch der sorglose Sinn der alten Zeit, und man ahnte kaum, daß eine furchtbare Umwälzung begonnen hatte.
„Man ist hier sehr wohl,“ schrieb Delphine ihrer Mutter; „ich versichere Sie, man vergnügt sich sehr viel.“
Auf einmal schlug der Blitz auch in dieses Arkadien. Der General Custine hatte Mainz wieder aufgegeben und sich zurückgezogen; die Jakobiner schrieen Verrath und klagten ihn im Konvente an. Er eilte nach Paris, um sich zu rechtfertigen. Vergebens! Er hatte Mainz preisgegeben und darum war er ein Verräther an Frankreich. Die Guillotine war längst mit dem Blute des Königs gefärbt und stand auf dem Revolutionsplatz, um täglich ihre blutige Arbeit an den Feinden der Republik verrichten zu können. Jedem Verdächtigen drohte der Tod. Am 22. Juli 1793 wurde Custine verhaftet und vor das Revolutionstribunal verwiesen, wo der fauatische Ankläger Fouquier-Tinville bereits allmächtig geworden war.
Voller Bestürzung darüber kam Philipp von Custine nach Paris, um den Vater zu retten. Delphine eilte, sich mit ihrem Gatten zu verbinden. Und derart aufgestört aus ihrem häuslichen Glücke, begriff sie sofort, daß es sich darum handelte, den Henker von den Ihrigen abzuwehren. Aus der graziösen jungen Frau von 23 Jahren wurde eine zum Kampf entschlossene Heldin.
Delphine lief zu allen, die sie kannte und von deren Verwendung sie sich einen günstigen Einfluß auf das Geschick ihres Schwiegervaters versprach. Sie täuschte sich. Die Großen von früher galten nichts mehr und standen selbst unter dem Damoklesschwert. Neue Menschen regierten, übten die Macht, führten die Prozesse, fanatische, niedrige, blutgierige Menschen. Auch zu ihnen brach sich das tapfere Weib den Weg, es suchte die Richter auf, steckte Gold über Gold in die Hände derer, die vielleicht etwas thun konnten, den General seinen Henkern zu entziehen. Sie drang bis zu seinem Gefängniß vor, setzte sich über die Rohheiten hinweg, mit denen man ihr hier begegnete, wartete auf dem schmutzigen Flur, bis er seine Zelle verlassen durfte, und warf sich ihm dann schluchzend an die Brust. Laut vor den Wächtern und Pikenträgern sprach sie für seine Unschuld. Tag um Tag that sie es, in und vor dem Gefängniß, so daß sie dort eine bekannte Erscheinuug wurde.
„Das ist die Custine!“ hörte sie um sich her. „Bald wird’s ihrem Vater an den Hals gehen!“
Man hielt sie für die Tochter des Generals.
Im August wurde sein Prozeß mehrere Tage lang im Saale des Justizpalastes verhandelt. Sie wußte es möglich zu machen, den Sitzungen beizuwohnen. Inmitten des Gedränges der Zuhörer, die alle meist der müßiggängerischen Bande der Sansculotten und ihrer Weiber angehörten, in der erstickenden Luft hockte sie auf einem Platz, den sie sich vom Gerichtsdiener theuer erkauft hatte. Ihr Anblick rührte und tröstete den General; er konnte auch zuweilen Worte mit ihr wechseln.
Ingrimmig verfolgten sie einmal Pöbelmassen, als sie den Justizpalast verließ. Sie war ja eine „Aristokratin“, schon darum des Hasses und der Beschimpfung werth. Eilig schritt sie durch die böse Menge vor dem Gerichtshause, um den Miethwagen zu erreichen, der in einer Nebenstraße auf sie wartete. Man drängte sich murrend näher an sie heran; kreischende Weiberstimmen riefen ihren Namen wie ein Losungswort zum Angriff. „Das ist die Custine, die Tochter des Verräthers!“ Flüche erschollen, drohende Fäuste erhoben sich dicht vor ihrem Auge, Säbel funkelten in der Luft. Sie fühlte sich einer Ohnmacht nahe vor Angst; sie sah sich bereits gepackt und ermordet, ihren blutigen Kopf auf einer Pike durch die Straßen getragen wie den der unglücklichen Prinzessin von Lamballe und so mancher anderer Opfer der entfesselten Blutgier.
Eine Schwäche, und sie war verloren. Sie wußte es und darum hielt sie sich aufrecht. Verzweiflungsvoll aber schaute sie um sich, wie sie vor der wilden Bande sich retten könne. Da
[861][862] sah sie abseits von den anderen ein Weib aus dem Volke mit einem Säugling im Arme. Einer blitzschnellen Eingebung folgend, lief sie auf dasselbe zu und stammelte:
„Welch’ ein hübsches Kind!“
„Nehmen Sie es, schnell!“ flüsterte verständnißvoll die Mutter ihr zu.
Delphine nahm den Säugling an sich, küßte ihn, und die Megären stutzten. Das Kind wurde ihr Schutz. Sie verfolgte ruhig mit demselben im Arme ihren Weg, und niemand bedrohte sie mehr. So ging sie bis an den Ponte-Neuf und gab dort das Kind seiner Mutter zurück, die ihr gefolgt war. Einen Augenblick schauten sich beide Frauen an und entfernten sich dann voneinander, ohne ein Wort zu sprechen.
Gott dankend, lief sie nach ihrem Hause in der Rue de Bourbon. Aber dort kam die Dienerschaft ihr schreckensbleich entgegen.
„Was habt Ihr?“
Sie ahnte etwas Furchtbares, da man mit der Antwort zögerte.
„Mein Mann?“
„Ja, Frau Marquise! Man hat ihn geholt!“
„Verhaftet?“
„Ja, er ist nach La Force gebracht worden, vor einer Stunde.“
Also auch dieser Schlag noch! Delphine schwankte und mußte sich setzen. Dann aber raffte sie sich auf, bestellte einen Wagen und ließ sich nach dem Gefängniß La Force fahren. Dort war es, wo die Prinzessin von Lamballe ihr schreckliches Ende gefunden hatte, dort war jetzt Philipp.
Noch währte der Prozeß gegen den General Custine. Delphine theilte ihren Tag in die Sorge für ihn und für seinen Sohn. Von der Conciergerie, wo der General gefangen gehalten wurde, eilte sie nach La Force, wo man ihr gestattet hatte, Philipp zu besuchen. Ihr Schwiegervater war nicht mehr zu retten; das Gericht verurtheilte ihn zum Tode. Am 29. August 1793 wurde er in der Frühe hingerichtet, und seine Zelle erhielt die Königin Marie Antoinette als Vorzimmer zur Guillotine, die ihrer ebenfalls wartete. Für Philipp aber, seinen Sohn, für ihren Mann, den Vater ihres Kindes – für den konnte Delphine ihre Liebe, ihren Eifer, ihre Energie, ihre List, ihr Vermögen noch aufbieten, um ihn dem Blutgerüste zu entziehen.
Sie sparte keinen Gang, kein Flehen, kein Geld, um den Prozeß zu verschleppen. Ihr Mann sollte als Mitwisser der Verrätherei seines Vaters angeklagt werden. Die unsinnigste Anklage genügte, jeden zum Tode zu verurtheilen, den Fouguier-Tinville und der allmächtige Robespierre dazu bestimmt hatten. Von diesen beiden Männern – das sah Delphine bald – war für ihren Gatten nichts zu hoffen, da ein früherer Brief desselben aufgefangen worden war, in dem er ein scharfes Urtheil über die Schreckensmänner gefällt hatte.
Aber sie machte sich nun an den Schließer in La Force, dem die Zelle des Marquis unterstand, und lernte in seiner Tochter Luise ein gutmüthiges junges Mädchen kennen, welches von lebhafter Theilnahme für die schöne Aristokratin erfüllt war. Darauf baute Delphine mit einigen Freunden ihren Rettungsplan. Philipp zählte jetzt erst 25 Jahre, seine Figur war klein und schmächtig genug, um eine unauffällige Verkleidung als Frau zuzulassen. So wurde denn verabredet, daß er Kleider von seiner Frall und diese solche von Luise anlegen sollte, und daß, während Delphine auf einer anderen Treppe das Gefängnißhaus verlasse, er und Luise unter dem Schutze der abendlichen Dämmerung durch den großen Thorweg ihren Ausgang nechmen sollten. Für diesen Dienst wurden dem Mädchen 30000 Franken in Gold sogleich nach gelungener Flucht zugesichert und außerdem eine lebenslängliche Rente von 2000 Franken.
Anfang Januar 1794 sollte Philipp von Custine vor seine Richter gestellt und zu diesem Behufe nach der Conciergerie verbracht werden. Am Vorabend des Tages, da die Ueberführung zu erwarten stand, war alles für seine Rettung bereit. Delphine begab sich nach La Force und traf dort mit Luise zusammen. Aber das Mädchen empfing sie mit thränenvollen Augen.
„Warum weinst Du denn?“
„O, Madame!“ rief sie klagend, „sie allein können ihm noch das Leben retten. Ich flehe ihn vergeblich an; seit heute morgen will er nichts mehr von einer Flucht hören.“
Delphine vernahm den Grund dieser Weigerung. Ein neues Dekret des Wohlfahrtsausschusses bedrohte jeden mit dem Tode, der zur Flucht eines Gefangenen Beistand leiste. Dies Dekret war gedruckt in den Gefängnissen angeschlagen worden, und Custine hatte das Mädchen darauf hingewiesen.
Mit Luise zusammen versuchte Delphine in der Zelle ihren Mann dennoch umzustimmen. Sie mahnte ihn an seinen Sohn; sie versicherte, daß Luise vor jeder Entdeckung sicher sei. Umsonst! Custine wollte sie der Gefahr nicht aussetzen.
„Retten Sie sich doch!“ drang das furchtlose Mädchen von neuem in ihn. „Was mich betrifft, so machen Sie sich keine Sorge! Alles ist bereit, alles wird gelingen. Sie haben mir für meine Hilfe ein Vermögen versprochen; vielleicht können Sie dies Versprechen gar nicht halten. Nun, ich will Sie dennoch retten. Wir werden uns verstecken, wir werden Frankreich verlassen; ich werde für Sie arbeiten. Ich verlange nichts, nichts dafür – aber lassen Sie mich handeln.“
Er schüttelte sein Haupt. „Nein man wird uns einfangen, und Du wirst auf das Schafott kommen, um meinetwillen.“
„Und wenn ich es will?“ rief sie.
Er wankte nicht. Die Stunde verging, welche Delphine für den Besuch bewilligt war; sie mußte endlich gehen, das Gefängniß ohne ihren Mann verlassen. Luise geleitete sie hinaus.
Der Prozeß des jungen Custine war nur eine Fortsetzung desjenigen seines Vaters und endigte ebenfalls mit Verurtheilung. Der Ankläger Fouquier-Tinville wollte es so. Den Verhandlungen vor Gericht wohnte Delphine auf den Wunsch ihres Gatten nicht bei; aber ein letztes Mal besuchte sie ihn am Abend vor seiner Hinrichtung. Schweigend saßen beide nebeneinander in seiner Zelle, sie hatte den Arm um seinen Hals geschlungen. Ein Lebewohl für ewig! Noch tauschen sie wenige Worte – ihr Sohn ist’s, an den sie denken – und dann ein letztes, langes, herzentströmendes Umarmen des jungen Ehepaares.
Am 3. Januar 1794 fiel das Haupt Philipps von Custine unter der Guillotine auf dem Revolutionsplatz.
Mit dreiundzwanzig Jahren, in der Blüthe ihrer körperlichen Anmuth war Delphine ihres Gatten beraubt. Ihr Vermögen war konfisziert, Armuth ihr Los, alles Glück, aller Glanz ihres Daseius dahin, und Trost für alles Verlorene und Zerschlagene nur ihr kleiner Sohn Astolfe. Mit ihm wollte sie sich aus dieser Luft des Todes retten. Sie hoffte als Spitzenhändlerin unter falschem Namen nach Belgien zu entkommen, während die treue Amme ihres Kindes sich mit diesem nach dem Elsaß begeben sollte. In Pyrmont wollten beide sich wieder treffen und von da nach Berlin reisen, wo sich die Gräfin von Sabran mit ihrem Sohn Elzear aufhielt. Durch Bestechung wußte die unglückliche Frau sich einen Paß zu verschaffen. Ihr Haus in der Rue de Bourbon hatte sie sogleich nach der Hinrichtung ihres Mannes verlassen müssen und dann eine kleine Wohnung in der Rue de Lille bezogen. Da packte sie von ihren Sachen zusammen, was sie mit auf die Reise nehmen wollte, und ordnete die nachgelassenen Papiere Philipps sowie ihre Briefe, die sie von den Freunden des Hauses erhalten hatte, um sie in einer Kassette zu verwahren.
Mitten in dieser Beschäftigung vernahm sie verdächtigen Lärm am Eingang ihrer Wohnung. Schnell schlug sie die Kassette zu und schob sie unter ein Sofa; in demselben Augenblick wurde auch die Thür aufgerissen, und die unheimlichen Gestalten einer Kommission des Sichercheitsausschusses drängten sich herein.
„Du bist verhaftet!“ schrie ihr wild der Anführer zu, „denn wir wissen, daß Du auswandern willst.“
Sie widersprach nicht; ein Elender unter ihrer Dienerschaft mußte sie verrathen haben. Die Kommissare entrissen ihr die Brieftasche, die sie vom Tisch weggenommen hatte.
„Aha, der Paß! Der falsche, der erkaufte Paß! Warte, Aristokratin, man wird Dir Deine schönen Goldhaare und Deinen weißen Hals abschneiden!“
Man nahm eine erste Haussuchung vor, sah in Schränken und Kästen nach, wühlte da und stöberte dort herum; unter das Sofa, wo die wichtige Briefkassette stand, blickte man nicht. Dann legte man die Siegel an die Wohnung und führte die junge Frau hinaus. Sie mußte unten auf der Straße mit drei Bewaffneten in eine Droschke steigen, die sie nach dem Gefängniß, einem früheren Karmeliterkloster, brachte.
In allen Gefängnissen von Paris, in den alten wie in den neuen, die man hastig aus Klöstern und Schlössern hergerichtet hatte, gab es in jener Zeit des Schreckens eine Ueberfülle von [863] Menschen aller Stände, und auch die alte „Gesellschaft“ war darin reichlich vertreten. Bei den Karmelitern besonders. Delphine von Custine, jetzt nach dem Gleichheitskodex einfach „Bürgerin Custine“, fand in dem großen Refektoriumssaal, wo tagsüber die Gefangenen, weibliche wie männliche, sich aufhalten durften, eine große Anzahl von Personen, denen sie früher schon in den Salons begegnet war, „Ex-Adlige“ wie sie, reizende Frauen, die gleich ihr die Guillotine in Aussicht hatten, und geistreiche Herren, die mit gutem Humor hier in dem wüsten Treiben durch ihren Witz und ihre Galanterien wie einst sich angenehm zu machen suchten. Mitten im Gefängnißsaal bildeten sie einen aristokratischen „Salon“ und führten im Geschmack desselben ihre Unterhaltung. Die neu Ankommenden wurden von ihren Bekannten vorgestellt. Frau von Lameth, Frau von Jarnac, Frau Josephine von Beauharnais, deren Gemahl wie Custine wegen der Preisgabe von Mainz der Verrätherei angeklagt war und seinen Prozeß erwartete. Alle Tage rief der Kommissar des Gerichts aus diesem Kreise diejenigen ab, die vor ihren Richtern erscheinen sollten und die dann selten wiederkamen. Manche wurden ja wohl auch freigesprochen oder aus der Haft entlassen. Die Zurückgebliebenen rückten enger aneinander. Wohl konnte der nächste Tag wieder neue Lücken in ihre Reihen reißen. Aber der Tod, das Schafott hatte keine Schrecken mehr. So entsetzlich es klingt, es geschah doch oft, daß sich diese lebenslustige Gesellschaft die Zeit mit „Hinrichtung spielen“ vertrieb, und laut wurden die Damen beklatscht, welche mit Grazie auf den Stuhl stiegen, der das Schafott vorstellen sollte.
Mehrmals wurde Delphine abgerufen um unter Bedeckung in ihre Wohnung geführt zu werden, wo neue Haussuchungen stattfanden. Auch die Briefkassette wurde bei einer solchen gefunden. Sie grämte sich nicht darüber. Durfte sie dabei doch die Freude erleben, ihren kleinen, zweijährigen Sohn wiederzusehen, den man mit seiner Wärterin Nanette in der Küche gelassen hatte und den die treue Dienerin mit ihrer Hände Arbeit ernährte.
Einer der Kommissare, von welchen Delphine bei diesen Gelegenheiten verhört und überwacht wurde, war ein Maurer von Beruf und hieß Albert Gérôme. Als fanatischer Jakobiner hatte er sich eine Vertrauensstellung im Sicherheitsausschuß und bei Fouquier-Tinville errungen. Er sah, wie die unglückliche junge Frau an dem Wiedersehen mit ihrem Kinde sich aufrichtete, er lernte den Schmerz kennen, von dem ihr Gemüth verwüstet wurde, und den Heldensinn, mit dem sie ihn zu beherrschen und ihrem tragischen Schicksal zu trotzen wußte. Hunderte von Opfern der Schreckenspolitik Robespierres und der Blutgier Fouquiers hatte Gérôme schon mitleidslos den Weg zum Schafott geführt. Delphine von Custine aber wollte er vor dem Tode retten. Als ein geheimnißvoller Beschützer setzte er für sie seinen eigenen Kopf aufs Spiel. Er hatte in Fouquier-Tinvilles Bureau die Verhörsprotokolle zu ordnen, nach denen dieser täglich seine Anklagen ausarbeitete. Immer schob er die auf Delphine bezüglichen Schriftstücke zu unterst des Aktenstoßes, so daß sie dem vielbeschäftigten Ankläger gar nicht in die Hände fielen. Monatelang trieb er dies verwegene Spiel. Die junge Gefangene im Karmeliterkloster erwartete vergeblich, endlich vor Gericht geholt zu werden. Einer nach dem andern ihrer Unglücksgefährten wurde dahin abgerufen; sie blieb zurück, als sei sie auf einmal vergessen. Daß sie dies jenem Kommissar Gérôme verdankte, der bei den Verhören in ihrer Wohnung stets am ergrimmtesten über die Aristokratie loszog, davon hatte sie keine Ahnung.
Dann kam jener Thermidortag, wo Robespierres und Fouquier-Tinvilles Schreckenssystem zusammenbrach, da die Kerker sich öffneten und die Blutgerichte ihre Arbeit einstellten. Noch immer aber that sich für Delphine das Eisenthor des Gefängnisses nicht auf. Zwei Monate vergingen, dann endlich schlug auch für sie die Stunde der Erlösung. Nanette, die Wärterin ihres Kindes, erwirkte durch ihre Fürsprache das Freilassungsdekret des Sicherheitsausschusses, und unter diesem stand geschrieben:
„Wir, Vorsteher der neugestalteten Polizei, bestätigen die Unterschriften dieses als wahr und richtig. Paris, 17. Vendémiaire, III. Jahr der Republik. Gérôme, Albert.“
Gérôme also –! Delphine erinnerte sich seiner noch sehr wohl, des jungen Sansculotten, der sie stets am bittersten geschmäht. Jetzt aber war sein Reich und seine Schrecklichkeit für sie zu Ende. Sie war frei, uach acht Monaten wieder ihrem Kinde und sich selbst zurückgegeben.
Aber blutarm war sie und dazu krank von den Leiden und Entbehrungen, die sie in der Haft ausgestanden hatte. Nanette, die treue Seele, mußte nun auch für ihre Herrin den Lebensunterhalt beschaffen. Gelegentlich kam freilich an die Dienerin eine kleine Geldsumme von unbekannter Hand als werthvolle Unterstützung. Endlich aber erhielt Delphine selber durch ihre Mutter und ihre Freunde erheblichere Mittel zugestellt und konnte sich wieder eine kleine trauliche Häuslichkeit einrichten. Sie vermochte nun auch denen wohlzuthun, die, wie Luise und Nanette, in der Noth ihr beigestanden hatten.
Eines Tages kam in der Dunkelheit ein vermummter Mann zu ihr in die Wohnung. Er erzählte ihr, wie sie vor Fouquier-Tinvilles Bluthand bewahrt worden war, er bekannte sich auch als den geheimen Absender jener kleinen Summen an Nanette. Dieser Mann, dem sie ihr Leben verdankte, war jetzt selbst ein Verfolgter, die Rache der Thermidoristen suchte ihn, den Jakobiner und eifrigen Agenten des Sicherheitsausschusses. Jetzt bat er Delphine, ihm in seiner Noth zu helfen, und nicht umsonst. Trotz aller Gefahr, welche sie dabei lief, verbarg sie ihn, verschaffte ihm einen Paß und gab ihm eine Summe, mit der er aus Frankreich entkam und nach Amerika flüchten konnte. – –
Die Stürme hatten ausgewüthet; öffentliche Ruhe und Sicherheit der Person kehrten zurück, und die Lebensverhältnisse in Paris gestalteten sich wieder freundlicher. Die Leidenschaften tobten sich im Kriege außerhalb Frankreichs aus, und die Geister suchten sich in der neuen Ordnung der Dinge zurechtzufinden. Frau von Custine konnte sich um Rückerstattung ihres konfiszierten Vermögens bewerben, und die Freundschaft, die sie mit Josephine von Beauharnais im Gefängniß geschlossen hatte, kam ihr hierbei zu nutze. Die reizende Kreolin, wie Delphine durch die Guillotine zur Witwe geworden, war die Freundin des Direktors Barras, der an der Spitze Frankreichs stand, und wurde dann die Frau des jungen Generals Bonaparte, der bald der gewaltige Herr des Landes werden sollte. Durch Josephine lernte sie auch Fouché, den späteren Polizeiminister, kennen, auf den ihre Schönheit und ihr Geist einen tiefen Eindruck machten. Diese Fürsprecher und Vermittler enthoben sie ihrer äußeren Bedrängniß; sie erhielt einen großen Theil ihrer beschlagnahmten Güter zurück, konnte ihre Mutter in der Schweiz wiedersehen und dann auch deren Rückkehr nach Paris ermöglichen.
Doch wie leer kam Delphine die Welt jetzt vor! Jene Gesellschaft, in der sie einst so glücklich und mit einem Herzen so voll von Empfänglichkeit gelebt hatte, gab es nicht mehr. Frauen verwandten Geistes, mit denen sie innige Neigung verband, wie Josephine, wie vor allem Frau von Staël, genügten ihr doch nicht für ihre Herzenswelt. Ihr junges Gemüth verzehrte sich in Sehnsucht, und für die große Leidenschaft, zu der sie sich nach ihrem Sturz aus der ersten, wolkenlosen Glückseligkeit wieder hätte erheben können, fand sich der rechte Mann nicht.
„Ich bin müde meines leeren und einsamen Daseins,“ schrieb sie ihrer Mutter 1797. „Ich würdige keineswegs den Werth meiner Freiheit!“ Und ein andermal: „Ich möchte einen Gatten finden, der, vernünftig und gefühlvoll, denselben Geschmack hätte wie ich und alle die Empfindungen mir entgegentrüge, aus denen sich mein Wesen zusammensetzt; einen Gatten, der fühlte, daß, um glücklich zu leben, er bei mir sein muß und mich führen und meinen Sohn lieben, als wär’ es sein eigener; der, sanft von Gesinnung und Charakter, Philosoph, gebildet, keine Scheu hätte vor Widrigkeiten, sie sogar kennen müßte, aber den Ausgleich aller Uebel darin fände, eine Lebensgefährtin wie Deine Delphine zu besitzen: das ist es, was ich finden möchte und was ich – ich fürchte es – niemals finden werde.“
Und doch fand sie ihn, diesen für sie idealen Mann. Im Jahre 1803 lernte sie den Vicomte von Chateaubriand kennen, den ruhmgekrönten Verfasser des „Genius des Christenthums“, der einen magischen Zauber auf Delphine ausübte. Auch er wurde von Leidenschaft für sie ergriffen. „Wenn ich Sie verlassen müßte,“ schrieb er ihr damals, „so würde ich mich töten.“ Aber er war bereits vermählt, noch befangen in der ganzen Wandelbarkeit seines Wesens, zerklüftet im Gemüth, dabei ehrgeizig über alles und begierig nach einer hohen Stellung im Staat. Durch Delphinens Vermittlung bei Josephine, der Gemahlin des nun allmächtig gewordenen ersten Konsuls Napoleon Bonaparte, wurde er in die diplomatische Laufbahn eingeführt und als Legationssekretär nach Rom gesandt. [864] Dort verglühte die Flamme, die das reizende Weib in seinem Herzen entzündet hatte, und seine Liebesleidenschaft verwandelte sich in kühle, wenn auch immer dankbar ergebene Freundschaft. Sie aber hoffte noch auf ihn und liebte ihn wie niemand auf der Welt, mit der tiefsten Leidenschaft, deren ein Frauenherz fähig ist. Und wahr wurde so, was sie befürchtet hatte: sie fand zwar den Mann ihrer Ideale, doch das erträumte Glück ihres neuerstandenen Lebens nicht.
Bei Lisieux, in der Nähe von Anisy, wo sie ihre Jugend und die schöne Zeit ihrer Ehe verlebt hatte, kaufte sie sich nach Wiederherstellung ihres Vermögens Schloß und Herrschaft von Fervacques. Dorthin zog sie sich zurück mit ihren zertrümmerten Hoffnungen. Wenig Theilnahme erregte ihr ferner noch das Treiben der Welt. Das Kaiserreich, die brutale Pracht und Ruhmgier des Militärstaates waren ihrem feinfühlenden Wesen zuwider. Auf Fervacques, im Winter auch in ihrer Wohnung zu Paris, führte sie ein bescheidenes Leben, vereinsamt im Gemüth, wenig gesellig und dies nur ihrer Mutter zu Gefallen, welche immer noch die Dame des achtzehnten Jahrhunderts war und sie auch zu spielen wußte. Frau von Staël blieb die nächste unter den Freundinnen der Marquise von Custine, und jener Roman, in dem die geistvolle Tochter Neckers 1803 den Konflikt des Weibes zwischen Sittengesetz und Neigung zu so tiefgreifender Darstellung brachte, erhielt den Titel „Delphine“, denn für die Heldin desselben hatte die unglückliche Geliebte Chateaubriands Modell gesessen.
Eines Tages kam in die Pariser Wohnung Delphinens ein behäbiger Mann, wettergebräunt, etwas bäurisch in Benehmen und Kleidung. Er ließ sich der Marquise melden: Herr Albert Gérôme. Ihr Retter, dessen Liebesdienst sie vor Jahren hatte erwidern können, hatte sein Glück in Amerika gemacht und war nach dem kaiserlichen Paris gekommen, um da sein erworbenes Vermögen zu genießen. Delphine empfing ihn mit großer Herzlichkeit, er sollte sich fortan als den Freund ihres Hauses betrachten, dem die Thüre desselben immer offen stand. Aber er machte davon keinen Gebrauch und sagte ihr, warum:
„Ich komme, wenn Sie allein sind, nicht aber, wenn hier Besuch ist. Ihre Freunde würden mich wie ein merkwürdiges Thier ansehen, und Sie würden mich nur aus Güte empfangen. Denn ich kenne Ihr Herz. Ich aber würde mich nicht wohl hier fühlen und enthebe mich solchen Zwanges. Ich bin nicht von gleicher Herkunft wie Sie, spreche nicht wie Sie; wir haben nicht dieselbe Erziehung erhalten. Habe ich etwas für Sie gethan, so auch Sie für mich. Wir sind quitt.“
Sie fühlte wohl, was er ihr damit gestand. Er kam manche mal wieder zu ihr, wenn sie keinen anderen Besuch hatte. Nie aber sprach er wieder so zu ihr, wie er es bei jenem ersten Wiedersehen bewegten Herzens gethan hatte; bald hörte sie dann, daß er gestorben sei. –
Das Kaiserreich stürzte zusammen, die Bourbons kehrten zurück und bauten sich ihr Königthum wieder auf. Im Gegensatz zu ihrer Mutter, der immer noch lebenslustigen Frau von Boufflers, verharrte Delphine auch jetzt weltüberdrüssig in ihrer Zurückgezogenheit. Die alte Aristokratie, die sich in dem Königreich der Bourbons wieder breit machte, erschien ihr doch nur wie klägliches Gespensterthum, das durch eine neue Welt huschte, um vergeblich die alte zu suchen. Desto mehr gewann der deutsche Geist Einfluß auf Frau von Custine. Er gewährte ihr eine erfrischende Anregung, seitdem sie ihn kennengelernt. Frau von Staël hatte die erste Veranlassung dazu gegeben, und Delphinens Bruder Elzear hatte in Berlin zum Theil noch seine Ausbildung erhalten; ihre Mutter stand mit den Berliner Gesellschaftskreisen mannigfach in Beziehung. Vor allem war es Rahel von Varnhagen, welcher sich Frau von Custine geistesverwandt fühlte und mit der sie die innigste Freundschaft schloß. Sie lernte in der Stille von Fervacques Deutsch und las da Goethe, Tieck, Kant, Fouqué. „Das ist eine indirekte Art, mich mit denen zu beschäftigen, die ich liebe,“ schrieb sie an Rahel 1816, „und der Gedanke daran wird mir genügen, mir diese Beschäftigung werth zu machen.“
Bald kamen Jahre, wo sie mehr und mehr kränkelte; im Sommer 1826 entschloß sie sich deshalb, einen Aufenthalt in der Schweiz zu nehmen, in Bex am Genfer See. Lausanne war in der Nähe, und dort hielt sich Chateaubriand auf. Ihn liebte sie noch immer; ihn sehen, ihn sprechen zu können, war immer noch ihr höchstes, von ihm, auch wenn er in Paris lebte, so selten berücksichtigtes Verlangen. Wenn ein Wiedersehen mit ihm der letzte Wunsch war, der sie nach Bex führte, so sollte er unerfüllt bleiben. Unerwartet schnell starb sie im Alter von 56 Jahren am 15. Juli. Als Chateaubriand davon erfuhr, eilte er von Lausanne nach Bex, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Er sah sie im Sarge, eine zarte Gestalt, von ihrem prächtigen Seidenhaar eingehüllt, im Tode noch schön. Ihre Leiche wurde nach Fervacques gebracht und dort nach ihrem Willen an der Seite der kurz zuvor gestorbenen jungen Gemahlin ihres Sohnes Astolfe in dem Kirchlein des nahen Dorfes Sainte-Aubin beigesetzt. Noch ein Winter, dann folgte ihr auch die Mutter nach, die alte Marquise von Boufflers.
Alle Rechte vorbehalten.
Der Tuifelmaler.
Golden liegt die Herbstsonne auf dem See und den fernen Wäldern, die sich wundersam klar im Wasser spiegeln. Und dieses Wasser plätschert an die alten Weiden des Ufers her mit einer Naturmusik, welche die Seele ganz gefangen nimmt.
Jahrzehnte sind vergangen, seit ich als Kind an derselben Stelle saß. Auch damals spielten die Wellen krystallhell um den Strandkies. Sie spielten aber auch um ein Fahrzeug seltsamer Art, das ich in ihnen liegen sah; um ein Fahrzeug, das mir, ob auch nun sein letzter Span längst im See versunken ist, nicht aus der Erinnerung kam.
Von diesem Fahrzeug und seinem Herrn möchte ich etwas erzählen.
Girgel Söllhuber, so hieß der letzte Eigenthümer des Fahrzeugs, hatte eine etwas unklare Vergangenheit. Man erzählte im Dorf, er hätte einmal studieren sollen, aber nichts getaugt. Sicherer ist, daß er’s in seiner Jugend mit verschiedenen Handwerken probierte, ohne es in einem derselben über die Lehrlingsstufe hinauszubringen. Schließlich nahm ihn ein Vetter, der in einem benachbarten Städtchen ein ziemlich blühendes Anstreichergeschäft betrieb, noch einmal zur Probe als Lehrling an. Und dieser Beruf ward die Grundlage – wenn es überhanpt eine solche gab – für Girgels späteres Leben.
Girgels Meister war ein ganz tüchtiger Handwerker; nur die künstlerische Ader fehlte ihm. Die aber besaß der Girgel in reichem Maße. Nun mußte dazunal ein Anstreicher in einem oberbayerischen Landstädtchen auch ein Stück von einem Künstler sein, denn er hatte nicht bloß Hochzeitskästen, Grabkreuze, Balkone und Fensterladen anzustreichen, sondern ebenso Wirthshausschilder und „Marterln“ zu malen. Die letzteren sind jene kleinen Täfelchen, welche das Landvolk zur Erinnerung an bedeutende Ereignisse, namentlich zur Erinnerung an Unglücksfälle
[865][866] aufzustellen liebt; entweder an der Unglücksstätte selbst oder in benachbarten Kapellen und Kirchen.
In solchen „Marterln“ zeigte sich Girgel als Meister. Seine kundige Hand zauberte mit überraschender Aehnlichkeit Holzknechte, die beim Fällen von Bäumen erschlagen wurden, Bauern, die unter den Rädern ihres Wagens einen jähen oder im tiefen Winterschnee einen langsamen Tod gefunden hatten, auf die kleinen Holztafeln. In herzbeweglichen Worten schrieb er dann noch mit recht lesbaren Buchstaben das Ereigniß unter das Bildchen und schloß mit der Bitte an den Wanderer, für das Seelenheil des Verunglückten ein Vaterunser zu beten.
Bei der ausgedehnten Kundschaft seines Meisters hatte Girgel bald nichts anderes mehr zu thun, als „Marterln“ zu malen.
Als der Meister starb und dessen Geschäft von einem Nachfolger angekauft wurde, mit welchem Girgel sich nicht vertrug, machte sich Girgel selbständig. Er siedelte sich in dem Dorfe am See an, wo er zwar kein Anwesen erwarb, aber wenigstens eine Stube, die ihm als Atelier und Schlafstätte diente. Der Ruf, welchen er sich als „Marterl“-Maler im Städtchen erworben hatte, war weit verbreitet, so daß er in den ersten Jahren seiner Selbständigkeit vollauf Beschäftigung fand. Er erhielt für ein „Marterl“ – je nach der Zahlungsfähigkeit des Bestellers – einen Gulden oder mehr, mitunter selbst einen Kronenthaler.
Wenn ich sage, er hatte vollauf Beschäftigung, so muß das richtig verstanden werden. Vollauf Beschäftigung, das hieß für den Girgel drei Tage Arbeit in der Woche und vier Feiertage. Was darüber war, das war ihm schon zu viel. So kam’s denn, daß ihm zuweilen das Geld ausging, trotz all seiner Kunst, und daß er eines schönen Tages von einer Kunstreise hemdärmelig, ohne Rock nach Hause kam, weil er den letzteren in einem ziemlich entlegenen Wirthshaus als Pfand hatte zurücklassen müssen. Gerade damals hatte er aber besonderes Glück. Ein Schiff mit Wallfahrern war im See untergegangen; da bekam der Girgel eine Menge „Marterln“ zu malen und konnte nicht bloß seinen Rock wieder auslösen, sondern erhielt noch ein weiteres Kleidungsstück dazu. Ein reicher Bauer aus dem Unterlande nämlich, dessen Schwiegermutter mit unter den verunglückten Wallfahrern gewesen war, zahlte dem Girgel nicht bloß drei Kronenthaler für das „Marterl“, sondern schenkte ihm außerdem eine neue Lederhose.
Das war die höchste Bezahlung, welche Girgel in seinem Leben für ein Kunstwerk davongetragen. Aber er war mit den Ergebnissen seiner Kunst nicht zufrieden. „Ich bin ein Sonntagskind und muß noch ein großes Glück erwischen!“ Das war seine ständige Redensart. Auf seine Sonntagskindschaft sündigte er, wenn er die Kundschaften warten ließ und, statt die bestellten „Marterln“ zu malen, im benachbarten Brauhause hinter dem Maßkrug saß.
In jener Zeit erwarb er sich den Uebernamen, der ihm bis über seinen Tod hinaus verblieb, den Namen „Tuifelmaler“. Es werden nämlich mitunter „Marterln“ bestellt, auf welchen nicht nur irdische Vorgänge, sondern auch Fegfeuer und Hölle zur Erscheinung kommen sollen. Und darin zeigte nun der Girgel eine ganz besondere Kühnheit der Erfindung und der Ausführung. In eine Wegkapelle bei Ramsau malte er das Paradies, das Fegfeuer und die Hölle auf einer einzigen Tafel: das Paradies himmelblau mit weiß, rosa und lichtgrün; das Fegfeuer aschgrau mit einem Stich ins Schweflichte; die Hölle kohlschwarz, blutroth und feuergelb, mit auserlesenen Teufeleien gefüllt. Ein Erfolg dieses Kunstwerks war, daß auswärtige Kundschaften fast nur mehr nach dem „Tuifelmaler“ frugen, wenn sie etwas von ihm haben wollten.
Jeden Tag, oft aber auch zweimal im Tage, saß der Girgel in der Schenke des Brauhauses. Daselbst war eine Kellnerin, die Liesei, ein braves und hübsches Mädchen mit hellen Augen und fleißigen Händen. Die hätte den Girgel wohl mögen, wenn er weniger im Wirthshaus und fleißiger bei seinen „Marterln“ gesessen hätte. Aber es war nichts zu machen mit dem Menschen. Statt ernster und tüchtiger ward er von Woche zu Woche liederlicher. Er hatte auch den richtigen Kumpan dazu gefunden in der Person des Schratzen-Wastl, eines verkommenen Zimmergesellen, der die wüstesten Lieder singen konnte im Umkreis von sechs Wegstunden.
Der Schratzen-Wastl starb eines jähen Todes. Er fiel, weil er zu viel getrunken hatte, vom Dach des Brauhauses, wo er neue Schindeln aufnageln sollte. Aus der Verlassenschaft des Schratzen-Wastl aber erstand Girgel dessen Einbaum. Der war das schlechteste Schiff am ganzen See, schwarz vor Alter, schief gedreht vom Sturm der Zeit und reichlich durchlöchert.
Girgel aber richtete dieses Fahrzeug seltsam her. Außen an den hochaufstrebenden Bug malte er, wie in die Kapelle bei Ramsau, Himmel, Fegfeuer und Hölle. Dem Himmel hatte er freilich nur ein kleines Fleckchen gelassen, den meisten Raum nahm die Hölle ein. Dieses Fahrzeug ward Girgels Heimwesen; vorn im Schnabel des Kahns richtete er sich eine Moosstreu zurecht und schlief zur Sommerszeit oft Wochen lang nur noch in seinem Schiffe. Wenn er kein Geld mehr hatte, um im Brauhaus zu trinken, und keine Lust, in seiner Werkstatt zu arbeiten, saß er draußen im See und fischte. Fuhr aber einer aus dem Dorfe vorüber und frug etwa spottend: „Girgel, was fangst?“ – dann rief er gleichmüthig: „Ich bin ein Sonntagskind und muß doch noch mein Glück erwischen.“
Die blonde Liesei sah ihm oft nach, wenn er so in den See hinausfuhr, und jedesmal kam ein Seufzer aus ihrem Herzen. Ein seidenes Tuch, das er ihr einst unter Betheuerungen seiner Liebe geschenkt, hatte sie zwar genommen, aber dazu gesagt: „Girgel, ich heb’ Dir’s auf! Tragen thu’ ich’s nicht eher, das Tüchel, als bis Du ein ordentlicher Mensch geworden bist!“
Der Girgel ward jedoch kein ordentlicher Mensch mehr, sondern fuhr fort, nach seinem Glück zu fischen. Einmal fing er auch wirklich etwas ganz Großes und Merkwürdiges. Ob es aber das Glück war, ist doch sehr zweifelhaft. Die Sache ging so zu:
Der Girgel saß eines schönen Tages wieder in seinem wüsten Fahrzeug draußen auf dem See und fischte. Da kam ein Schiff vorüber, drinnen der Gerichtsdiener vom königlichen Landgericht. Wie der den Girgel sah, rief er ihm zu, während er seinen Fährmann anhalten ließ: „Girgel Söllhuber, ich glaub’, ich hab’ was Gutes für Dich!“
„Nur her damit!“ antwortete dieser übermüthig. Und wie der Gerichtsdiener ein Schreiben hervorzog, um es dem Girgel zu geben, reichte dieser das Ruder hin, damit der Gerichtsdiener das Schreiben drauf legen sollte.
[867] „Wann's aber in See fallt,“ sagte der, „ich bin nit schuld!“ und legte das Schreiben auf das Ruder. Girgel jedoch war ungeschickt und warf das Schreiben in den See statt in sein Schiff. Indessen das Papier schwamm, und so hatte er’s sofort wieder herausgefischt. Und als er nun das Gerichtssiegel erbrach, stand in dem Schreiben, daß ein Vetter, der nach Rußland ausgewandert war, dem Girgel Söllhuber achtzehntausend Gulden vermacht habe und daß das Geld auch schon beim Landgericht hinterlegt sei.
Achtzehntausend Gulden waren damals ein großes Vermögen. Der Girgel dachte nichts anderes, als daß er sich nunmehr ein Anwesen kaufen, das Liesei heirathen und ein solider Mensch werden wollte. Wie er aber das Geld in Händen hatte, führte ihn sein Unstern nach München, und man hörte ein halbes Jahr laug in seinem Heimathsdorf nichts mehr von ihm. Das Liesei weinte bitterlich ihre letzten Thränen um den Menschen. Dann nahm sie sich tapfer zusammen und wenn jemand sie nach dem Girgel fragte, gab sie kurz zur Antwort: „Hab’ mir’s lang schon denkt! Er wird halt ganz verkommen sein!“
Ein halbes Jahr darauf erschien der Girgel wieder am See, und zwar sehr stolz. Er kam in einem mit zwei Schimmeln bespannten Wagen, an seiner Seite aber saß eine Dame im Federhut, die er als seine Frau bezeichnete. Er selber war städtisch gekleidet. Es stand ihm herzlich schlecht, allein er fühlte es nicht.
Eine Stunde lang saßen die beiden unter der Linde des Brauhauses und schauten in den See hinaus, das Frauenzimmer faul und gelangweilt, der Girgel trüb und nachdenklich. Ein paar von den Dorfbewohnern kamen zu ihrem Nachmittagstrunk; er begrüßte sie mit prahlerischer Herablassung, dann ließ er wieder einspannen.
Das Liesei ließ sich nicht sehen.
Als das Paar wieder abgefahren war, sagte der alte Braumeister: „Für zwei Jahrl’n langt’s vielleicht; hernach ist er fertig!“
Und er hatte recht. Nach zwei Jahren waren die achtzehntausend Gulden des Girgel dahin und seine „Frau“ desgleichen. Nun erschien er wieder im Seedorfe, schob sein altes Schiff wieder ins Wasser und fing an, wo er vor zwei Jahren aufgehört hatte. Als er zum ersten Male ins Brauhaus kam, brachte ihm der Braumeister ein kleines Paket.
„Vom Liesei!“ sagte er trocken.
Girgel schlug das Papier auseinander und fand ein rothseidenes Tüchelchen, das noch nie getragen war. Schweigend steckte er’s in die Tasche seines zerschlissenen Rockes. Und als er aufstand, sah man, daß er ein altes Männchen geworden war in den zwei Jahren, obwohl er vielleicht erst vierzig zählte.
Der Girgel wollte nun wieder „Marteln“ malen. Aber die Kundschaft hatte sich verlaufen, kaum daß er hie und da ein Grabkreuz anstreichen durfte. Er mußte ein kümmerlicher Tagelöhner werden, dessen man sich auch nur bediente, wenn gerade kein besserer zu haben war. Als der Frühling kam und mit ihm der Fremdenzug nach dem schönen See, fing der Girgel an, sein Brot als Ueberführer zu verdienen. Da fiel doch manchmal eine Kleinigkeit ab.
Indessen nahm auch das ein schlimmes Ende.
Das alte Schiff des Girgel war schon unter seinem Vorgänger recht schlecht gewesen, und der Girgel hatte es nicht jünger gemacht. Es war eine wacklige Ruine geworden, trotz der immer noch sichtbaren schönen Verzierung am Schnabel. Risse klafften darin, breiter als ein Messerrücken; und es half nur wenig, daß Girgel Moos hineinstopfte und Eisenklammern hineinschlug. Als nun eines Tages der Herr Landrichter mit seinem Schreiber herüberkam zur Schiffsvisitation, ward das Fahrzeug des Girgel als das schlechteste am ganzen See befunden und der Landrichter sagte in ernstem Tone: „Girgel, Du thust mir leid! Wenn Du selber in Deinem Schiffe ersaufen willst, kann ich nichts dagegen haben. Aber Fremde darfst Du mir in diesem Schiffe nicht mehr fahren, sonst laß’ ich einen Zimmermann kommen und es zerschlagen.“
Schweigend hörte der Girgel das an; als aber der Landrichter fortgefahren war, nahm er aus seinem dürftigen Werkzeug eine Axt und aus der Truhe, in der er seine wenigen Habseligkeiten barg, ein rothseidenes Tuch. Die Axt legte er in sein Schiff; das Tüchlein band er an einen Stecken und steckte denselben als Fähnchen auf den Bug des Fahrzeugs. So sahen ihn ein paar Fischer in den See hinausfahren.
Es war das letzte Mal, daß man ihn überhaupt sah. Viele Mouate später fand man an einem ganz entlegenen Waldufer, wo der Seegrund jach in seine größte Tiefe abstürzt, etliche Reste eines zerschlagenen Schiffes. Sie waren offenbar mit Absicht zerstreut und das Meiste in den See geworfen worden, wo das schwere alte Eichenholz sogleich versunken war. Nur an einem Reste des Schiffsschnabels erkannte man eine verblaßte Malerei; es war das Einzige, was vom Fahrzeug des Tuifelmalers Zeugniß gab.
Neben diesem Wrackstück steckte ein Stab im Uferkies, an dem ein von Wind und Wetter übel zugerichteter Seidenfetzen hing.
Das war der Abschiedsgruß, welchen Girgel der Welt zurückließ. Für seine Heimath blieb er fortan ein Verschollener, ein abgerissener Faden. Ob er, nachdem er sein Schiff zerschlagen, in den See gesprungen oder in die weite Welt gegangen sei – darüber hat man nie wieder Zuverlässiges vernommen. Rach Jahren brachte ein Viehhändler die Kunde, drüben im Oesterreichischen, am Attersee, hause ein berühmter Marterlkünstler, der kennte das Fegfeuer malen wie sonst niemand in der Welt, so daß man meine, es brenne einen schon.
Es ist nicht unmöglich, daß dieser Künstler unser Tuifelmaler war.
[868]
Landwehrlied.
Wie sich auch brüstet
Der Feinde Macht,
Wir sind gerüstet,
Wir halten Wacht.
Es steht die Landwehr treu und fest und stark,
Wie glorreich sie gestanden immerdar,
Des deutschen Landes Kraft, des Volkes Mark,
Ein sich’rer Horst dem kaiserlichen Aar.
Die Fahne hoch, dem Kugelregen
Die muth’ge Mannesbrust entgegen!
Zum Kampf, zum Siege sturmgeschwind!
Es harren unser Weib und Kind,
Des Hauses Glück, der Heimath Segen.
Da ragt der Älte
Im Steingewand!
Die Wolke ballte
Die starke Hand:
Die Heereswolke mit dem Siegesblitz,
Einst schuf sie Scharnhorst aus des Volkes Kern,
Und an der Katzbach und bei Dennewitz
Verhüllte sie des Welterob’rers Stern.
Die Fahne hoch, dem Kugelregen
Die muth’ge Mannesbrust entgegen!
Zum Kampf, zum Siege sturmgeschwind!
Es harren unser Weib und Kind,
Des Hauses Glück, der Heimath Segen.
Und wieder lohte
Des Krieges Brand,
Der Feind bedrohte
Das deutsche Land
Da nah’n die Kaisergarden siegesfroh –
Sie sind wie einst dem Untergang geweiht;
Geboren wird ein zweites Waterloo,
Es ist Sedan getauft für alle Zeit.
Die Fahne hoch, dem Kugelregen
Die muth’ge Mannesbrust entgegen!
Zum Kampf, zum Siege sturmgeschwind!
Es harren unser Weib und Kind,
Des Hauses Glück, der Heimath Segen.
Im Feld geschlagen
Der Feind erliegt –
Die Festen ragen
Noch unbesiegt.
Vor ihren Wällen ein lebend’ger Wall,
So spannten wir um sie ein eisern Netz;
Sie brachen’s nicht, sie wichen überall,
Und unser ward das alte deutsche Metz!
Die Fahne hoch, dem Kugelregen
Die muth’ge Mannesbrust entgegen!
Zum Kampf, zum Siege sturmgeschwind!
Es harren unser Weib und Kind,
Des Hauses Glück, der Heimath Segen.
Und Belfort lauert
An Deutschlands Thor,
Reckt hingekauert
Das Haupt empor,
Zum Sprung bereit hinein ins deutsche Land,
Aus feur’gen Nüstern sprühend Todesgraun;
Gefesselt ward’s von unsrer tapfern Hand,
Wir haben ihm die Tatzen abgehaun.
Die Fahne hoch, dem Kugelregen
Die muth’ge Mannesbrust entgegen!
Zum Kampf, zum Siege sturmgeschwind!
Es harren unser Weib und Kind,
Des Hauses Glück, der Heimath Segen.
Und immer preisen
Und feiern wir
Ums Kreuz von Eisen
Des Lorbeers Zier!
Der Lorbeer ist’s, den Dank und Liebe flicht,
Der Ruhm, den keine künft’ge Zeit begräbt.
Die Landwehr stirbt, doch sie ergiebt sich nicht!
Die Landwehr lebt, solang ein Deutsckland lebt;
Die Fahne hoch, dem Kugelregen
Die muth’ge Mannesbrust entgegen!
Zum Kampf, zum Siege sturmgeschwind!
Es harren unser Weib und Kind,
Des Hauses Glück, der Heimath Segen.
Rudolf von Gottschall.
BLÄTTER UND BLÜTHEN.
Werner von Siemens. (Mit Bildniß.) Zu Anfang der vierziger Jahre saß auf der Citadelle von Magdeburg ein junger preußischer Artillerielieutenant als Gefangener. Er hatte in einem Duell als Sekundant gedient und sollte diese Missethat nach dem Wortlaut der damals geltenden strengen Gesetze wider das Duellieren mit fünf Jahren Festungshaft büßen. In seiner Zelle aber sah es sonderbar aus. Sie glich einem richtigen chemischen Laboratorium, und der junge Offizier hätte können für einen der alten Alchimisten gehalten werden, die man einsperrte, damit man des von ihnen zu gewinnenden Goldes gewiß habhaft werde. Denn er hielt in der Hand einen schönen goldigen Theelöffel, und auf seinem Gesicht lag freudige Erregung.
Der Gefangene hieß Werner Siemens und der goldige Theelöffel vertrat seine erste Erfindung. In der Stille seiner Haft hatte er Versuche mit der galvanischen Vergoldung und Versilberung angestellt, und als ersten Triumph seines Forschens zog er den im reinsten Goldglanz schimmernden, ursprünglich neusilbernen Theelöffel aus der unterschwefligsauren Goldlösung. Und so eifrig war er bei seinen Arbeiten, daß er seine schon nach einem Monat eintreffende Begnadigung geradezu als eine Störung empfand.
Der Artillerieoffizier, der damals die ersten tastenden Schritte auf dem Gebiet der Elektrolyse that, hat nachher die Welt mit den großartigsten Früchten seines Geistes beschenkt. Er gehört zu den Männern, welche die Telegraphie zum leistungsfähigen Verkehrsmittel ausbildeten, und hat, vieler anderer nicht zu gedenken, die erste größere Telegraphenlinie nicht nur in Deutschland, sondern in Europa gebaut, diejenige von Frankfurt nach Berlin. Er hat 1857 das erste gelungene Tiefseekabel von Sardinien nach Bona in Afrika legen helfen und später mit seinen ihm an Genialität und Schaffenskraft fast gleichstehenden Brüdern Wilhelm und Karl bahnbrechend für die transatlantische Kabelverbindung zwischen der Alten und Neuen Welt gewirkt. Als die dänische Flotte im heißen Jahre 1848 Kiel bedrohte, da reifte in ihm die Idee der elektrischen Minenzündung, und sofort stellte er sie sammt seiner Person in den Dienst der vaterländischen Sache. Er ist der Schöpfer der dynamo-elektrischen Maschine, die heute schon in hundertfältiger Verwendung die geheimnißvolle Kraft der Elektricität dem Menschen dienstbar macht. Und in zahllosen anderen großen und kleinen Erfindungen und Entdeckungen hat er, man darf es wohl ohne Einschränkung sagen, als der erste mitgewirkt an dem riesigen Fortschritt, welchen die NaturWissenschaft in ihrer technischen Verwendung während der letzten fünf Jahrzehnte gemacht hat.
Aus dem knapp gestellten Lieutenant, der die für jene erste Erfindung von einem Juwelier gelösten vierzig Louisdors recht gut brauchen konnte, wenn er nicht auf die Fortsetzung seiner wissenschaftlichen Versuche verzichten wollte, ist aber auch einer der reichsten Männer geworden, dem die irdischen Schätze in Fülle zu Gebote standen, den die Großen der Erde mit Orden und Auszeichnungen überhäuften, den gelehrte Körperschaften von höchstem Range zu ihrem Mitglied beriefen und den die erste Universität des Reiches schon vor zweiunddreißig Jahren zum Doktor honoris causa ernannte. Aus der kleinen Werkstatt, die Siemens 1847 zusammen mit seinem langjährigen treuen Gefährten Halske mit Hilfe eines geliehenen Kapitals in der Schöneberger Straße zu Berlin anlegte, ist ein Welthaus erwachsen, das neben dem Hauptgeschäft in Berlin Zweiganstalten in Charlottenburg, Petersburg, Wien und Tiflis unterhält und aus dem auch das jetzt selbständige Londoner Haus hervorgegangen ist.
Siemens war ein Mann aus eigener Kraft, eine Charakterfigur in unserem Zeitalter, wie wir sie uns bezeichnender und zugleich wohlthuender nicht denken können. Er freute sich dessen, daß es ihm gelungen war, seine günstige Lebensgestaltnng der eigenen Arbeit zu verdanken. Aber er war doch zu klug und zu bescheiden, um die glücklichen Umstände zu übersehen, welche zu seiner Förderung beitrugen. Er rechnete dahin schon seine Aufnahme in die preußische Armee und in den Staat des Großen Friedrich; noch mehr aber das glückliche Zusammentreffen, daß sein Leben gerade in die Zeit der schnellen Entwicklung der Naturwissenschaften fiel und daß er sich „besonders der elektrischen Technik schon zuwandte, als sie noch ganz unentwickelt war und daher [869] einen sehr fruchtbaren Boden für Erfindungen und Verbesserungen bildete“. Und noch etwas war es, was Werner Siemens stützend und hebend zur Seite stand: seine Brüder! Wie glücklich und anregend das Verhältniß insbesondere zwischen Werner, Wilhelm und Karl war, das bildet einen der schönsten Züge in den „Lebenserinnerungen“, die Werner während der letzten Jahre in der Stille seines Sommersitzes zu Harzburg aufgezeichnet hat.
Werner Siemens stammt aus einer sehr kinderreichen Familie. Schon sein Vater war der jüngste von fünfzehn Sprößlingen, und aus seiner Ehe mit Eleonore Deichmann gingen zehn Kinder hervor, von denen Werner der älteste, am 13. Dezember 1816 geborene Sohn war. Den Elterb ging es nicht gut mit ihrer Landwirthschaft, die sie erst zu Lenthe bei Hannover, dann zu Menzendorf in dem zu Mecklenburg-Strelitz gehörigen Fürstenthum Ratzeburg betrieben. Strapazen, Kummer und Sorgen rieben erst der heißgeliebten Mutter Kräfte auf. Sie starb im Juli 1839, und als ihr der Vater ein halbes Jahr darauf nachfolgte, da sah sich Werner vor die Aufgabe gestellt, im wesentlichen die Sorge für seine jüngeren Brüder zu übernehmen. Und er that dies mit der ganzen zielbewußten Thatkraft seines Wesens; diese Sorge ist ihm zum mächtigen Sporn geworden und sie hat ihm wiederum das Glüeksgefühl einer treu erfüllten Pfticht bereitet. Diese Sorge war auch der stärkste Grund, der ihn im Jahre 1849 zum Abschied aus dem von ihm hochgeschätzten Militärdienst veranlaßte. Er mußte Geld verdienen. In vierzehn Jahren hatte er es „eben über die Hälfte des Sekondelieutenants“ gebracht; er wurde mit dem Charakter eines Premierlieutenants verabschiedet. Im Laufe der Zeit sind fast alle Brüder in den großartigen Unternehmungen Werners zur Thätigkeit gekommen oder durch ihn zu selbständigen Stellungen gelangt.
Siemens war ein deutscher Patriot von edelster Gesinnung. Wie ihn einst die Schmach des zerrissenen Vaterlands, wie ihn insbesondere die Schmach Preußens im Jahre 1850 tief verdroß, so hat ihm auch der neue Glanz des geeinigten Vaterlandes in der Seele wohlgethan. Er giebt seinen Empfindungen einmal in seinen „Lebenserinnerungen“ einen sehr kräftigen Ausdruck. Siemens befand sich in Spanien, als 1864 die preußische Kriegserklärung an Dänemark erfolgte. Darob große Wuth in den englischen und französischen Zeitungen über die „eroberungssüchtigen“, „kriegslustigen“, ja „blutdurstigen“ Deutschen. „Ich muß gestehen,“ sagt er, „daß mir dies keinen Verdruß, sondern große Freude bereitete. Meine Selbstachtung als Deutscher stieg bei jedem dieser Ausdrücke bedeutend.“ Der Ehre der deutschen Industrie im In- und Ausland galt der wesentlichste Theil seiner politischen Thätigkeit – er war der Leiter der Bewegung für ein deutsches Patentgesetz und jahrelang Mitglied des Patentamtes. Der Ehre der deutschen Industrie suchte er vor allem selbst durch tadellose Fabrikate zu dienen. Und auch wo ihm selbst Vortheille zuflossen, kam seine Arbeit dem Gemeinwohl zu gut.
Er war zweimal verheirathet, das erste Mal mit Mathilde, der Tochter des Königsberger Geschichtsprofessors Drumann, die ihm nach dreizehnjähriger glücklicher Gemeinschaft im Jahre 1865 entrissen wurde. Zwei Söhne und zwei Töchter entstammen dieser Ehe. Im Jahre 1869 führte er Antonie Siemens, eine entfernte Verwandte, als zweite Gattin heim, und unter den aufsteigenden Wetterwolken des großen Kriegs wurde ihm eine Tochter geboren, der später noch ein Sohn folgte.
Mit Frau und jüngster Tochter hatte Werner im Winter 1891 bis 1892 den Süden aufgesucht, um sich von einem Influenzaanfall zu erholen. Anfang Mai kehrte er in die Heimath zurück, und nachdem er noch zweimal heftige Fieberanfälle überwunden hatte, hielt er selbst die „Krankheitsperiode seines Alters“ für beendet und hoffte, daß ihm noch ein ruhiger und heiterer Lebensabend beschieden sein werde. Es ist anders gekommen. Noch beendete er seine schönen „Lebenserinnerungen“, die, mit dem von uns verkleinert wiedergegebenen Bildniß geschmückt, in seinen letzten Lebenstagen bei J. Springer in Berlin erschienen sind, da aber trat ihn ein neuer Anfall der Influenza und eine rasch verlaufende Lungenentzündung an, der er am 6. Dezember, nicht ganz 76 Jahre alt, erlegen ist. Und wehmüthig prophetisch klingen heute die Worte, mit denen er seine Erinnerungen schloß: „Mein Leben war schön, weil es wesentlich erfolgreiche Mühe und nützliche Arbeit war, und wenn ich schließlich der Trauer darüber Ausdruck gebe, daß es seinem Ende entgegengeht, so bewegt mich dazu der Schmerz, daß ich von meinen Lieben scheiden muß und daß es mir nicht vergönnt ist, an der vollen Entwicklung des naturwissenschaftlichen Zeitalters erfolgreich weiter zu arbeiten.“
Einsamer Posten. (Zu dem Bilde S. 857.) Robert Warthmüller, der Zeichner unseres stimmungsvollen Bildes, hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, das militärische Leben zur Zeit Friedrichs des Großen in treuer fesselnder Darstellung zu schildern, und er ist der Mann dazu, diese Aufgabe zu lösen. Wie echt muthet uns dieser „einsame Posten“ an, wie trefflich stimmt der landschaftliche Hintergrund zu der Zeit, in die uns die kraftvolle kecke Gestalt des Soldaten versetzt! Sicherlich führt der verschneite Parkweg zu irgend einem kokett versteckten Rokoko-Schlößchen, wo sich vielleicht „Serenissimus“ die Langeweile des trüben Wintertages mit allerlei Festlichkeiten vertreibt, wo vielleicht auch große Entschlüsse der hohen Politik erwogen werden – der Maler überläßt es unserer Phantasie, das bewegte Leben sich auszudenken, das sich hinter dieser Einsamkeit verbirgt.
Das Perchtenlaufen. (Zu dem Bilde S. 841) Perchtha, Berchtha oder Bertha war in der Vorstellung der alten Germanen die Gemahlin Wodans, an dessen wilder Jagd sie theilnahm, die Göttin, die Sonnenschein und Regen spendete und ebensowohl heiter und gnadenreich wie furchtbar sein konnte. Selbst Spinnerin, überwachte sie das Spinnen und Weben der Frauen, lohnte die fleißigen, strafte die trägen.
Als die Spinnerin blieb sie den nachfolgenden Geschlechtern christlichen [870] Glaubens am lebendigsten. Im Vogtland und im Orlagau untersucht Frau Perchtha am Abend vor dem Dreikönigstag die Spinnstuben, bringt den Spinnerinnen leere Spulen mit der Weisung, daß dieselben in einer bestimmten Frist vollgesponnen sein müssen, und straft mit Verwirrung und Verunreinigung des Flachses, wenn das Geforderte nicht geliefert wird. Aehnlichem Glauben begegnen wir in Tirol. Vor den Weihnachtsfeiertagen ist es gebräuchlich, die Flachs- und Wergwickel vom Rocken ganz fertig zu spinnen, sonst nistet die Perchtl darin. Auch in Wälschtirol ist die Spinnerin Perchtha nicht unbekannt. In Trambileno, unweit von Rovereto, sind die „Froberta“, die „bilden Beiber“ und der „Bedelman“ (wilde Mann) wohlbekannt, und der letzte Faschingstag heißt dort noch jetzt „il giorno delle Froberte“. Im Ronchithal (nördlich von Ala) saßen eines Abends zwölf Weiber beim Spinnen, da klopfte es an die Thür, und herein trat Frau Bertha. „Padrona, Froberta dal nas longh!“ („Seid gegrüßt, Frau Bertha mit der langen Nase!“) riefen die Frauen, denn so mußte man sie immer anreden; und eine stand auf und räumte der Frau Bertha ihren Platz ein. Alsbald indes klopfte es wieder, und eine zweite Frau Bertha mit einer noch längeren Nase erschien. Man bietet ihr den gleichen Gruß und auch ihr macht eine der Spinnerinnen Platz. Aber es klopfte fort und fort, und jede neu ankommende Frau Bertha hatte eine längere Nase als die anderen, bis endlich das Dutzend voll war. Die zwölfte hatte die allerlängste Nase, und die Unholdinnen saßen auf den Stühlen, die Weiber aber standen und zitterten. Zwar kamen sie mit dem bloßen Schrecken davon, immerhin aber nahmen sie das nächste Mal einen Mann in die Spinnstube mit und versteckten ihn. Als dann die Frauberte wieder sich einstellten, sprang er hervor und erschlug alle zwölf. – Auch unheimlich, doch wenigstens in der Einzahl bleibt die Perchtha, wenn sie in Tirol am Abend vor den heiligen Dreikönigen als steinaltes Mütterchen in den Häusern erscheint, um von den Speisen zu kosten, die man vom Nachtmahl für sie übrig läßt. Dann hat sie ein Gefolge von Kindern mit sich. Kinder, die ungetauft gestorben sind, zerlumpte Kinder mit flatterndem Haar. Daher werden ungekämmte Kinder im Innthal „Berchteln“ genannt, und im Pusterthal heißt infolge der ganzen Sage der Dreikönigstag auch der „Perchtentag“. Im Laufe der Zeit ist in Alpach und Umgegend die strahlende Perchtha der Germanen zur Frau des Pilatus geworden, die bis zum jüngsten Tag verdammt ist „umzugehen“.
Aber anderer Glaube, anderer Brauch weisen wieder sonnenklar auf ihre Gemeinschaft mit Wodan, dem wilden Jäger, auf ihre Theilnahme an seinen schauerlichen Heer- und Jagdfahrten hin. Am Nikolausabend laufen im Unterinnthal, Pusterthal u. s. w. verlarvte Bursche umher, bewerfen die Leute mit Kehricht und Kohlblättern und lärmen wie die wilde Fahrt. Diese Winterposse heißt man das „Perchtenlaufen“. Auch bei Lienz war früher das Perchtenlaufen üblich. Es war eiue Art Maskenzug. Die Vermummten hießen Perchten. Man unterschied „schöne“ und „schieche“ (häßliche) Perchten. Jene waren schön gekleidet und geschmückt; letztere zogen sich so häßlich wie möglich an, behängten sich mit Ratten und Mäusen, Ketten und Schellen. So ausgestattet, sprangen und liefen sie über die Gassen und kamen auch in die Häuser. Es ging laut und fröhlich her, wenn die wilde Perchtha nicht selbst darunter kam. In diesem Fall liefen die Perchten bald aus Furcht auseinander, denn wer nicht in den Bereich einer Dachtraufe und damit in den Hausfrieden gelangte, wurde von der Wilden zerrissen. Noch heute zeigt man Stätten, wo von der wilden Perchtha zerrissene Perchten begraben liegen sollen. Aehnlich, aber ohne die Furcht vor der wahren Perchtha, und zu anderer Zeit, nämlich in den Nächten zwischen Weihnacht und Neujahr, geht der „Perchtenlauf“ im Salzburger Gelände vor sich. Und von diesem giebt uns das Bild Oskar Gräfs eine lebendige Vorstellung. Männer, in Felle gehüllt, den bekannten Jägerhut mit gesträubten Federn bekränzt, das Gesicht durch Ruß und falsche Riesenbärte entstellt, „die wilden Perchten“, stürzen durch die nachtschlafenden Dörfer, schwingen lodernde Fackeln und machen mit Kuhglocken, Schlittenschellen, Stierhörnern und Kupferkesseln einen Heidenlärm, wie weiland die Anbeter der Kybele, die wuthfreudigen Korybanten. Aber es ist ein gemüthliches „wildes Heer“. Außer ihren barbarischen Instrumenten führen sie auch Geige und Zither („Brettl-Zither“) mit sich. Es sind gesunde, „trinkbare“ Gespenster. Denn wo ein gastlich Haus ist, das wissen sie genau und da kehren sie ein.
Um aber vollends unserer Zeichnung und unserer Schilderung alles Grausige zu nehmen, erinnern wir unsere Leser daran, daß in eben der Zeit, wenn Perchtha und die wilden Perchten ihr Unwesen treiben, in Salzburg wie in Tirol die allerfriedlichsten Gesellen, die guten armen „St[...]nger“, gleichfalls ihren Umgang halten. Unter dem glitzernden Him[mel] ragen mit verschneiten Gipfeln die ernsten Berge; ferne schwarze Wälder gleichen rathlosen Heerzügen. Da zuckt in der schneeverwehten Dorfstraße das armselige Licht einer Stocklaterne auf, und in der feierlichen Winternacht singen – nicht gerade schöne, aber kindliche Stimmen:
Mir san die heilig’n drei König’ mit ihrem Stern,
Da’ Kaspar, da’ Melcher und Waldhauser …. K. H.
Blumenschrift im Buche der Geschichte. Obgleich zu den vergänglichsten Dingen der Schöpfung gehörend, können die „stillreizenden Naturkinder“ – wie Goethe die Blumen und Pflanzen nannte – doch auch als dauernde Zeugen in der Weltgeschichte auftreten.
So haben die großen geschichtlichen Ereignisse, welche sich in der Wiener Gegend abspielten, auch in der schönen Flora derselben manch Denkzeichen hinterlassen. An die Herrschaft der Römer erinnert wie an vielen Orten Deutschlands so auch bei uns das unscheinbare Wand- oder Glaskraut (Parietaria officinalis), dessen Blätter znm Glasreinigen hie und da verwendet werden. Sein ursprünglicher Standort war an den Mauern und Wällen der römischen Kastelle. Von da aus gelangte es an Schuttplätze und ähnliche Orte, auch in die Auen der Donau, wo es stellenweise förmliche Dickichte bildet.
Nach der zweiten Türkenbelagerung Wiens (1683), an welche das nun vor der neuen Universität aufgestellte Denkmal des wackeren Bürgermeisters Liebenberg erinnert, blieb zugleich ein kleines Gewächs als Denkzeichen zurück, dessen Same wohl den Fouragesäcken der türkischen Rosse entstammt: es ist dies das syrische Schnabelschötchen (Euclidium syriacum). Mehr Andenken aus dem Reiche Floras hat indessen das längere Schalten der Türken in Ungarn hinterlassen. Der Feigenbaum auf dem Ofener Blocksberg steht seit der türkischen Herrschaft. Ferner haben die „barbarischen“ Türken den anmuthigen Flieder, die Tulpe, die „brennende Liebe“ (Lychnis chalcedonica), die Paeonie – magyarisch: basa-rósza, d. i. „Pascha-Rose“ – den syrischen Eibisch oder die Türkenrose (Hibiscus syriacus), die Kaiserkrone und Balsamine auf die ungarische Flur versetzt, von wo aus sie den Weg nach dem westlichen Europa gefunden haben. Wer die Geschichte der Zierblumen schreiben will, wird sich auch mit ihren volksthümlichen Namen zu beschäftigen haben, die oft deutlich auf den Einführungsweg hinweisen. Der Name „Tulpe“ z. B. kommt unmittelbar vom türkischen „tu1band“ oder „tulbent“, d. i. „Turban“, mit welchem die prächtige Blume ihrer Form wegen verglichen ward. Merkwürdig ist nun, wie sich in dem „Dulibana“ und „Tulapana“ der niederösterreichischen Mundart eine der ursprünglichen sehr nahestehende Form erhalten hat. Am Rheine, in der Gegend von Aachen, sagen die Leute „Tulepant“. Auch Immermanns „Tulifäntchen“ – das Kind eines Geschlechtes, welches die Tulpe im Wappen führt – klingt hier an.
Im warmen Wasser des Bischofsbades bei Großwardein und des Kaiserbades bei Ofen wächst eine merkwürdige Seerose, die Nymphaea thermalis, welche der ausgezeichnete Kenner dieser Gattung, Caspary, für ein und dieselbe Pflanze mit der ägyptischen Lotosblume erklärte. Man steht dem Vorkommen dieser ausgesprochenen Tropenpflanze in unseren Himmelsstrichen als einem pflanzengeographischen Räthsel gegenüber, das zu lösen sich verschiedene Gelehrte Mühe gegeben haben. Borbas hält dafür, daß auch diese Seerose von den Türken nach Ungarn gebracht worden sei. Kerner aber, der geistvolle Verfasser des „Pflanzenlebens“, sieht die Nymphaea thermalis als letzten Rest jener südländischen Flora an, welche vor der Eiszeit Europa mit Palmen, Pisangen etc. überdeckte und als wahres Paradies erscheinen ließ. An diesem einen Beispiel zeigt sich, zu welch weiten Ausblicken die Gewächse Anlaß geben, und daß Botaniker sein heutzutage nicht bloß Staubgefäßzählen heißt.
Gleichfalls an die Türkenzeit gemahnt eine Blumensage in Kärnthen. Die allgemein bekannte, duft- und blüthenreiche Erdscheibe (Cyclamen europaeum), welche auch auf den Hängen des Wiener Waldes reizende Arabesken bildet, wird in Kärnthen „Türkenkraut“ genannt, und zur Erklärung dieses Namens erzählt man folgende Geschichte: Als die Türken in Krain einfielen, da flüchteten Frauen und Kinder vor den rauhen Horden über die Karawanken ins Kärnthner Land. Aber die Heiden zogen ihnen nach und metzelten sie nieder. Der Boden trank das Blut der Unschuldigen und ließ zum Gedächtniß für ewige Zeiten das Türkenkraut hervorsprießen, dessen Blätter seither an der Unterseite blutig geröthet sind. Die Sage des Volkes bemächtigte sich hier der Erscheinung, daß die Blätter der Erdscheibe an der Unterseite durch wirkliches Blumenroth gefärbt sind.
Aber auch außerhalb Oesterreich-Ungarns treffen wir allenthalben auf Beispiele der nahen Beziehungen, in welchen die Blumen zu der Weltgeschichte stehen. Der giftige Zwerghollunder oder Attich (Sambucus Ebulus), der gern an alten Burgen wächst, soll zur Zeit der Kreuzzüge durch Troßknechte, welche die Beeren als Heilmittel für die Pferde von jenseit der Alpen mitbrachten, in Deutschland angepflanzt worden sein. Jetzt sorgen die munteren Vögel für die Verbreitung der Pflanze, deren Beeren sie nachgehen. Durch die großartigen Truppenzüge, welche die Kriege zu Beginn unseres Jahrhunderts verursachten, ist das russische Corispermum Marschallii an den Rhein, die orientalische Zackenschote bis nach Paris gelangt. Die amerikanische Wanderpflanze Galinsoga parviflora (Gängelkraut), die jetzt sogar auf der Wiener Ringstraße die armen Götterbäume zu trösten sucht, trat in der Gefolgschaft der Napoleonischen Heere in Norddeutschland auf. Die mittelalterlichen Tatareneinfälle ließen in Mitteleuropa den Kalmus zurück, der jetzt zwar überall mit seinen langen Wurzelstöcken die Sümpfe durchflicht, seine wärmere Heimath jedoch durch den Umstand darthut, daß er bei uns niemals Samen ausreift.
Gustav Freytag, welcher im ersten Bande seiner „Ahnen“ duftigen Kalmus zum Feste ausstreuen läßt, begeht einen kleinen Anachronismus. Es ist möglich, daß auch der Stechapfel, dessen Name Datura (früher Tatura) an die Tataren erinnert, mit diesem Eroberervolk seinen Einzug in Europa hielt. Auch eine Kulturpflanze, der Buchweizen (Polygonum Fagopyrum), war vielleicht ursprünglich Trabant der asiatischen Eroberer. Hierfür spricht das slavische tattarka und tattar, dem freilich gretscka und gryka (Griechenkorn), sowie das italienische grano saraceno, endlich das französische blé sarasin (Sarazenenkorn) entgegenstehen. M. Couronne.
„Gesammelte Schriften“ von Marie von Ebner-Eschenbach. Eine Fülle dichterischer Kraft und geistiger Feinheit liegt in den sechs Bänden dieser „Gesammelten Schriften“ (Berlin, Paetel) beschlossen – und sie enthalten nicht einmal die ganze Summe dessen, was das Talent der österreichischen Dichterin geschaffen hat: neben dieser Sammlung laufen noch Schöpfungen her wie „Bozena“, „Margarethe“ und die „Erzählungen“, die im Cotta’schen Verlag erschienen sind. Marie v. Ebner-Eschenbach ist ebenso Meisterin der humoristischen Schilderung wie der tragischen Vertiefung, sie ist ebenso zu Hause im stillen Dorfe draußen wie unter den Menschen, den Leiden und Freuden der Großstadt. Und daß sie diese Fülle der Gestalten wiedergiebt mit einer herzgewinnenden Tiefe des Gemüths, in einer Sprache, die edel und markig zugleich ist, das wird ihren Schriften auch in dem vorliegenden Gewande zu den alten Freunden immer neue gewinnen.
[871] Erste Quittung über die Beiträge
Wie schwer ist es, einem Kinde die Heimath zu ersetzen! Aber daß die rechte Liebe auch hier Wunder zu thun vermag, zeigt unser Bild auf S. 869, das uns mitten hinein führt in den Jubel einer Weihnachtsbescherung für die Cholera-Waisen. Wie haben die Gaben, die von allen Seiten so reichlich geflossen sind, den Verlassenen die fremde Welt heimisch gemacht, wie rein ist das Glück, das aus den frischen Kindergesichtern leuchtet, und wie schön der Dank, der für alle die Geber in diesem Glücke liegt! Möge das kleine Bild in diesen Weihnachtstagen, wie es Freude schildert, so auch Freude wecken – Freude zum Helfen und Geben, wo irgend die Noth der Zeit an unser Haus und Herz klopft! Mit diesem Wunsche und dem herzlichsten Dank für die bisher der Sammlung zugewendeten Gaben, deren Summe den Betrag von 9496 Mark 68 Pf. erreicht hat, lassen wir nachstehend die erste Quittung folgen. Es gingen ein:
Maler A. Zick, München 20 ℳ; Albert X., Leipzig 2 ℳ; A. Böhme, Leipzig 1 ℳ; Marie
Bauer, Leipzig 4 ℳ; H. E., Berlin 1 ℳ; „Ein Scherflein“ aus Berlin 2 ℳ; N. N., Rüsselsheim
50 Pf; Frau Kittel geb. Kandler, Prag (5 fl.) 8 ℳ 50; W. Schlüter, Quedlinburg
2 ℳ; G. E. Tittel, Eibenstock 5 ℳ 05; G. S., G. 10 ℳ; X. X., Ludwigshafen 1 ℳ;
W., Dortmund 1 ℳ 40; Frau C. Meyer, Koblenz 1 ℳ; F. D., Leipzig 3 ℳ; C. H., Chemnitz
1 ℳ; mitleidsvolles Herz einer jungen Frau, Leipzig-Gohlis 50 Pf; Karl, Fritz und Lothar,
Cölln bei Meißen 2 ℳ 35; einige junge Mädchen, Leipzig 4 ℳ; Schüler R. Funk, Wesenberg
3 ℳ; F. S., Niemegk 5 ℳ; Pastor J., B. b. H. 1 ℳ; Kurt und Mama, Lengefeld
1 ℳ; L. Börner, Oberlößnitz-Radebeul 3 ℳ; Elsa und Käthe Taubert, Wurzen 2 ℳ; Bote
Helmold, Hannover 1 ℳ; C. A. T., Chemnitz 3 ℳ; Kantor A. Gläser, Hermsdorf-Katzbach
3 ℳ; aus Waldheim 1 ℳ; „Ein Scherflein“ aus Oberhausen 1 ℳ; Witwe, Naumburg
1 ℳ; aus Alfred u. Trude Kellers Sparbüchse. Koburg 2 ℳ; Lehrer M., Duisburg 1 ℳ;
A. H., Steinheim 1 ℳ; E. Küchler, Wöhlerschüler. Frankfurt 2 ℳ; Margot u. Annemarie,
Stralsund 2 ℳ; E. K., Steinpleis, seit 33 Jahren Leser der „Gartenlaube“, 1 ℳ; G. Messarius,
Iserlohn 3 ℳ; H. M., Swinemünde 3 ℳ; –r., Stettin 1 ℳ; Kränzchen „Vergißmeinnicht“,
Lausigk 3 ℳ; Hanni, Naumburg 1 ℳ; M., Nordhausen 1 ℳ; O. Th., Blankenstein 1 ℳ;
W. Hennig, Loburg 1 ℳ; jugendliche Leserin der „Gartenlaube“, Forchheim 1 ℳ 10; Buchhalter
K., Halle 1 ℳ; Leser der „Gartenlaube“, Ellwangen 5 ℳ; Betty Schmitt, Regensburg
50 Pf; J. Erber, Braunau (1 fl.) 1 ℳ 70; Gastw. J. Knittel, Braunau (1 fl.) 1 ℳ 70;
Verein ehem. Armen- u. Bezirksschüler, Leipzig 3 ℳ 40; L. T., H. S. u. E. S., Stuttgart
10 ℳ; aus Haida, Böhmen (5 fl.) 8 ℳ 50; aus Sebnitz in S. 20 ℳ; glückliche junge
Mutter, Plauen 20 ℳ; Frau M. Wiederholt, Frankfurt 5 ℳ; aus Kleinbresa 5 ℳ; Luise
F. u. Adolf R., Nürnberg 2 ℳ 50; Kinder Karrenstein, Düsseldorf 1 ℳ 50; H. Schulze,
Regiergs.-Sekr., Arnsberg i. W. 2 ℳ; Wwe. Fr. St., Kaiserslautern 3 ℳ; N. N.,
Zweibrücken 1 ℳ; Ungenannt, Remscheid 5 ℳ; A. u. E., Chemnitz 3 ℳ; F. u. H. Fuhrmann,
Wittenberg 10 ℳ; E. Lang, Eisleben 3 ℳ 05; Frau M. Beyer, Wormlage 20 ℳ; P. Fiedler,
Gera 6 ℳ; G. u. A. K., Liebstadt 8 ℳ; M. Thieme, Freiberg 3 ℳ; Frau C. Kauffmann,
Melsungen 3 ℳ; Apotheker Wortmann, Camen 10 ℳ 05; C. E. Benscheidt, Ronsdorf
20 ℳ; F. H., K. 10 ℳ; Elise verw. Gredy, Chemnitz 3 ℳ; Julie Wünscher, Thallwitz
10 ℳ; L. S., Delitzsch 5 ℳ; Liedertafel, Nerchau, durch E. Leicht 10 ℳ 20; Joh. Stöß,
Hainichen 10 ℳ; Francke, Delitzsch 10 ℳ; A. Brader, Chemnitz 10 ℳ; L. D., Stuttgart
5 ℳ; ehemaliger Hamburger, Mittweida 5 ℳ 05; Heidemann, Treptow (Tollense) 3 ℳ;
Erich und Hedwig, Nürnberg 4 ℳ 30; Emil K., Nürnberg 2 ℳ; Otto D., Nürnberg 2 ℳ;
Sophie, Nürnberg 1 ℳ; Br., Nürnberg 1 ℳ; G. N., Erlangen 3 ℳ; Dr. Schweitzer,
München 20 ℳ; Frau Käthe Werder, Nürnberg 10 ℳ; H. Dr., Erfurt 5 ℳ; H. G.,
Krefeld 6 ℳ; E. Schwartes, Czarnikau 10 ℳ; A. Gützlaff, Nörenberg 1 ℳ; F. M.,
Stralsund 3 ℳ; Elisabeth Jost, Liebenwerda 4 ℳ; „Ungenannt“, Gifhorn 5 ℳ; Kanzleirath
Wiedemann, Karisruhe 3 ℳ; aus Königsee 2 ℳ; R. Seidler, Berlin 3 ℳ; Bertha J.,
Berlin 3 ℳ; Dr. Liebe, Freiberg 3 ℳ; Kettembeil, Berlin Bellevuestr., 20 ℳ; C. Kohl,
Ebersdorf 5 ℳ; Anna und Carl, Frankfurt 2 ℳ 05; N. S. u. Co., Auerbach 100 ℳ; P.
Schönberger, Brünn 3 ℳ 40; Frl. v. Bischoffshausen, Kassel 3 ℳ; Fr. W., Mülheim 20 ℳ;
Familie Stoltz, Darmstadt 10 ℳ; Cucetius, Darmstadt 5 ℳ; E. Schmidt, Eisenberg 2 ℳ;
Tertianer W. Giese, Greifswald 1 ℳ; G. Neiprich, Sprottau 3 ℳ; Quartaner R. Rode,
Gelsenkirchen 2 ℳ; M. Fuchs, Limburg 5 ℳ; H. Uetrecht, Ludwigshafen 5 ℳ; aus Neuß
von 4 Familienangehörigen 4 ℳ; F. A. Nietel, Straß-Ebersbach 3 ℳ; aus Unna 1 ℳ 50;
Oberlehrer Henschen, Hagen 5 ℳ; N. N., Schweinitz 3 ℳ; Mara u. Herm. Brömel, Trebnitz,
Max Brömel, Leipzig 1 ℳ 50; 3 Geschwister nebst Cousine, Wettin 2 ℳ; Lehrer B. Riedel,
Leipzig 3 ℳ; H. B., Leipzig 3 ℳ; M. L., Nürnberg 4 ℳ 80; Lehrer Bläser, Tobertitz 2 ℳ;
4 Frauen aus Suhl 1 ℳ 50; aus Berlin 1 ℳ; S. B., Döbeln 2 ℳ; Leserin der „Gartenlaube“,
Friedberg 50 Pf; L. K., Rudolstadt 50 Pf; D. G. L., H. bei B. 3 ℳ; Frau H. G., Ansbach
2 ℳ; Frau B. Sch., Ansbach 20 Pf; Ungenannt, Ansbach 50 Pf; Wally, Ansbach 1 ℳ;
Tertianer E. v. d. Burchhard, Vöhl 50 Pf; Lehrer C. Bassa, Hatzfeld 1 ℳ; Carl A., Heiligenstadt (Eichsfeld) 2 ℳ; Großmutter, Mathilde, Anna u. Hans, Mittweida 6 ℳ; Abonnent K.,
Bremen 1 ℳ; Fischer u. Jung, Frankfurt a. M. 3 ℳ 65; C. A., Cottenheim 2 ℳ; C. Gauß,
Straßburg-Neudorf 2 ℳ 50; Frl. v. Scriba, Hannover 1 ℳ; M. J., Abonnent, Darmstadt
2 ℳ; S. G., Eßlingen 1 ℳ; langjähriger Abonnent, Pforzheim 2 ℳ; A. H., Verehrerin der „Gartenlaube“ 1 ℳ; E. Schmidt, Koburg 90 Pf; S. H., Ulm, aus der Sparbüchse meiner
Kinder 5 ℳ; Kinder W., Frankfurt, aus ihrer Sparbüchse 7 ℳ; G. K., St. S. 5 ℳ; K.,
Remscheid 5 ℳ; Amalie Busch, Lindenau 1 ℳ; D. S., Leipzig 1 ℳ; A. Neumärker,
Gerstungen 2 ℳ; Müller, Adorf 3 ℳ; M. Hofmann, Dresden 10 ℳ; H. G., Hannover
3 ℳ; E. G., Hannover 2 ℳ; Bernhard, Bahnhof Mansfeld 10 ℳ; Berger, Finsterwalde
4 ℳ; A. O., Nordhausen 5 ℳ; Apotheker R. Bradder, Allestein 10 ℳ; „Dicker Jörge“,
Leipzig-Eutritzsch 10 ℳ; Kegelklub Frohsinn-Eintracht, Burg 25 ℳ; L. Heyn, Johanngeorgenstadt
30 ℳ 05; Elsa, Alfred u. Heinrich, Lößnitz 10 ℳ; Oberlehrer Kohrherr, Greifenberg
5 ℳ; E. u. H. v. Lenthe, Lenthe 18 ℳ; Käthe u. Anne-Marie Lepper, Quedlinburg 20 ℳ;
F. Märker, Niedersedlitz 3 ℳ; A. Ferber, Halle 3 ℳ; A. Hoffmann, Schlotheim 3 ℳ;
Kraker, Zielau 20 ℳ; B. Sch., Strehlen 15 ℳ; S. W., Schwerte 5 ℳ; aus Karl u. Walthers
Sparbüchse. Zwelbrücken 4 ℳ 79; Frau H., Kreuznach 6 ℳ 05; J. H., Siegen 3 ℳ;
Familie M. Fritzler, Hüsten 4 ℳ 50; Hedwig Flataw, Hüsten 50 Pf; Gg. Noll, Wiesbaden
20 ℳ; Chr. Fernau, Weilburg 3 ℳ; Zittauer Liedertafel durch Zahlmeister Jahn 39 ℳ 90;
Wagler und Kaminski, Breslau 20 ℳ; Schönherr, Dresden 5 ℳ; Frau L. S.–U. 10 ℳ;
Kühn, Stralsund 10 ℳ; N. Herrosé u. Frau, Wittenberg 10 ℳ; Frau K. S., Halle 3 ℳ;
Ungenannt. Walschleben 10 ℳ; A. W., Berlin-Moabit 6 ℳ; Martha u. Amalie Reisdorff,
Prenzlau, 10 ℳ; Geschäftspersonal d. Firma Gebr. Jklé, Plauen, durch Anna Hoppe 30 ℳ;
Arbeiterinnen der Firma G. A. Jahn, Plauen, durch Emma Schneider 10 ℳ; Leser der
„Gartenlaube“ aus Stadtsteinach u. Hummendorf 6 ℳ; Ungenannt, Kirchberg i. S. 10 ℳ;
Krankenpflegerin, Krefeld 50 Pf; Fr. F. Krainer. Stockach 2 ℳ; B. B., alter Abonnent,
Elberfeld 3 ℳ; Erich B. u. Onkel Jean, Bockenheim 2 ℳ; Ungenannt, Wien 1 ℳ 25;
L. Schuchard. Niederaula 10 ℳ; Wwe. J. M. R., Altena 50 ℳ; F. B., Magdeburg 1 ℳ;
W. G., A. B. u. H. B., Weimar, 2 ℳ 50; Emilie Lannerstädter, Haßfurt 20 ℳ; M. L.
Gutmann Sohn, Siegenburg 20 ℳ; S. F., langj. Ab. d. „Gartenlaube“, Lage, 10 ℳ; E. S.,
München 10 ℳ; Baumann, Friedrichshof 10 ℳ; E. u. A. Limberg, Cörne 4 ℳ 50; J. K.,
Krefeld 3 ℳ 05; C. Gerhardt, Bonn 25 ℳ; J. Manderschied, Merzig 3 ℳ; Pfarrer Daniel,
Rebhof 3 ℳ; Frau E. M., Euskirchen 12 ℳ; Otto u. Alfred, Euskirchen 3 ℳ; Familie
H. Fleiß, Frl. Arendt, Meyerhof-Lankischken 12 ℳ 20; Leopold, Therese u. Clara Redlich,
Bistritz, Mähren 5 ℳ 11; A. G, Bärn (1 fl.) 1 ℳ 70; Geschwister S. u. Anna J., Döbeln
2 ℳ; P. Moos, Augsburg 1 ℳ; Treue Abonnentin Marie H., Mühlhausen 2 ℳ; Frau
Lorenz, Bahnhof Aue 1 M; a. d. Sparbüchse von Walter u. Else, Marten 3 ℳ; W. Voigt,
Dresden 2 ℳ 10; aus Hildesheim 2 ℳ; „Wenig mit Liebe“. J. N., Chemnitz 50 Pf;
Kappler, Militsch, Bez. Breslau 1 ℳ; Marx, Rohnau 2 ℳ; –k. -l., Ostseebad Zingst
2 ℳ; E. H., St. Johann 1 ℳ; treue Leserin der „Gartenlaube“, Greussen 2 ℳ; aus den
Sparbüchsen von Curt, Alma u. Käthe, Harsefeld 1 ℳ 50; aus den Sparbüchsen von Gertrud,
Anna u Alfred Kuttig, Görlitz 1 ℳ 40; Frau A. Wiesenhütter, Görlitz 2 ℳ; L. W., Neuwied
1 ℳ; Rosa Reichard, Wien (3 fl.) 5 ℳ 10; Th. Stark. Lommerstadt 3 ℳ; M. K.,
Plauen 3 ℳ; B. M., Marklissa 3 ℳ; Wwe. Ziegler, Neumarkt 3 ℳ; Frau A. H., Kattowitz
3 ℳ; C. Rudolph, Friedland i. Mecklbg. 5 ℳ; Dr. Freitag, Burgstädt 5 ℳ; aus Bitsch
5 ℳ; J. Langguth, Suhl 5 ℳ; O. Großpietsch, Patschkau 5 ℳ; Henze, Marburg 5 ℳ;
Martha B., Gertrud R., Frankenberg 10 ℳ; Billettpersonal des Opernhauses in Frankfurt
10 ℳ; O. B., München 10 ℳ; Paula Benken, Kusel 20 ℳ; Carry u. Clara Beer, Frankfurt
20 ℳ; N. N., Hagen 20 ℳ; Schulze Rumpelmayer, Cannes 20 ℳ; Amalie Segeler,
Ischerey 20 ℳ; Schule Birkigt bei Könitz durch Lehrer E. Heussing 7 ℳ 87; E. v. H.,
Oppeln 3 ℳ 05; „Wenig aber gern“. Lehmann, Gotha 3 ℳ 05; Familie Schwenke, Dresden
6 ℳ 10; Frau Therese Sprengel, Senftenberg 3 ℳ; Kantor W. Gattig, Senftenberg 3 ℳ;
Steltzer, Zawisna 6 ℳ; M. u. N., Plauen 14 ℳ; H., L. 15 ℳ; L. E., Bremen 3 ℳ;
Louise P., Lennep 1 ℳ; E. Schmidt, Elberfeld 2 ℳ; A. u. P. Bach, Ems 2 ℳ; Elisabeth
Wittig, Bayreuth 1 ℳ; aus Harburg 1 ℳ; J. U., Laer 2 ℳ; L. Otto, Leipzig 50 Pf;
A. Rieckmann u. Frau, Carolinensiel 5 ℳ; deren Töchter Maria u. Meta, daselbst 5 ℳ;
langj. Leserin der „Gartenlaube“, Wien 20 ℳ; R. S., Budapest (1 fl.) 1 ℳ 70; Frau
Schuster, Detmold 2 ℳ; Frau Witwe Gundelach, Detmold 3 ℳ; Lehrer Twardy,
Gelland 2 ℳ; Martha Kiep, Gottwalde 1 ℳ 50; aus Marienwerder 50 Pf; S.
Wittkowski, Memel 3 ℳ; G. Starck, Düsseldorf 20 ℳ; Ad. R., Königsberg 4 ℳ; W.,
Stralsund 5 ℳ; Polizei-Kommissar A. Kollmann, Düsseldorf 10 ℳ; W. Fritz, Remischhof
10 ℳ; A. Wiesenthal. Köln 3 ℳ 05; junge Mutter, Lübeck 2 ℳ 05; F. Hempel, Georg-
Marienhütte 3 ℳ; A. Krampe, Georg-Marienhütte 3 ℳ; E. Krampe, Georg-Marienhütte
1 ℳ 25; C. u. M. Wolff, Unruhstadt 8 ℳ; X. K. 5, Insterburg, Ergebn. einer häuslichen
Sammlung 14 ℳ 12; A. v. F., Rotterdam 5 ℳ; Ernst P., Leipzig 1 ℳ; alter Abonnent,
Gußstahlfabrik Essen, 2 ℳ; E. F., langj. Abonnent der „Gartenlaube“, Görlitz 1 ℳ; aus Prag
(50 kr.) 80 Pf; Anonymus, Ruhpolding 2 ℳ; aus Ellwangen 2 ℳ; eine früh Verwaiste.
Mülhausen 3 ℳ; aus Nürnberg 1 ℳ; aus Nürnberg 2 ℳ; aus Weißenburg 1 ℳ; Frl.
M. Sch., Dresden 3 ℳ; Frau F. W. Sch., Hameln 3 ℳ; aus Dahlen 50 Pf; ein Familienvater J. K., Regensburg 1 ℳ 50; C. Stoll, Neuwied 2 ℳ; aus Berlin 1 ℳ; L. Maaß,
Waren 3 ℳ; aus den Sparbüchsen von H. K. M. u. A., Frankfurt 2 ℳ; von I. u. W.
M., Frankfurt 3 ℳ; R. H., Altchemnitz 5 ℳ; Reichsdeutscher in Troppau (3 fl.) 5 ℳ 10;
Clara u. Adam Wasmuth, Hückeswagen 3 ℳ; W., Roßlau 3 ℳ; G. A. S., Cönnern
3 ℳ; J. Hertel, Ueckermünde 3 ℳ; Lehrer Baumgartner, Hallbergmoos 3 ℳ; Wwe. M.,
St. Johann 5 ℳ; C. M., Lorzendorf 3 ℳ; W., München 5 ℳ; 2 „Gartenlaube“-Leserinnen,
Großbertelsbach 6 ℳ; C. H., Wesel 6 ℳ; F. K. Ellingen 10 ℳ; Frau Helene A., Hannover
10 ℳ; A. Triacca, Mayen 10 ℳ; M. H., O. 5 ℳ; L. P., O. 5 ℳ; Rektor Griese,
Berlin 10 ℳ; Lehrer J. Spengler, Frankfurt 10 ℳ; M. Friedländer, Oppeln 10 ℳ;
Kegelklub „Kette“, Frankenberg 20 ℳ; Frau E. Hartenstein u. Frau M. Hartenstein,
Kötzschenbroda 20 ℳ; Ch. Müller, Berlin 50 ℳ 05; Z. L., Krefeld 30 ℳ 05; von seinen
Schulkindern ges. durch Lehrer Thiem, Dornburg 9 ℳ 70; ges. von Helene Schochow u.
Rosa Grünbaum, Schwersenz 45 ℳ; Stammgäste der Eiblschen Gastwirthschaft, Falkenstein,
Ob.-Pf. 4 ℳ; A. W., Ermsleben 30 ℳ; Kl. Chor, Olvenstedt 2 ℳ 25; Familie M., P.
b. Rybnik 50 ℳ; Frau Sophie Hübsch, Heidelberg 4 ℳ; J. V., Dahlhausen 1 ℳ; S. W.
u. J. E., Traunstein 10 ℳ; vom kleinen Maximilian Glaser, Mannheim 20 ℳ; A. U.,
Chemnitz 5 ℳ; aus Freystadt (Westpr.) 1 ℳ 50; Marie u. Martha, Fraustadt 1 ℳ 50;
E. S., Osterspai 3 ℳ; E. Wedekind, Hannover 2 ℳ 80; W. Heitkamp, Wehdem 10 ℳ;
Witwe L. J., Marienwerder 3 ℳ; E. T., Schmölln 6 ℳ; E. S. E. S. S. S., Metz 4 ℳ;
vom †-Bruder A. S. Oschatz 1 ℳ 50; Unbekannt, Leipzig 1 ℳ 31; aus Kamenz 3 ℳ;
G. Teuton, Leipzig 3 ℳ; M. W.. Leipzig 1 ℳ 50; J. P., Teplitz (1 fl.) 1 ℳ 70; Frau
Inspektor Meinhold, Kolmar 1 ℳ; aus Kolmar 2 ℳ; A. M., Kreuzburg 1 ℳ; Frau
J. J., Neapel (10 Lire) 7 ℳ 60; Frl. H. Y., Freiburg 1 ℳ 50; aus Regensburg 1 ℳ 05;
Frau M. Orlopp, Teplitz (5 fl.) 8 ℳ 50; E. u. C. Maultsch, Hildburghausen 3 ℳ 40;
D. Netheim, Lemgo 3 ℳ; S. Meyer, Lemgo 1 ℳ; Flury, Coiffeur, Zürich 4 ℳ; Pastorin
Willrich, Dresden 3 ℳ; Fanny Is., Kassel 3 ℳ; Christoph, Oberpf., Lauban 3 ℳ; Osc.
Brendel. Kamburg 5 ℳ; E. L., Nürnberg 5 ℳ; E. R. u. M. L., Quedlinburg 20 ℳ;
O. Raschke, Liegnitz 20 ℳ; F. Sch., Glogau 20 ℳ; Thierarzt H. Prahle, Möhnern 7 ℳ;
Frau D. u. J., Tharandt 60 ℳ; dankbarer Abonnent, Potschappel 1 ℳ 05; aus Groß-Strehlitz
1 ℳ; F. B., Darmstadt 1 ℳ; aus Husum von einer armen Witwe, die soeben ein
heißgeliebtes Kind verlor, 1 ℳ; aus Malchin 1 ℳ 40; Else u. Emilie Olimart, St. Johann
1 ℳ 50; aus der Sparbüchse von 4 guten italienischen Kindern, eingesandt von Therese
Backhaus in Donnini (32 Frcs.) 25 ℳ 60; aus Nordhausen 3 ℳ 50; „Eine Mutter.“ Würzburg
40 ℳ; E. Tschugguel, Bozen (5 fl.) 8 ℳ 50; Weidlich, Göltschen 6 ℳ; alter Abonnent
u. Schwester, Schwerin 10 ℳ; Hertha u. Margarethe v. d. Osten, Straßburg 6 ℳ; S.
H. Jätschau, Glogau 3 ℳ; Frau Recha Cohn, Bialla, 10 ℳ; G. Bernhardt, Strelno 5 ℳ;
E. N., Riesa 10 ℳ 05; Alwine Gronert, Bolton Hall, Wilberfors, Port. O., (5 sh.) 4 ℳ 70;
Paul u. Else Rogozinski, Thorn 50 Pf; C. Fechtel, St. Petersburg 100 ℳ; L. Walther, Cilli
(5 fl.) 8 ℳ 50; Frau Bertha Arnois, Dessau 5 ℳ; aus Gotha 1 ℳ; aus Düsseldorf
50 Pf; T. R., Mainz 40 Pf; Gollkoffer, Weitnau 2 ℳ; E. Eschborn 1 ℳ; E. P., Dresden
1 ℳ; Frau D., Oschersleben 3 ℳ; Frau Wirthschafterin Bentz, Semlow 1 ℳ 20; O. Köber,
Mühlhoff 3 ℳ; Frau Ferber Heil, Frankfurt 3 ℳ; H. Geitner, Auerhammer 5 ℳ; Kniebes,
Saarburg 5 ℳ; Frau K. Greif, München 10 ℳ; Noa Schufftan, Briegischdorf 10 ℳ;
O. Gr., Geringswalde 10 ℳ; aus der Skatkasse der Herren H. L. R. H., Braunschweig
6 ℳ; Schule zu Krummhübel 7 ℳ 50; ges. von den Schulkindern, Nettelbeck 6 ℳ 30;
die Kinder der höheren Privatschule, St. Goar 12 ℳ; Schule, Lehrer u. Gemeinde H. 15 ℳ;
ges. am Familienabend, Stettin 15 ℳ; Senta Stocker, Alsmoos b. Aindling, O. B., 17 ℳ;
Beamte u. Zöglinge der Blindenanstalt Königswartha 14 ℳ; „Aus Sparbüchsen“ von Emil
Herold, Limbach 24 ℳ 50; M. Herosé, Konstanz 50 ℳ; R. P., Weischlitz 50 ℳ; Margarethe
u. Paul Pallme-König, Steinschönau 6 ℳ 01; G. Lichtenthäler, Herdorf 5 ℳ 20; aus
Freiberg i. S. 30 Pf; M. H., Neu-Ulm 2 ℳ; Ungenannt, Dinkelsbühl, (1 Coupon) 3 ℳ 50;
Witwe, Darmstadt 1 ℳ; E. H., Neustettin 2 ℳ; aus Königsberg 1 ℳ; L. u. H., Glogau 50 Pf;
Emmy aus K. 2 ℳ; aus den Sparbüchsen von Victorine Connerth u. Schwester, Bistritz i. Siebb.
(3 fl.) 5 ℳ 10; aus Meran 5 ℳ; Fr. Mayer, Eupen 5 ℳ; aus Barmen 10 ℳ; Käthe, Dresden
1 ℳ; M. Pfefferkorn, Frankenberg i. S. 3 ℳ; G., Pelplin 5 ℳ; Dr. E. Klein, Köln 10 ℳ;
Familie Wwe. W. Scheidt, Amsterdam 25 ℳ; Güterabfertigung (Staatsbahnhof), Lüdenscheid
15 ℳ 15; A. Sch., Darmstadt 2 ℳ; Werner, Allenstein 15 ℳ; aus Nürnberg 1 ℳ; F.
H. S., Lauban 1 ℳ; treuer Freund der „Gartenlaube“, Pirna 1 ℳ; auch eine Waise,
Greiffenberg 50 Pf; M. Großmann, Klein-Lauffenberg 14 ℳ; aus Allenstein 2 ℳ; Käthe
u. Ellen, Balgstedt 1 ℳ 25; aus Bonn 2 ℳ; P. R., Augsburg 1 ℳ; aus Halberstadt 1 ℳ;
R. P., Schmiedeberg 2 ℳ; aus Marburg i. H. 90 Pf; M. M., Ostpreußen 1 ℳ; aus
Ronsdorf 1 ℳ; von einer Dresdnerin 5 ℳ; aus Burgkundstadt von einer Leserin der „Gartenlaube“
3 ℳ; Hannover-Linden 50 Pf; Leserin der „Gartenlaube“, München 49 Pf; Hedwig
u. Lorchen, Reelitz 3 ℳ 10; Emma Scherf, Dienstmädchen, Riga 2 ℳ; Johannes P. aus Z.
2 ℳ; von Hans u. Gertrud, Nürnberg 71 Pf; A. E., Gotha 3 ℳ; „Wenig mit Liebe.“
von einer Witwe, Chemnitz 1 ℳ; aus Straßburg i. E. 3 ℳ; aus Oldersum 20 ℳ; N. N.,
Barmen 5 ℳ; aus Lieberose 5 ℳ; N. N., Löbau 5 ℳ; E. Düsselberg, Krefeld 5 ℳ 20;
Helene-Breslau 5 ℳ; Fdch. Mdf., Kassel 5 ℳ; H. Rohland, Dresden 5 ℳ; Ph. Schmidt,
Architekt, Wiesbaden 5 ℳ; S. S., Münster i. W. 5 ℳ; F. Bl., Wilkau 5 ℳ; Ott., Berlin 5 ℳ; israelit. Wohlthätigkeitsverein. Calcar 5 ℳ; N. N., Ragnit 5 ℳ; J. R., Neuwied 6 ℳ; Freiherr v. Ziegesar, Berlin 6 ℳ; L. Kühne, Apolda 6 ℳ; J. W., Berlin 10 ℳ; Apothek. Windsperger, Braunau 10 ℳ; Raddünz, Mönchgrund 10 ℳ; aus Zweibrücken 10 ℳ; O. Ludwig, Apolda 10 ℳ; B. K. D. 20 ℳ; Frau C. Speidel, Frankfurt 20 ℳ; Frau L. Os., Köln 20 ℳ; Jnhalt von Marthas u. Ernsts Sparbüchse, Siegen 30 ℳ; Stelzer,
Zawisna 9 ℳ; aus Schule u. Haus, Ostpreußen, 3 ℳ 60; Regi Adler, Frankenreuth 4 ℳ;
ges. unter Kollegen von C. v. Fransecky, Dresden 5 ℳ 15; ges. von den Schulkindern, Crumpe
b. Mücheln 4 ℳ 75; A. M., Memel 1 ℳ; Forstrentamtmann Brückner, Marienberg 5 ℳ 05; „Polterabendgesellschaft“, Cramme, Br. 7 ℳ 80; S. A., Wünnenberg 5 ℳ 50; ges. im
Lokalverein ehemaliger Jäger u. Schützen, Weimar 5 ℳ 60; „Kleeblatt vier“, Dortmund
19 ℳ; H. Hein, Görlitz 10 ℳ 05; Eppen, Pankow 14 ℳ; Fr. Michel, A. Vogel, Traunstein
12 ℳ; ges. v. d. Kindern d. evangel. Schule, Eckersdorf durch A. Rosmehl 12 ℳ 23;
P. Leipscher, Chemnitz 10 ℳ 05; Frau Ella Holtzwart, Liverpool 25 ℳ 05; ges. am Erntedankfest, Gemeinde Vogelsberg 33 ℳ 10; aus Wien 17 ℳ 02; „Frauenverein“, Pritzwalk
durch Helene Kludt 50 ℳ; Wwe. F. M., Barmen 3 ℳ; W. H., Adorf 3 ℳ; J. W.,
Gutsverwalter, Baumgarth 3 ℳ; Rendant E. Eichler, Plauen 3 ℳ; Ludloff, Kl. Röhr 3 ℳ;
Rektor Schneider, Stettin-Grünhof 3 ℳ; A. W., Oberhohendorf 3 ℳ; aus Ober-Oderwitz
3 ℳ; S. u. L., St. Petersburg 50 ℳ; Ostpreußen, Wittig 30 ℳ; aus des Töchterchens
Sparkasse, O., Heidelberg 1 ℳ; langjährige Abonnentin, Cleve 3 ℳ; „Gebet, so wird
euch gegeben“, London 10 ℳ; Inhalt der Sparbüchse des kleinen Knaben Donald Rieber-Pullmann, Godalming 20 ℳ; Frau E. W. mit Kindern, Ulm 5 ℳ; aus Pudewitz 1 ℳ 50;
aus Raguhn 50 Pf; Familie Müller, Leipheim (4 Coup.) 20 ℳ 80; J. Frost, Schmiegel
2 ℳ; Frau Toni S., Braunschweig 30 ℳ; Frau Emma v. Hüttner, San Remo 100 ℳ;
K. K., Gotha 1 ℳ; Frau E. M., Schwiebus 3 ℳ; M. W., Nürnberg 60 Pf; Zittauer
Dienstmädchen, auch als Waise aufgezogen 2 ℳ; M. x, Greiz 1 ℳ; Scherflein aus der Sparbüchse
von F. E., Neubrandenburg 2 ℳ; Witwe Emilie Klaus, Berlin 20 Pf; Frau A.
Metz, Frankfurt a. M. 2 ℳ; J. H. W. W., S. 5 ℳ; X. X., ’sGravenhagen 5 ℳ; Frau
Klinzmann, Halberstadt 1 ℳ; Frau Göttel, Halberstadt 1 ℳ; Frau Krebs, Halberstadt 50 Pf.;
Sammlung i. d. Stadt Meersburg durch Dr. O. Bender 129 ℳ; Sekretär Streitberger,
Arnsberg 5 ℳ; Frau Oberamtsrichter Sigel, Nagold 5 ℳ; Susanne Schmitt, Simmern
2 ℳ; M. K., Einbeck 2 ℳ; von Troeltsch, Breslau 5 ℳ; Frau Ed. Stürmer, D. Lissa
5 ℳ; Ch. Müller, Gladenbach 5 ℳ; H. Küchlin, Klösterlein 5 ℳ; aus Wiesenburg 4 ℳ;
R. Raetzer, Suhl 1 ℳ; Fr. Leistner, Suhl 1 ℳ; L. Böhm, Suhl 1 ℳ; Emilie Müller,
N.-Neuendorf bei Zossen 6 ℳ; v. W., Gr. Salze 10 ℳ; Metzke. Buchbinderm., Breslau
1 ℳ; 14 Mitglieder der Gemeinde Görschen 24 ℳ 75; Rudolf Möckel, Annaberg 10 ℳ 05;
Dr. J. Z., O. 10 ℳ; Die „Gartenlaube“ 500 ℳ. (Fortsetzung folgt.)
Räthselaufgabe.
Kennst du das Paar, mit dem wir gehen
Durch Dick und Dünn mit festem Schritt,
Den sichern Grund, auf dem wir stehen,
Wenn’s auch der Mensch mit Füßen tritt?
Es fühlt von uns sich angezogen;
Doch schmiegt’s an dich sich allzusehr,
So hat der Meister dich betrogen
Und die Verbindung drückt dich schwer.
Verkleinert findet sich’s bei Damen
Und kleiner noch bei manchem Kind,
Es leihet gerne seinen Namen
Auch andern, die ihm ähnlich sind.
Als Einzahl klingt’s in andrer Weise,
Wenn still der Tag zu Ende geht
Und abends es im Freundeskreise
In ganzer Größe vor dir steht.
Von Thatendurst ist’s dann ein Zeichen,
Und ist der Trank nur kühl und klar,
So wird es nicht mit einem reichen
Und unversehens ist’s ein Paar. O. B.
Scherzräthsel.
Ich habe zwei Flügel, die kann ich bewegen,
Doch reg’ ich sie niemals des Fliegens wegen.
Ich habe ein Bein, damit kann ich nicht laufen,
Und laufe ich dennoch, so muß ich viel schnaufen,
Den Rücken pfleg’ ich nach vorn zu tragen,
Das Bein laß ich über den Rücken ragen.
Die Trunksucht des Nachbars läßt roth mich werden;
Das Nacktsein ertrage ich ohne Beschwerden.
Ich hab’ eine Wand ohne Fenster und Thür,
Und mehrmals am Tage putzt man an mir.
Oft gehst du mir nach, lieber Leser, das weiß ich;
Nun denke du nach und dann sage: wie heiß’ ich?
E. S.
Buchstabenräthsel.
Erfüllt mein Wort dir Herz und Seele,
Wird trübe sich dein Blick umzieh’n
Und jener holde Gast: „die Freude“,
Sogleich von deiner Schwelle flieh’n.
Ein jeder Mensch hat’s kopflos doppelt;
Ist er’s, so schafft’s ihm Noth und Pein,
Zwar möchte er es niemals missen,
Doch nimmer auch es jemals sein.
Silbenräthsel.
Die Eins bleibt Eins nur wenige Stunden,
Wird Eins und Zwei für Eins gewunden.
Räthsel.
Reich bin ich an Produkten mancherlei;
Ein mildes Klima meine Früchte reift,
Doch seit des Türken Hand nach ihnen greift,
Ist leider meine Blüthezeit vorbei. –
Vier Zeichen mußt du von mir trennen,
Wovon das eine vorn und drei am Ende stehn,
Dann wirst du einen Frauennamen vor dir sehn,
Den wir schon aus der Bibel kennen.
Kombinationsaufgabe.
Mein Freund Müller huldigt dem jetzt in Mode gekommenen Sport, sich alle Theaterbesuche in kleinen Merkbüchlein zu verzeichnen. Er besitzt drei solcher Bändchen, eines ist für Opern, eines für Dramen und eines für Lustspiele, Possen und Operetten bestimmt. Kürzlich zeigte er mir das erstgenannte Buch. Ich nahm es zur Hand, schlug eine Seite auf und las:
| Freitag, d. 8. Jan. 1892 | Lohengrin. |
| Montag, d. 15. Febr. „ | Fra Diavolo. |
| Sonntag, d. 6. März „ | Oberon. |
| Mittwoch, d. 6. April „ | Don Juan. |
| Sonnabend, d. 14. Mai „ | Iphigenie in Aulis. |
| Dienstag, d. 7. Juni „ | Idomeneo. |
| Donnerstag, d. 21. Juli „ | Euryanthe. |
„Meine Lieblingsoper befindet sich nicht darunter,“ sagte ich und gab meinem Freunde das Buch zurück. – „Wie heißt dieselbe?“ warf dieser fragend hin. – Du kannst dies leicht erfahren,“ entgegnete ich, „wenn Du etwas Kombinationsgabe besitzest und Dir diese Seite ein wenig genau ansiehst!“
Er that nach meinen Worten und nannte mir bald den Titel meiner Lieblingsoper.
Kann mir der geneigte Leser denselben vielleicht auch angeben?
Die Ziffern sind durch bestimmte Buchstaben zu ersetzen, so daß die wagerechten Reihen bezeichnen: 1. eine Stadt am Rhein, 2. einen Theil der Provinz Sachsen, 3. einen sich nach oben verjüngenden Pfeiler, 4. eine Stadt in Thüringen, 5. einen italienischen Komponisten, 6. eine Stadt im russischen Polen, 7. den gleichen Namen zweier deutschen Maler. Nach richtiger Lösung bilden die zwölf Buchstaben, welche für die durch besondern Druck hervorgehobenen Ziffern gesetzt wurden, den Titel eines Gedichts aus Körners „Leier und Schwert“. A. St.
Von nachstehenden 16 Eigenschaftswörtern suche man die Gegensätze auf. Alsdann werden die Anfangsbuchstaben der letzteren, in der Reihenfolge der Ziffern gelesen, den Namen eines berühmten Lustspiels ergeben.
1. weiblich, 2. himmlisch, 3. trocken, 4. unnütz, 5. genügsam, 6. gleichartig, 7. gründlich, 8. hoch, 9. verhaßt, 10. reich, 11. schweigsam, 12. fern, 13. gefährlich, 14. falsch, 15. verheirathet, 16. schriftlich. Oscar Leede
.
Das Herz und nicht die Meinung ehrt den Mann. Schiller, Wallensteins Tod. IV. 8.
1. Es'che, 2. Staar, 3. Niger, 4. Euler, 5. Erich, 6. Ahorn, 7. Basel, 8. Eutin, 9. Horeb, 10. Adolf. Cagliostro (eigentlich Gius. Balsamo).
<poem >
Christabend ist’s, die Sterne flimmern,
Und helle Weihnachtskerzen schimmern
In stille Gassen weit hinaus;
Mit tiefem Ton die Glocken läuten,
Und auf beschneiten Pfaden schreiten
Andächt’ge nach dem Gotteshaus
A. Ohorn.
Aus dem Nachlaß von
Berthold Auerbach.
Elegant gebunden 6 Mark.
Berthold Auerbach hat lange Jahre hindurch über die Eindrücke, welche die von ihm besuchten Theatervorstellungen bei ihm hinterließen, Aufzeichnungen gemacht, welde sich in seinem Nachlaß vorgefunden haben: sie eröffnen überraschende Einblicke in die Werkstätte der behandelten Autoren, wie auch Auerbachs selbst.
Schauspiel in drei Aufzügen von
Ludwig Fulda.
Elegant gebunden 3 Mark.
Im Mittelpunkt dieses Schauspiels steht ein junges, verwöhntes und mit Genüssen übersättigtes Mädchen, welches durch den Einblick in die Not des Lebens und die sozialen Kämpfe unserer Zeit wachgerufen und geläutert wird. Das Stück ist bereits über 300 Bühnen des In- und Auslandes mit stets wachsendem Erfolg gegangen.
Fünf Novellen von
Wolfgang Kirchbach.
Elegant gebunden 5 Mark.
Der Reiz dieser Novellen liegt in ihrer zierlichen Behandlungsweise: das Leben erscheint in der sonnigsten, goldglänzendsten Beleuchtung. Wer noch Sinn für Grazie in der Kunst hat und das Lebenswahre auch in lichter Farbenmischung erkennt, wird das Kirchbach’sche Buch in der angenehmsten Stimmung aus der Hand legen.
Von
J. V. Widmann.
Elegant gebunden 5 Mark.
Eine heitere Auffassung der Welt äußert sich auch in diesen Novellen. Touristen-Abenteuer, in denen wir es mit amerikanischen Ladies, deutschen Gelehrten, italienischen Eselstreibern und englischen Hochtouristen zu thun haben, sind mit herzlicher Lust am Gegenstand erzählt und vom Verfasser wohl zum größten Theile selbst erlebt.
Zu Festgeschenken besonders geeignet; durch die meisten Buchhandlungen zu beziehen.
Herausgegeben unter verantwortlicher Redaktion von Adolf Kröner. Verlag von Ernst Keil’s Nachfolger in Leipzig. Druck von A. Wiede in Leipzig.
Anmerkungen (Wikisource)
- ↑ Vorlage: Couffinbal-Biétrix