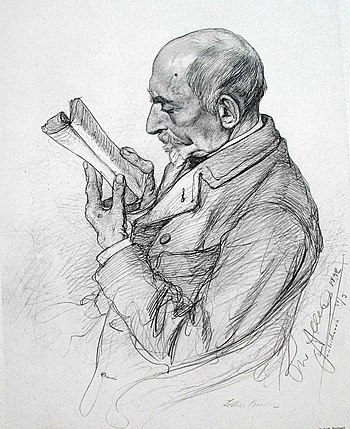Die Gartenlaube (1892)/Heft 25
[773]
| Halbheft 25. | 1892. | |
Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Jahrgang 1892. Erscheint in Halbheften à 25 Pf. alle 12–14 Tage, in Heften à 50 Pf. alle 3–4 Wochen vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Noch sechs Tage bis zur Hochzeit Theresens und des Doktors,
Julias letzter Tag in der Heimath!
Es wehte schon ein festlicher Hauch durch das alte Haus. Das Lärmen und Treiben der Handwerker war verstummt, die Mägde aus der Krautnerschen Villa, sowie das neue Personal des künftigen Paares hatten die letzten Spuren der arbeitenden Männer getilgt, und glänzend wie ein Schmuckkästchen erwartete der obere Stock die junge Herrin.
Die Pracht begann eigentlich schon unten im Hausflur. Die alten ehrlichen Fliesen aus rothem Backstein, die den Bewohnern seit langen Zeiten den Witterungsumschlag zu verkünden wußten – sie wurden immer einige Tage vor eintretendem Regenwetter feucht – waren verschwunden, und ein blendendes Mosaik aus weißen und schwarzen Marmorplatten war an ihre Stelle gesetzt, so spiegelblank und glatt, daß die Räthin darauf einherschwankte wie ein Schlittschuhläufer, der zum ersten Male das Eis betritt. Darüber hinweg liefen bis zur Treppe zierliche strohgeflochtene Matten, und allenthalben waren an den stilvoll bemalten Wänden altdeutsch geschnitzte Bänke angebracht; das Fenster über dem Absatz der Treppe ließ nicht mehr einfach das Tageslicht hindurch – dieses sprühte farbig durch die mit Wappenmalereien bedeckten kleinen Scheiben, und die Sonnenstrahlen spielten in glühend bunten Lichtern auf dem weichen Treppenläufer, der die alten dunklen Stufen bedeckte.
Die Räthin war ganz stumm vor Bewunderung, es sah auch alles gar zu vornehm aus. Sie hatte nur einen Kummer – der eigensinnige Sohn wollte durchaus nichts davon wissen, daß sein Warte- und sein Studierzimmer dieser Pracht entsprechend eingerichtet würden. Er behauptete, sich wohl zu fühlen zwischen den trauten alten Möbeln, und für seine Person wünsche er keinen Dreier für stilvolle Einrichtung auszugeben; er hoffe und glaube auch, seine Patienten würden derartiges nicht vermissen.
Seine Mutter fügte sich seufzend; an Thereschen eine Bundesgenossin zu finden, mißlang ihr wider Erwarten. Für die Doktorstuben hatte diese entschieden kein Interesse. „Ach, das mag er doch halten, wie er will,“ sagte sie zu der Frau Schwiegermama, „wenn’s ihm gut genug ist, so kann’s mir ja recht sein.“
Ein ganz wonniger Maitag lachte heute über der Erde – ein Blüthenmeer in der
[774] Natur. Therese gab am Nachmittag ihren letzten Mädchenkaffee. Julia hatte abgesagt, sie war mit Einpacken beschäftigt; in diesem Augenblick saß sie noch droben in ihrem kleinen Dachstübchen und malte. Die letzten Pinselstriche galt es an einem großen Majolikateller, den sie als Hochzeitsgeschenk darbringen wollte.
Um sie her verrieth schon nichts mehr, daß sie hier die wenigen lichten Stunden ihres Lebens verbracht hatte; jedes kleine Zeichen hatte sie zu verwischen gestrebt. Wenn sie jetzt noch Farben und Palette zu dem übrigen Malgeräthe in die Kiste packte, so blieb keine Spur von ihr – hätte sie nur ebenso die Spuren verwischen können, die sich ihr hier eingeprägt hatten an einem ebenso sonnigen Maitag – im vorigen Jahre.
Nun legte sie den Pinsel fort und betrachtete ihre Arbeit. Auf die gelblich feingetönte Platte des Tellers war ein knorriger Zweig gemalt mit absterbenden Blättern, er lag da, als könnte man ihn fortnehmen, als sei er Wirklichkeit; darunter war – skizzenhaft nur – Wasser angedeutet, weite unbegrenzte Fluth, hinter der die Sonne versinkt und über der ein Schwarm Wandervögel dahinzieht, dem Winter entfliehend. Das war alles, und doch lag in diesem Wenigen die Sehnsucht eines Herzens, das Sonne und Liebe sucht wie die gefiederte Schar das wärmere Land.
Es war ihr so unbewußt gelungen, sie hatte an weiter nichts gedacht als nur daran, ihm nichts zu malen, das ihren Kummer, ihre Liebe verrathen könnte, und nun sprach das kleine Werk doch deutlich genug.
Sie erhob sich und verließ, ihr Werk behutsam tragend, das Stübchen; sie wußte eine Stelle dafür in dem Eßzimmer des jungen Paares und wollte es dort als letzten stummen Gruß an der Wand befestigen. Die eleganten Räume würden jetzt ganz verlassen sein, sie glaubte dessen sicher sein zu dürfen, denn es war die Zeit des Mittagsschlafes. Den Schlüssel zur Flurthür hatte sie heimlich aus dem Schlüsselkorb der Tante Minna genommen, die augenblicklich noch die Hüterin dieser Herrlichkeit war, und so trat sie ein in die Gemächer, die in Kürze ein junges goldenes Menschenglück bergen sollten.
Sie hielt sich nicht dabei auf, die Pracht der Wohnung näher anzuschauen, sondern ging sofort in das Eßzimmer, um ihrer Gabe dort einen Platz anzuweisen. Es war dasselbe Gemach, in dem einst der kleine Frieder Adami gewohnt hatte; es war wie geschaffen zu einem traulichen Speiseraum mit seiner Balkendecke, seinen holzgetäfelten Wänden und den tiefen Fensternischen, jetzt freilich so wenig wiederzuerkennen wie der alte Hausflur drunten. Das Getäfel war reich verziert worden, den ungetäfelten Theil der Wände bedeckte eine kostbare Ledertapete, und der riesige baufällige Kachelofen hatte einem Kamin nach altem Muster weichen müssen, vor dessen spielender Flamme es im Winter ein anheimelndes Sitzen sein mochte. In der Mitte des Raumes, wo einst der Arbeitstisch des Knaben gestanden hatte, prangte der massige schwere Eichenholztisch, von hochlehnigen Stühlen mit Lederbezug umringt. Und auf dem Gesims der Täfelung, auf der Platte des Kamins vor dem Riesenspiegel, der bis an die Decke reichte, stand allerhand üppiges und kostbares Prunkgeräth umher. Jedenfalls sah dieser Raum so vornehm aus, daß ein einfaches Mittagsgericht sich schämen mochte, hier aufgetragen und verspeist zu werden.
Julia zog einen Nagel mit Bronzeköpfchen und einen Hammer aus der Tasche ihres Schürzchens und befestigte das Geschenk über dem Serviertisch, dessen Majolikaplatten gut zu dem Teller paßten; nun noch ein bronziertes Palmblatt dahinter und die einfache Ausschmückung war beendet. Sie trat bis zum nächsten Fenster zurück, um sich von hier aus die Wirkung anzusehen; indeß ihre Blicke hafteten wohl auf dem Teller, aber sie hatten plötzlich etwas Leeres, Starres bekommen. Wie ermüdet ließ sie sich auf einem der truhenartigen Sitze in der tiefen Fensternische nieder. Es war so unheimlich still hier oben, selbst der Pendel der kostbaren Standuhr schwang sich spukhaft leise. Und da war es dem Mädchen plötzlich, als gingen die Gespenster der Zukunft um.
Wird das Glück hier wohnen – wird es – wird es? tickte die Uhr. Und Mamsell Unnütz schüttelte den Kopf und preßte die Hände zusammen – sie konnte es nicht glauhen. Und dann erblickte sie dicht neben sich in einer der kleinen Fensterscheiben, die der Dekorateur hier großmüthig belassen hatte, weil sie zu dem Charakter des Zimmers paßten, ein Herz, kunstlos eingeritzt, und darunter die Buchstaben F. A. – T. K.
Das mußte der Frieder gethan haben! Und in der Seele des Mädchens stieg eine grenzenlose Bitterkeit empor, ein Zorn, eine Verachtung ohnegleichen – nur einmal der Treulosen einen Spiegel vorhalten dürfen, der ihr das heuchlerische Gesicht deutlich zeigt!
Die schlanken Finger des Mädchens wischten mechanisch über das kleine Herz, als könnten sie es auslöschen auf dem Glase – umsonst, es war zu tief eingegraben.
„Du lieber Himmel!“ sprach plotzlich neben ihr eine helle klare Stimme, „da muß man ja auf den Tod erschrecken – wie kommst denn Du hierher?“
Julia erhob sich rasch.
„Entschuldige,“ sagte sie mühsam, „ich hatte eine Kleinigkeit hier zu thun.“
„Was hast Du denn da an die Scheibe gemalt?“ fragte Therese und beugte ihr blondes Köpfchen herunter; aber jäh fuhr sie zurück, und ihre Augen sahen zornig aus dem erblaßten Gesicht zu Julia auf.
Seitdem Therese wußte, daß das Geheimniß ihrer Verlobung mit dem Frieder von Julia behütet worden war, seitdem sie wußte, daß das Mädchen das Haus verlassen würde, war sie sorgloser geworden. Julia hatte die „Thorheit“ wohl selbst als Bagatelle betrachtet; von Frieders Anwesenheit damals und den damit verbundenen Vorgängen konnte sie ja nichts ahnen – was wollten jetzt auf einmal diese drohenden vorwurfsvollen Augen?
„Es war Frieders Zimmer,“ sagte Julia heiser.
Therese antwortete nicht.
„Und das Herz dort wird er eingeschnitten haben, als Ihr Euch verlobtet; nächstdem wird’s ein Jahr.“
„Was willst Du heute damit?“ fragte Therese trotzig. „Du hättest wohl Lust, die Sache als Polterabendscherz zu verwenden? Angesehen habe ich es Dir längst, daß Du etwas gegen mich im Schilde führst.“
„Ich – ich bin an Deinem Polterabend nicht mehr hier, das weißt Du, und als Scherz habe ich die traurige Geschichte nie aufgefaßt,“ antwortete Mamsell Unnütz ruhig. „Ich wünsche Dir im Gegentheil soviel Glück, als es nur giebt auf der Welt, denn Dein Glück ist fortan das Glück eines seltenen Mannes und Deine Ruhe die seine. Und wenn ich es erleben dürfte, daß Ihr wirklich glücklich würdet miteinander, ich glaube, dann – dann könnte ich Dir manches vergeben.“
In das Gesicht des schönen Mädchens kehrte die Farbe zurück. Nein, diese Mamsell Unnütz würde die dumme Verlobungsgeschichte nie erzählen, aus Rücksicht für ihn. Dieses bettelstolze Ding war ja, wie die Räthin verrathen hatte, bis über die Ohren vernarrt in den Doktor! Und Therese lächelte wie der Maitag draußen.
„Laß sein Glück doch, bitte, meine Sorge sein, wenn ich auch das, was man Glück nennt, etwas anders auffasse als Du. Glaube mir nur, er wird nicht schlecht dabei wegkommen, wir werden uns vertragen, auch ohne Deinen Segen! Wann reist Du denn eigentlich?"
„Morgen!“ klang es kurz zurück.
„Nun, dann werden wir uns vielleicht nicht mehr sehen. Leb’ wohl! Ich wünsche Dir ebenso aufrichtig Glück für Dein künftiges Leben wie Du mir.“
„Leb’ wohl, Therese; ich hoffe, daß wir uns in späteren Lebensjahren als Freundinnen wiedersehen.“
„Nun,“ sagte diese etwas ironisch, „ich wüßte wahrlich nicht, was mich zu Deiner Feindin machen könnte.“
Julia schwieg. „Ich glaube, ich könnte furchtbar hassen,“ sagte sie dann leise, und ihre Augen irrten wieder zu der Fensterscheibe hinüber.
Da fühlte sie sich mit einem Ruck zur Seite geschoben, und im nächsten Augenblick klirrten drunten auf dem Pflaster des Hofes die Scherben der zertrümmerten Scheibe. „So?“ fragte Theresens bebende Stimme, „bist Du nun beruhigt?“
Julia zuckte die Schultern ein wenig. „Was liegt an dem unschuldigen Glase? Ja, wenn man das andere auch so leicht aus [775] der Welt schaffen könnte!“ Und sie wandte sich um und schritt zur Thür hinaus.
„Wäre sie nur erst fort!“ murmelte Therese finster, mit zornigen Augen der Scheidenden nachblickend. Und dann zog ein schelmisches Lächeln über ihr schönes Antlitz – der Doktor stand auf der Schwelle.
„Scherben? Schon heute?“ rief er fröhlich.
Sie lachte. „Ich zerstieß ungeschickterweise eine Scheibe. Aber bringt das nicht Glück?“
„Hast Du Dich verletzt?“ fragte er zärtlich und zog sie an sich.
Sie lächelte zu ihm empor. „Nein, nein! – Ist’s nicht traut hier, ist’s nicht ganz einzig nett?“
Er nickte, aber sah sich nicht um, er blickte nur in die geliebten Züge. „Ich kann es noch immer kaum glauben, daß Du mein werden willst,“ flüsterte er. „Aber komm’ – hier oben ist das Paradies, das mir noch verboten ist; komm’, daß wir die Götter nicht erzürnen.“
Die Mainacht sank hernieder. Zum letzten Male schaute Mamsell Unnütz in den blühenden Garten hinaus, in dem sie ihre bescheidenen Kinderspiele gespielt hatte; morgen schon würde sie in Amt und Pflicht sein, vielleicht an einem Sterbebett stehen müssen. Sie fürchtete sich nicht vor der Zukunft; nur Arbeit, viel Arbeit wollte sie, nur kein Müßiggehen, das die Erinnerung weckt und Seelenwunden nicht heilen läßt.
Am liebsten wäre sie gar nicht schlafen gegangen, sondern hätte in der frühesten Morgenfrühe das erste Schiff benutzt und wäre ohne Abschied davongefahren. Wie ihr graute vor diesem Abschied, der gleichbedeutend war mit dem Verlust von Jugend und Glück!
Ganz leise schloß sie das Fenster, damit die Tante nebenan nicht gestört werde, dieses wunderliche alte Fräulein, das nie einen guten Blick, nie eine Zärtlichkeit für sie gehabt und der sie dennoch zu Dank verpflichtet war, denn sie hatte das schutzlose Kind unter ihrem Dache behalten, hatte es genährt, gekleidet und zur Schule gesandt.
Rief sie nicht eben? Mamsell Unnütz horchte erschreckt auf. Nein, das war kein Ruf, das war ein dumpfes Stöhnen. Im nächsten Augenblick schon stand das junge Mädchen am Lager der Tante, und das raschentzündete Licht zeigte ihr das schmerzverzerrte Gesicht der Bewußtlosen.
Sie flog durch den Flur, durcheilte Wartezimmer und Wohnstube und schlug mit der kleinen Faust gegen die Thür des Doktors. „Fritz, Fritz, die Tante stirbt!“
Dann weckte sie die Räthin und war in der nächsten Minute wieder bei der Leidenden und stützte die qualvoll stöhnende, mühsam lallende Kranke mit ihren jungen kräftigen Armen.
„Ein schwerer Schlaganfall, Unnütz,“ sagte der Arzt traurig, nachdem er die Aermste gesehen und ihr Hilfe gewährt, soviel er vermochte. Sie standen miteinander in dem dunklen Wohnzimmer vor der Krankenstube, und die Kühle der Mainacht drang zu ihnen herein. Die Räthin war am Bette der Schwester geblieben.
„Du kannst Dich möglicherweise auf eine lange schwere Zeit der Krankenpflege gefaßt machen, arme kleine Unnütz,“ fuhr der Doktor fort.
Sie zuckte empor; sie wollte rufen. „Es ist unmöglich, ich darf nicht hier bleiben!“ aber rasch senkte sie wieder das Haupt, ja freilich – sie war die Nächste dazu – sie – wer sonst sollte die einsame verbitterte Frau dort pflegen? Und dennoch – – „Seid barmherzig! Ach, seid barmherzig!“ murmelte sie.
Er verstand es nicht. „Vielleicht ist sie – bist Du bald erlöst, vielleicht macht ein zweiter Schlaganfall ihrem armen Leben ein Ende, vielleicht aber auch bleibt sie dem Dasein erhalten, eine hilflose gelähmte Frau, die Deiner nicht entrathen kann.“
„Ich weiß! Ich weiß!“ stieß sie hervor, „bitte, rede nicht weiter, ich bleibe ja.“
Er drückte ihr die Hand und ging wieder zu der Kranken. Die Räthin kam an seiner statt heraus, weinend und lamentierend. „Und das hat gerade noch gefehlt – sie stirbt womöglich am Polterabend, und wenn sie leben bleibt, dann ist sie doch immer so krank, daß Fritz anstandshalber seine Hochzeitsreise aufgeben muß! Nein, das kann doch auch nur uns passieren! Du telegraphiere nur gleich ab nach Köln, hast hier genug zu thun, ich kann mit meinen müden Gliedern keine Kranke mehr heben und versorgen. Ach Gott, und so etwas muß gerade jetzt kommen!“
Julia beachtete das Jammern der erregten Frau nicht, sie ging an ihre Pflicht, und als der Morgen dämmerte, da glaubte sie in den starren Augen der Tante ein erwachendes Verständniß zu bemerken, und sie beantwortete deren ängstliches undeutliches Lallen mit den lauten Worten, die von einem leisen Streicheln der Wangen begleitet waren. „Sei ruhig, Tantchen, ich bleibe bei Dir – kennst Du mich? Julia! – Sei ganz ruhig!“
Und da flog es wie ein Schimmer der Erlösung über die verzerrten Züge.
Am nächsten Tage trat keine Aenderung im Befinden der Kranken ein, am Polterabend aber war sie bereits imstande, die gelähmten Arme ein wenig zu bewegen.
Therese wollte sich diesen Tag nicht verkümmern lassen, und wenngleich der Fritz von Musik und Ball zuerst nichts wissen mochte, schmeichelte sie ihm doch die Zustimmung durch ihre süßen Bitten ab. „Gelt, Fritz, noch einmal tanzen wir zusammen als lustige junge Springinsfeld, nachher ist’s ja doch mit Spiel und Tanz vorbei, sagt der Vater. Und von morgen ab gehorche ich Dir, aber heute, Fritz, heute – –“
Er kam noch einmal in die Wohnung der alten Tante, ehe er in das Haus der Braut zur Vorfeier seines Hochzeitstages ging. Draußen versank die Sonne hinter einer Wolkenschicht, und in dem blassen Dämmerlicht saß Julia still am Fenster in dem altmodischen Lehnstuhl. Sie hatte den Kopf mit geschlossenen Augen gegen die Polster gelegt und gewahrte den Mann erst, als er dicht vor ihr stand. Ihre erschreckten Blicke flogen über seine festliche Kleidung – er war im Frack und hielt den Cylinder in der Hand – und ihre Lippen preßten sich herb aufeinander.
„Ich wollte Dich nur bitten, Julia,“ sagte er, „die Fenster im Krankenzimmer zu schließen, damit die Musik Tante nicht aufregt. Ich hätte eine stille Feier lieber gehabt, aber ich mochte Therese ihren letzten Mädchentag nicht verderben; sie hat ohnehin schon die Hochzeitsreise bereitwillig aufgegeben.“
„Und warum willst Du nicht reisen?“ fragte sie. „Es geht ja sehr gut. Ich bin hier, und der Onkel Doktor wäre gekommen, wenn sich etwas verschlimmert hätte.“
Er sah sie forschend an; sie hatte den alten wehen Zug um den Mund.
Da erglühte sie wie Purpur. „Ach, entschuldige,“ stammelte sie, „es thut mir ja bloß leid, daß Ihr um der Tante willen Eure Reise aufgeben wollt. Im übrigen – was geht es mich an!“
Sie wendete sich ab, beschämt und zornig über sich selbst – er mußte es ja errathen haben, wie schwer es ihr wurde, sein junges Glück hier im Hause zu wissen. „Geh’ ruhig,“ fügte sie dann hinzu, „ich besorge hier alles ganz pünktlich.“ Und als er fort war, da schloß sie die Fenster der Krankenstube, aber die des Vorzimmers sperrte sie weit auf, und dort verharrte sie in seltsamer Qual die Nacht hindurch und horchte auf die Tanzweisen, die so deutlich herüberklangen, auf das Lachen und Hochrufen und so saß sie noch, als in dämmernder Morgenfrühe Mutter und Sohn heimkehrten.
„Abhärten“ nannte sie das mit bitterem Lächeln.
Sie ging auch am anderen Tage nicht aus dem Krankenzimmer, als das eben getraute Paar pietätvoll an das Bett der wieder zum Bewußtsein Zurückgekehrten trat. Sie stand am Fußende des Lagers und schaute mit weit geöffneten Augen auf die in weißen Atlas und Spitzen gehüllte Braut, die in ihrer leichten Blässe und dem Goldhaar, das unter dem weißen Dufte des Schleiers hervorschimmerte, liebreizender aussah als je. Und die schöne Frau beugte sich über die Kranke und küßte die kraftlose Hand. Dann schickten sich die Neuvermählten zum Gehen an. Der Doktor blickte nicht empor. Er schien das bleiche, stolz aufgerichtete Mädchen zu Füßen des Bettes gar nicht bemerkt zu haben. Stumm legte er die Hand Theresens in seinen Arm, und auch diese blickte nicht seitwärts.
[776] Da trat Mamsell Unnütz ihnen in den Weg. „Nehmt auch meinen Segenswunsch,“ sagte sie bittend, und ihre Hand streckte sich nach der seinen aus und dann nach der seiner jungen Frau. Zögernd berührte Therese die dargebotene Rechte, dann rieselte die spitzenbesetzte lange Schleppe über die Schwelle der Krankenstube. Und still, unheimlich still ward es in dem Hause, denn die Feier der Hochzeit fand in der „Goldenen Traube“ statt, und selbst die Dienstleute waren dort, um zu helfen oder zuzuschauen.
Julia saß am Bette der Tante. Langsam, langsam ward es später Abend; der Vollmond stieg auf hinter den hohen Bäumen. Die Kranke schlief, und noch immer war niemand daheim.
Julia erhob sich; sie schritt durch den Flur und sah nach, ob die vordere Hausthür verschlossen sei. Man wollte durch den Garten heimkehren, die Thür dorthin war weit geöffnet; ein Streifen Mondlicht fiel auf die Marmorfliesen und beleuchtete deutlich die Blumen, die man heute früh auf die Schwelle gestreut hatte. Sie trat unter die Thür und athmete die duftende Luft ein – die war schwül wie vor heranziehendem Gewitter; jenseit des Rheins zuckten rasch hintereinander grelle Blitze auf, die Nachtigallen aber schlugen überlaut in den Gärten.
Dann klang drüben die kleine eiserne Pforte, und Julia sah etwas Lichtes, Weißes kommen, zart wie ein wehender Elfenschleier – das junge Paar kehrte heim.
Zitternd floh sie über den Flur in das Krankenzimmer und setzte sich wieder ans Bett der Schlummernden. Wie ihr die Stunden verrannen, wußte sie nicht – schauernd vor Kälte, den schmerzenden Kopf auf dem Bett zu Füßen der alten Frau, so fand sie sich am anderen Morgen.
Welch eine bleierne Schwere in allen Gliedern und welch ein bedrückendes Angstgefühl in der Brust – was war denn geschehen?
Sie richtete sich empor und griff an die hämmernde Schläfe, da fiel ihr Blick auf einen kleinen Myrthenzweig, der vor dem Bette der Kranken lag; er mochte sich von dem Brautschmuck gelöst haben, als Therese dort kniete.
Ach ja, sie waren Mann und Weib!
Zwei Jahre sind vergangen.
Fräulein Riekchen Trautmann hatte sich als eine kräftige Natur erwiesen; sie sprach wieder, war bei völliger Verstandesklarheit, aber freilich, gelähmt war sie geblieben. Julia mußte sie ankleiden und besorgen wie ein kleines Kind.
„Sie thut alles so gewissenhaft,“ sagte das alte Fräulein zu ihrem Neffen, „aber so starr und still wie ein Sklave – kein Zug von Freundlichkeit, keine Spur von dem, was doch das wahre Labsal für so einen armen Lazarus ist wie ich. Von Liebe – –"
Es war an einem heißen Tage zu Anfang August, als sie so klagte.
Der junge Arzt, eben von seinen Besuchen heimgekehrt, sah sie groß an, als müsse er seine Gedanken erst von weit herholen. „Du willst Liebe ernten, Tante, und hast doch in diesem Herzen keine Liebe gesät,“ sagte er ruhig. Ueber das verfallene Antlitz vor ihm flammte eine helle Röthe. „Nun und Ihr habt Nachricht vom Frieder?“ lenkte er ab, „ich hörte es von meiner Mutter, welcher Therese diese Neuigkeit mittheilte. Geht’s ihm gut?“
„Gottlob, ja! Willst Du den Brief nicht mit hinaufnehmen? Er ist ganz interessant; vielleicht liest ihn auch Therese gern. Aber nun geh’ – sie erwartet Dich gewiß bereits zum Frühstück. Hast Du Deinen Buben heut’ schon gesehen?“
„Ja!“ sagte er, und ein Leuchten ging über sein Gesicht. „Frau Doris spaziert mit ihm im Garten.“ Er nahm das Schreiben, das auf dem Tischchen lag, mehr aus Höflichkeit als aus Neugier, und verabschiedete sich. Nachdem er sich rasch umgekleidet hatte, trat er in das Boudoir seiner Frau; sie war nicht da – nun wußte er sie sicher im Toilettezimmer. Richtig! Therese hatte von ihrem Papa ein neues Kostüm bekommen, das wie geschaffen zu einem Reisekleid war, und probierte es an. Sie wandte ihm lächelnd ihr rosiges Gesicht zu.
„Nun, wie geht’s Deinen beiden Lebensgefährlichen?“ rief sie, „erlauben sie uns abzureisen?“
„Ich kann Dir heute noch keinen bestimmten Bescheid geben, Schatz,“ antwortete er und betrachtete sie entzückt in ihrem kleidsamen Anzug. „Auf ein paar Tage kommt’s ja doch nicht an, wie?“
„O, bitte sehr! Da merkt man, daß Du noch nie gereist bist,“ erwiderte sie rasch. „und ob es darauf ankommt! Jetzt ist die große Saison in Ostende – ein paar Wochen später und wir sind mit unserem dreiwöchigen Aufenthalt in die Septembertage gerathen, und, weißt Du, im September, da gehen alle die hin, die billig leben wollen, aber kein einziger Mensch von [777] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt.
Distinktion, keine einzige Dame der vornehmen Gesellschaft; man sieht keine Toiletten mehr, man ißt viel schlechter, kurz – es ist gräßlich!“
„Armer Schatz!“ tröstete er lächelnd, „in Wahrheit, ich fürchte, daß uns diese beiden Kranken einen rechten Strich durch unsere Pläne machen.“
„Und das sagst Du so gelassen?“ fragte sie und schlang ein paar schwere graue Taillenbänder zur Schleife an dem seidenen Reisemantel, den er ihr umlegen half.
„Ja, was soll ich thun? Ich kann mir doch nicht die Haare ausraufen deshalb?“
„Es ist etwas Wahres daran, daß Ihr Aerzte Sklaven der menschlichen Gesellschaft seid,“ sprach sie sehr langsam, „und daß man – –“
„Wenn man einen geheirathet hat, mit eine Art Sklavin geworden ist,“ ergänzte er. „Nun, jedenfalls bist Du eine ganz entzückende kleine Sklavin, und mir thut es unbeschreiblich leid, daß möglicherweise diese wirklich allerliebste Toilette zufrieden sein muß, sich auf einem Rheindampfer der bewundernden Welt zu zeigen.“ Er seufzte komisch tief. „Ja, ehrlich, Frauchen, es steht schlecht um die beiden Leute; Gott weiß, wann wir die Reise antreten können.“
Sie sagte kein Wort; sie band ihre Schleife auf und zu und summte dabei leise vor sich hin. Endlich schien der Knoten gelungen; sie schnippte mit den schlanken Fingern ein Fäserchen fort, löste langsam die Schleife wieder auf, legte den Mantel ab, vertauschte ihr neues Kleid mit einer zierlichen Hausrobe, alles leise singend und ihm den Kuß wehrend, den er auf den schönen weißen Arm drücken wollte. Und als sie fertig war, sagte sie:
„Nun wollen wir frühstücken!“
„Du findest doch immer das Richtige!“ rief er.
Als sie sich im kühlen Eßzimmer gegenüber saßen, bemerkte sie: „Dir geht ja hier nichts ab, wenn ich mit Papa allein reise ... koste übrigens einmal dieses Hammelkotelett und diese pommes frites, sie hat sie ganz allein gekocht, die Susanne.“
Er legte Messer und Gabel hin und sah ehrlich verdutzt sein reizendes Gegenüber an.
„Du kannst ja dann nachkommen, wenn Du später Zeit hast,“ vollendete sie und schob ein goldbraunes Kartoffelstückchen zwischen die Lippen.
„Ist das Dein Ernst?“
„Ja natürlich! Sei Du Sklave, soviel Du willst, ich danke dafür! Was gehen mich die fremden Leute an mit ihrem Typhus!“
„Es wird uns sehr einsam hier sein, dem Buben und mir,“ sagte er endlich.
„Aber, ums Himmelswillen, Fritz, glaubst Du, ich werde das Kind hier lassen? Nein, der Bube geht mit seiner Frau Doris ebenfalls nach Ostende.“
„Nein, Herz, der Bube bleibt mit seiner Doris im Lande und nährt sich redlich weiter mit der Milch der schwarzbraunen Kuh, die extra für ihn auf dem ,Gelben Hofe’ gefüttert wird.“
Jetzt legte Frau Therese Messer und Gabel hin und starrte ihren Gatten ob des ungewohnten Widerspruchs erstaunt und neugierig an. „In Ostende giebt’s die herrlichste Milch“ sagte sie dann trocken; „außerdem, wir haben den neuen Kochapparat bei uns, mittels dessen die gesundheitsschädliche Milch gesundheitszuträglich zu machen ist. Alle Mütter nehmen ihre Kleinen mit – und ich will nicht ohne das Kind reisen!“
„Dazu wirst Du Dich dennoch entschließen müssen, wenn Du nicht hier bleiben willst, denn ich gestatte auf keinen Fall, daß Du das Kind den Gefahren aussetzt, die eine ganz veränderte Lebensweise für so ein junges Geschöpf mit sich bringt.“
„Aber, bester Schatz, Du thust, als gehörte Dir der Bube allein“ erwiderte sie in größter Ruhe. „Besinne Dich nur, zunächst haben die Mütter ein Anrecht auf ihre Kleinen! Was soll denn aus ihm werden ohne mich?“
Er mußte wider Willen lachen. „Du thust, als ob Du den Bengel für gewöhnlich nicht eine Minute lang aus den Armen ließest, und dabei besorgt ihn doch Doris so ziemlich ganz allein. Außerdem bin ich zur Aufsicht hier und ich brauche wahrhaftig nicht zu versichern, daß ich während Deiner Abwesenheit meine Hände doppelt über ihn breiten werde.“
„Und wenn Du nun mitgereist wärst?“
„Nun, dann sind ja hier noch drei erwachsene Frauenzimmer im Hause,“ erwiderte er, immer noch zwischen Aerger und Lachen. „Da ist erstlich die Großmutter,“ fuhr er fort, „die sich so wie so schon die Schuhsohlen abläuft, um den kleinen Burschen so oft wie möglich zu sehen –“
„Sehen mag ihn Deine Mutter, so oft sie will, aber ich wünsche nicht, daß sie sich um seine Erziehung bekümmert oder Doris in seine Pflege hineinspricht, wie sie das so gern thut und [778] natürlich erst recht thun würde, wenn ich fort bin. Sie hat mir ohnehin noch nicht vergeben, daß ich die drei Meter langen Wickelbänder nicht benutze, die noch von Dir da sind, und kann’s nicht begreifen, daß ich dem armen Kerlchen nicht in den schönsten Sommertagen eine wattierte Mütze auf den Kopf setze, sobald er in den Garten getragen wird."
„Ach, Therese, das habe ich ihr ja alles auseinandergesetzt. Sie liebt den Jungen eben zärtlich und –“
„Na, und nun kommt als zweite Beschützerin wohl Tante Riekchen, die selbst eine Wärterin braucht?“
„Nun gut, von Tante Riekchen sehen wir ab, dann aber vergiß Julia nicht!“
Jetzt blitzte es in den Augen der Frau Therese auf. „Ich muß Dich dringend bitten, Julia in dieser Angelegenheit als gar nicht vorhanden zu betrachten!“ rief sie. „Ich habe ganz bestimmten Anlaß zu der Meinung, daß sie mich nicht leiden kann; sie hat auch mein Kind nicht lieb –“
„Therese, Du wirst ungerecht!“
„Nein,“ antwortete erregt die junge Frau, „ich bin es nicht! Wenn Du nicht das thörichte sentimentale Mitleid mit ihr hättest, das Männer in innerster Seele allemal für diejenigen hegen, von denen sie sich geliebt glauben, so würdest Du längst bemerkt haben, welch geradezu widerwärtiges Betragen diese Mamsell Unnütz mir und dem Kinde gegenüber zur Schau trägt. Ganz von oben herab betrachtet sie mich.“
„Weil Du einen Kopf kleiner bist als sie,“ schaltete er gelassen ein.
„Ich scherze ganz und gar nicht in diesem Augenblick!“ rief sie. „Wenn ich etwas sage, zuckt es bei Fräulein Julia geringschätzig um die Mundwinkel; spiele ich mit dem Kinde, so sehe ich die dunklen Augen so seltsam auf mich gerichtet – ich kann es nicht ausdrücken wie – geradezu hungrig; sie gönnt mir den Buben nicht. Und wenn wir alle drei zusammen sind, so wendet sie sich ab und geht in ihre Stube, als sei unser Anblick Gift. Sie ist ein unheimlicher neidischer Charakter!“
„Wer erzählte Dir denn, daß sie mich einst liebte?“ fragte er ruhig, und seine Augen sahen an ihr vorüber zu dem Majolikateller, den Julia zur Hochzeit gemalt hatte.
„Mein eigenes bißchen Verstand, Herr Doktor, und Ihre eigene Frau Mutter.“
„So?“
„Und daß Du durch diese Thatsache noch immer tief gerührt bist, abermals mein eigener Verstand und meine eigenen Augen.“
„So?“
Er räusperte sich plötzlich, goß ein Glas Wein ein und sagte dann mit lauter Stimme: „Also, es wäre abgemacht, der Bube bleibt hier unter meiner und der Frau Doris Aufsicht.“
Sie sah ihm mit einem prüfenden Blinzeln in das Gesicht. Da sie aber nichts weiter zu erkennen vermochte als einen ungeheuer bestimmten Ausdruck, der einen Widerspruch kaum zuließ, seufzte sie, begann einen Pfirsich zu schälen und bemerkte dann:
„Man muß eben einmal wieder die Klügere sein und nachgeben.“
„Daran thust Du gut, kleine Frau!“
„Freust Du Dich denn nicht, daß ich gar nicht eifersüchtig bin auf – diese Julia?“ fragte sie nun und hielt ihm lächelnd die eine Hälfte der Frucht hin.
„Ich finde daran wirklich nichts, was mich zur Freude reizen könnte, es ist völlig normal,“ entgegnete er. „Ich würde mich höchstens freuen, daß sie nicht eifersüchtig ist. Du weißt ja, daß neben Dir kein anderes Bild in meinem Herzen Platz hat, ausgenommen das unseres Buben.“
Sie war aufgestanden und kam zu ihm herüber, um ihm einen Kuß auf die Stirn zu drücken. „Bist doch ein guter alter närrischer Mann,“ sagte sie.
Er hielt sie fest und zog sie auf seine Knie. „Und ich hoffe, Dein Herz ist ähnlich gebaut wie das meinige,“ scherzte er, „hat ebenfalls nur so ein kleines Kämmerlein, daß mein Bube und ich gerade drin Platz finden.“
Sie bog den blonden Kopf zurück. „Und wenn es nicht so wäre?“ flüsterte sie, und die blauen Augen strahlten voll Koketterie zu ihm empor.
„Therese, darüber sollst Du keine Scherze machen!“
„Nein, nein, laß!“ beharrte sie, „sage mir, was würdest Du thun, wenn Du entdecktest, daß außer Dir noch ein anderer Mann –“
Er antwortete nicht, er schien sich blitzartig einen Augenblick in diese Lage hineinzudenken, und die junge Frau erschrak, so aschfahl erschienen seine Züge, so starr blickten seine Augen.
„Um Gotteswillen!“ rief sie, „es war ja nur Scherz, Fritz!“ Und sie rüttelte ihn an der Schulter, selbst erbleicht.
„Was ich thun würde?“ sagte er dumpf. „Ich weiß es nicht, der Augenblick würde es mir eingeben, aber – ich kann einen Mord aus solcher Eifersucht begreifen.“
Sie erhob sich; es war, als ob ein Frost sie schüttle.
Und jetzt suchte er sie zu beruhigen. „Du thörichte kleine Frau, das kommt von Deinem dummen Fragen. Warnm von Dingen reden, die außer allem Bereich des Möglichen liegen? Komm’, trinke einen Schluck Wein und geh’ zu Papa, sag’ ihm, ich vertraue ihm zu der Erholungskur mein köstlichstes Besitzthum an. Und reise bald, damit Ihr bald wiederkommt!“
Er küßte sie noch einmal und ging hinunter.
Julia saß neben dem Fahrstuhl der Tante Riekchen unter dem Nußbanm im Garten. Die alte Dame schaute träumerisch vor sich hin, während Julia ihr die Zeitung vorlas. Die Räthin schnitzte Bohnen, ohne dabei den Blick von dem Kinderwagen zu lassen, der im Rebengang an der Mauer von Frau Doris hin und her geschoben wurde. Die kreischende Stimme der Alten, die mit dem kleinen Bübchen in allerhand unverständlichen Zärtlichkeitsausdrücken sprach, scholl bis hier herüber.
Das Gesicht der Räthin drückte Mißvergnügen und Argwohn aus; das der alten Wärterin glich dem einer gereizten Löwin, der man das Junge nehmen will. Frau Therese hatte gestern ihre Reise angetreten, und schon heute früh waren Großmutter und Doris am Bette des schlummernden kleinen Weltwunders anseinandergeplatzt, und der Doktor hatte kaum vermocht, die empörten Gemüther zu besänftigen.
Die tiefe wohlklingende Stimme Julias ward plötzlich unterbrochen durch den schrillen Ruf der Räthin: „Fahren Sie auf der Stelle aus dem grellen Sonnenschein da fort! Das Würmchen soll wohl den Hitzschlag kriegen?“
Die Wärterin that, als habe sie nichts gehört, und schwatzte ruhig weiter mit dem Pflegebefohlenen. „Gelt, mein Herzchen, gelt, Du hast sie lieb, die Sonne? Ei, ei, die gute schöne Sonne!“
„Das Frauenzimmer muß aus dem Hause, oder ich kriege den Schlagfluß!" stammelte die alte Dame.
Julia hatte das Blatt sinken lassen, so lange der Zwischenfall dauerte, und las nun weiter den Schluß einer Gerichtsverhandlung.
„Sieh’ doch erst einmal, ob etwas aus Afrika drin steht!“ bat Fräulein Riekchen.
„Ich sah schon nach, Tante; es kommt aber nichts,“ antwortete das junge Mädchen.
„Auch nicht unter den Depeschen?“
Julia suchte nach den Depeschen – Paris – London – Madrid. „Sansibar,“ murmelte sie. Auf einmal hob sie das große Zeitungsblatt dicht vor ihr Gesicht, und das Papier bebte in ihrer Hand.
„Warum zitterst Du?“ fragte die alte Dame.
Langsam sank das Blatt; die blassen aber unbewegten Züge des Mädchens wurden wieder sichtbar. „Zitterte ich?“ fragte sie. „Es ist nichts drin von Afrika.“
In diesem Augenblick lief die Räthin im vollsten Zorne hinüber, um der verhaßten Kinderfrau aus nächster Nähe ihre Meinung ins Gesicht zu schleudern.
Tante Riekchen blickte starr ihre Pflegetochter an.
„Soll ich weiter lesen?“ fragte Julia – ein seltsam veränderter Tonfall war in ihrer Stimme.
„Steht wirklich nichts Neues von Afrika drin?“
Julia schüttelte den Kopf und sah dem Doktor entgegen, der von seinen Berufswegen in der glühenden Augustsonne zurückkehrte, im leichten grauen Sommeranzug, den Strohhut in der Hand und seine Stirn mit dem Taschentuch trocknend. Sie machte sich etwas hinter dem Stuhle der alten Dame zu schaffen, sah den Näherkommenden an und legte den Finger auf die Lippen.
[779] Der Doktor trat ruhig herzu, setzte sich hin und begann von diesem und jenem zu erzählen. Julia schritt den Weg hinauf der Räthin entgegen, die im Gefühl ihrer Ueberlegenheit als Siegerin und als Großmutter mit hoch erhobenem Kopfe zurückkam.
„Ich möchte Dir etwas mittheilen, Tante. bitte, geh’ einen Augenblick mit hier hinunter,“ sagte Julia. „Ich las eben in der Zeitung, daß Frieder in einem Gefecht mit den Eingeborenen verwundet worden ist. Tante Riekchen darf es nicht erfahren.“
Die alte Dame schlug die Hände zusammen. „Schwer verwundet natürlich!“ rief sie. „Und das steht wohl auch nur so da, er ist am Ende schon tot. Großer Gott!“
Julia schwieg.
„Und Du,“ ereiferte sich die Räthin, „Du stehst da und sagst kein Wort? Was bist Du für ein Mädchen! Es ist doch Dein leiblicher Bruder, den’s betrifft. Ich habe den Windbeutel nie leiden mögen, aber ’s geht doch ans Herz, wenn er so gestraft wird, wenn er da draußen so elendig umkommen muß unter den Wilden, ohne eine Seele, die zu ihm gehört.“
Julia antwortete nicht auf den Vorwurf. „Bitte, beunruhige nur Tante nicht,“ bat sie. „Geh’ jetzt lieber nicht zu ihr, sie ist so aufmerksam und so mißtrauisch, sie würde Dir gleich anmerken, daß etwas geschehen ist.“
„So schlau bin ich auch,“ gab die alte Dame zurück, „ich mag das arme Thierchem auch gar nicht sehem. Geh’, hole die Zeitung und bringe sie mir in die Küche, ich will’s lesen.“
„Ja, ja,“ sagte sie für sich im Weiterschreiten, „entweder stirbt er, oder er kommt invalid wieder und liegt uns auf der Tasche. Gott im Himmel vergeb’ es mir – ich wollte, er wäre gleich tot gewesen!“
Nach Tisch, als das alte Fräulein ahnungslos im kühlen Zimmer schlief, saß Julia in ihrer Kammer am Fenster, regungslos die Hände im Schoße und das Zeitungsblatt vor sich, das die kurze bedeutungsvolle Nachricht enthielt. Auch jetzt hatte sich kein Zug des Gesichtes verändert, nur der kleine Mund war noch fester als sonst zusammengepreßt. Das war nun einmal so. Julia hatte längst erkannt, daß kein Jammern und Ringen einen Schicksalsschlag abzuwenden vermag, und über ihr persönliches Empfinden war eine Art Erstarrung gekommen; sie fühlte nur noch in der Seele anderer.
So dachte sie auch jetzt lediglich daran, daß die Nachricht von der Verwundung oder gar dem Tode des Lieblings die alte Frau nebenan wie ein Dolchstich treffen würde, dem sie erliegen mußte; sie dachte, daß Frieder vielleicht den Tod gesucht habe, weil er Therese nicht vergessen konnte, und daß sie ganz einsam sein werde, wenn sie nun auch keinen Bruder mehr habe. Denn wie fremd stand sie inmitten dieser Menschen, in deren Gemeinschaft sie gleichwohl ihr Leben verbracht hatte! Selbst an die Kranke fesselte sie nur die Pflicht, die Pietät; sie dankte durch die Pflege, die sie der Alternden angedeihen ließ, für die Pflege, die diese ihrer verlassenen Jugend gewidmet. Aber ein wärmeres Gefühl hatte sie nie für die alte Dame za fassen vermocht.
Und der Fritz?
Ihm gegenüber hatte sie ja mit aller Kraft ihr Herz zum Schweigen gebracht, ihm gegenüber war sie gleichgültig und kalt, und nur ein ohnmächtiger Zorn loderte immer wieder in ihr auf, wenn er sie bemitleiden wollte. Aber auch diesen hielt sie verborgen. Aeußerlich zuckte es nur schier verächtlich um den Mund, wenn Fritz, besonders im Anfang seiner Ehe, bemüht war, seine Zärtlichkeit, sein Glück in ihrer Gegenwart zu verbergen; wenn er bei ihrem Hinzutreten die Hand der jungen Frau fallen ließ, die er eben noch an seinen Mund gepreßt hatte, oder mühsam seine Augen von dem rosigen Antlitz derselben loszureißen versuchte.
Sie lächelte dann mit dem herben Zucken um die Mundwinkel, und sie lächelte ebenso, als er seine Sorge um das Lebett der geliebten Frau vor ihr verbergen wollte, zu jener Zeit, als der Bube erwartet wurde. Aber sein blasses, mit Schweißtropfen bedecktes Gesicht in jenen Stunden, die dem Erscheinen des Kleinen vorausgingen, war ihr gewesen wie eine Offenbarung. Wie mußte diese Frau geliebt sein! Und die Thränen an seinen Wimpern, mit denen er endlich das wichtige Ereigniß dem alten Fräulein meldete, diese zitternde Freude, dieser dankbare Jubel erweckten wieder den einen Gedanken in ihr: wie geliebt mußte diese Frau sein!
„Zeige mir Dein Kind, Fritz!“ hatte sie damals gefordert; und war mit ihm hinaufgestiegen in die eleganten Räume, und er hatte das Bündel mit dem Neugeborenen herausgeholt und sie das kleine Geschöpf betrachten lassen. Ueber dem Köpfchen des Kleinen hatten sich ihre Blicke getroffen.
Mamsell Unnütz wußte nicht, daß sie den Mann mit einem Ausdruck angesehen hatte, davor ihm das jubelnde Herz weh that. In diesem Augenblick war ihm das stille stolze Mädchen erschienen wie ein frierendes hungerndes Bettelkind, das mit fieberndem Verlangen in eine weihnachtshelle Stube schaut und über der Herrlichkeit, die es erblickt, vergißt, wie arm es ist. In den tiefen dunklen Augen stand ein seliges Entzücken über das winzige schlummernde Geschöpf. „Ach, wie lieb!“ flüsterte sie und streckte die Arme aus. Da rief Therese mit matter Stimme aus der Nebenstube, und Julias Arme sanken hernieder, die langen Wimpern legten sich noch tiefer über die Augen.
Man hatte ihm das Kind abgenommen; er begleitete Julia bis zur Thür, das Herz voll Seligkeit und voll Mitleid, und da hatte er dem Mädcheu gegenüber eine Taktlosigkeit begangen. Er hatte ihr die Wange gestreichelt und gesprochen: „Wirst auch noch einmal glücklich, Unnütz!“
Der eisige Zug um ihren Mund, der rasche Schlag auf seine Hand und am meisten der verächtliche Blick machten, daß er jäh verstummte. Seitdem hatte sie weder nach dem Kinde gefragt, noch es jemals angesehen wenn es an ihr vorübergebracht wurde.
Sie liebte das Kind nicht! So dachten wenigstens die Hausgenossen.
„Wer Kinder nicht leiden mag, hat kein Herz!“ sagte die Räthin zu ihr und fügte verwundert hinzu. „Und der dumme kleine Bube lacht Dich trotzdem an und ruft ‚Ula!‘' – so eine Unschuld!“
Sie ahnten alle nicht, daß der Kleine und „Ula“ heimliche Freundschaft geschlossen hatten, daß der alte Drache von Kinderfrau dem stillen schönen Mädchen ohne jeglichen Widerwillen das Kleinod anvertraute. Sie hatten förmlich ein feststehendes Stelldichein, die zwei; nämlich dann, wenn die junge Frau und die Räthin zum Kaffee oder Thee eingeladen waren, der Doktor auf Berufswegen wandelte und Tante Riekchen eingenickt war. Dann huschte Julia hinauf, kniete ans Bettchen und spielte mit dem Jungen und ließ sich geduldig von den ungeschickten dicken Händchen im Haar zausen. Sie lehrte ihn die ersten kleinen Kunststückchen, sie lehrte ihn „Papa“ sagen. Und dann preßte sie den kleinen Körper mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit an sich.
„O Du,“ flüsterte sie, „für Dich könnte ich sterben!“
„Lassen Sie mir den Buben ganz!“ schalt dann die Alte, die am Fenster zu sitzen pflegte und für den Kleinen Strümpfchen strickte, „und bleiben Sie lieber am Leben; der kann so eine gute Tante gebrauchen bei der Mutter.“
Frau Doris vermochte aus ihrer Abneigung gegen Mutter und Großmutter durchaus kein Hehl zu machen.
Julia antwortete nie auf dergleichen Ausfälle, und beim leisesten verdächtigen Geräusch verschwand sie aus der traulichen Kinderstube.
Einmal konnte sie nicht mehr entwischen und flüchtete sich klopfenden Herzens hinter den Vorhang, der bei Frau Doris die Stelle eines Kleiderschrankes vertrat, und da hatte sie mit geschlossenen Augen und zusammengepreßten Lippen alle die Zärtlichkeiten mit angehört, die der Vater seinem Liebling spendete. Wie klang seine Stimme so weich! Julia kannte diesen Tonfall, so hatte er vor langer Zeit auch zu ihr gesprochen! Und sie hatte gemeint, sie könne das nicht hören, sie müsse aufschreien vor Schmerz, wenn er nicht einhalte. – Gottlob, er ward abgerufen, und sie konnte entfliehen. – –
Plötzlich fuhr Julia aus ihren Gedanken empor – die Uhr im Nebenzimmer hatte die Stunde geschlagen, zu der sie ihre Besuche bei Frau Doris zu machen pflegte. Rasch erhob sie sich und huschte droben in das Kinderzimmer, aber Wärterin und Kind schliefen, die Alte auf dem Stuhle und der Kleine in der Wiege. Julia kniete vor dem Bettchen nieder und sah sich satt an dem fremden Glück. Auf einmal fuhr sie in die Höhe und suchte mit angstvollem Gesicht den Ausgang zu erreichen, aber diesmal gelang ihr die Flucht nicht. Der Doktor stand vor ihr und betrachtete sie mit erstaunten Augen.
„Du hier?“ fragte er. Und er dachte an die Aeußerung seiner Frau, daß Julia das Kind hasse.
[780] „Verzeih’!“ sagte sie trotzig und wollte an ihm vorüber.
„Warte einen Augenblick!“ sagte er ruhig, „ich suchte Dich drunten – es ist eine Depesche vom Frieder da. Man hat ihn auf seinen Wunsch an Bord eines unserer Kriegsschiffe gebracht, das nächstdem nach Deutschland zurückgeht. Das ist der lakonische Inhalt des Telegramms, das ich durch Vermittlung des Berliner Auswärtigen Amtes erhielt. Ueber sein Befinden ist nichts gesagt, aber da man den Transport gewagt hat, muß Hoffnung auf Genesung sein. – Er kommt also!“
Julia schoß eine Fluth von Gedanken durch den Kopf. „Hierher?“ stammelte sie.
„Wohin denn sonst? Er hat ja bei uns sein Heim!“
„Er soll aber nicht kommen!“ sagte sie angstvoll.
„Wie?“ fragte der Doktor, sich aus der gebückten Stellung aufrichtend. Er hatte das schlummernde Kind betrachtet.
„Nichts!“ antwortete sie und ging hinaus.
Julia fand in dieser Nacht keinen Schlaf, sie sah immer wieder zwei jugendliche Gestalten, wie sie einander gegenüber im Nachen saßen und sich anschauten mit Liebesblicken – Frieder und Therese. Konnten sie, die sich so angesehen hatten, jemals einander vergessen?
Mit schmerzendem Kopfe stand sie wieder auf. „Er darf nicht kommen, er darf nicht!“ sagte sie.
Und dann kam der alte Trotz. „Was geht’s mich an!“
„Und kurz und gut, liebe Schwägerin, der verwundete Weltfahrer wird bei mir wohnen,“ sagte Herr Krautner, der längst wieder mit seiner Tochter aus Ostende heimgekehrt war, und dabei stieß er nachdrücklich mit dem Stock auf die Diele. „Hier in diesem Hause ist einfach kein Platz, und bei mir sind zwölf Zimmer unbewohnt. Sorgen Sie sich nicht, es wird ihm bei mir nichts abgehen, und sehen können Sie den Herrn Pflegesohn, so oft Sie wollen; die Thür in der Gartenmauer, die ich für meine Kinder hab’ machen lassen, steht auch ihm offen. Also topp! Der Herr Premierlieutenant Adami nimmt sein Quartier bei mir!“
Tante Riekchen versuchte noch einige Einwendungen; es gehe ganz gut hier – er komme doch als Sohn zu seiner Mutter, sagte sie kläglich. Und die Julia könnte ins Dachstübchen hinauf – „ich würde ihr ein kleines Oefchen setzen lassen –“
„Vielleicht könnten Sie für das Mädchen auch den Kaninchenstall einrichten lassen,“ rief der alte Herr böse. „Nichts da, der Lieutenant kommt zu mir – gelt, Töchterchen,“ wandte er sich an das junge Mädchen, „so ist’s am besten?“
„Ja!“ sagte Julia und hob die Augen von ihrer Stickerei. „Ja! Jedenfalls gehe ich unter keinen Umständen in die kalte Dachstube.“
Tante Riekchen sah verwundert auf. Noch nie hatte das Mädchen sich gegen eine Anordnung, die ihre eigene Person betraf, aufgelehnt. Diese Unbescheidenheit rumorte der alten Dame in allen Nerven. „Nun, früher konnte man Dich nie aus dieser Stube heraus bekommen,“ bemerkte sie, „und jetzt willst Du nicht hinein?“
„Nein, Tante!“
„Warum nicht?“
Sie zuckte die Schultern. „Weil mich friert da oben,“ erwiderte sie kurz.
„Na, es ist abgemacht, der Lieutenant wohnt bei mir,“ begann nochmals der alte Herr – dann eine Verbeugung und er ging.
Die Znrückbleibenden sprachen nicht miteinander. Fräulein Riekchen weinte leise; Julia bemerkte es nicht. Sie sah nur dann und wann einmal von ihrer Arbeit auf in das Flockengestöber des Dezemberschnees.
„Du wirst ihn doch vom Bahnhof abholen,“ begann endlich Tante Riekchen, „und ihm schonend mittheilen, daß im Hause seiner Pflegemutter kein Platz für ihn ist?“
„Ja!“
„Du hast Dir so einen barschen Ton angewöhnt, Julia; man hat Angst, Dich um etwas zu bitten,“ klagte das alte Fräulein.
„O,“ antwortete das Mädchen, „war ich früher anders?“
„Alle im Haue klagen,“ fuhr Tante Riekchen fort. „Schrecklich ungefällig ist es doch von Dir gewesen, daß Du bei der Tanzgesellschaft oben nicht ein wenig helfen wolltest!“
„Ich verstehe ja dergleichen nicht – und dann . . . Therese kann mich nicht um sich leiden.“
In diesem Augenblick klopfte es, und Therese trat ein. Sie sei beim Weihnachtsmann gewesen, sagte sie lachend, und habe etwas mitgebracht. Und unter allerhand Scherzreden wickelte sie zwei kleine Pakete aus und reichte jeder der beiden Damen eins. Es war noch nie geschehen, daß Therese eine Aufmerksamkeit für Julia gehabt hatte. Diese blickte zuerst überrascht auf die elegante Frau in dem kostbaren Sammetmantel, auf dessen braunen Falten noch die Schneeflocken lagen.
„Für mich?“ fragte sie, und in den Mundwinkeln erschien flüchtig das gewohnte Zucken.
„Ja gewiß!“ lautete die Bestätigung; und dann eilte Therese schon wieder hinaus.
„Nun, da bist Du ’mal wieder auf der Stelle überführt von der Unrichtigkeit Deiner Behauptung, daß Thereschen Dich nicht leiden kann,“ sagte Fräulein Riekchen.
„Dadurch?“ Julia nahm sich nicht einmal die Mühe, das Päckchen zu öffnen. Sie strickte weiter, während die Kranke mit den steifen Fingern ihr Geschenk mühsam aus der knisternden Hülle wickelte und sich über das elegante Büchschell freute, das herausfiel und in dem irgend eine Näscherei sein mochte. Das Geschenk Julias lag am Abend noch ebenso da, als schon das Mädchen hinausgewandert war, um den heimkehrenden Bruder am Bahnhof zu empfangen.
„Sie wird immer unleidlicher,“ sagte die Räthin, als sie die Geschichte des unbeachteten Geschenkes hörte. „Wenn Du sie nicht so nöthig brauchtest, Riekchen, Du hättest sie längst gehen lassen müssen – aber das ist’s ja eben!“
„Daß sie so lieblos wurde, ist mein größter Kummer,“ gab Fräulein Riekchen zu, und dabei zitterte ihr altes Herz vor Freude, den geliebten Buben bald ans Herz schließen zu dürfen.
„Eine Mutter kann ihr eigenes Kind nicht ungeduldiger erwarten, murmelte die Räthin und ging in ihre Stube zurück, um nicht die „Komödie“ des Wiedersehens mit zu erleben.
Eine halbe Stunde später saß Tante Riekchen zwischen ihren beiden Pflegekindern beim Abendessen. Die alte Dame konnte vor Freude nichts genießen, sie betrachtete nur immer und immer wieder den schönen stattlichen Mann, dessen gebräuntem Antlitz man kaum mehr eine Spur des Leidens ansah, obgleich er noch immer den Arm in der Binde trug.
Er gab freundlich und geduldig Antwort auf all die verwirrten Fragen der gealterten Frau, er erzählte zum vierten Male in dieser Stunde die Geschichte seiner Verwundung, er lobte die Karpfen und den Rheinwein und sagte der Schwester, er finde, sie sei schön geworden, groß und echt römisch. Er fand es „all right“, bei dem „alten Knopf“ drüben zu wohnen, nachdem er sich besonnen, daß ja droben – richtig, droben – Fritz hause mit seiner jungen Frau, und hörte mit höflicher Theilnahme die begeisterte Schilderung über das „Bubi“ an, welche die Tante in ihrer Herzensfreude vortrug.
„Und überhaupt, Frieder,“ schloß sie, „da droben wohnen glückliche Leute; so wie die zwei zusammenpassen, paßt selten ein Paar, und heute, wo sie fast drei Jahre verheirathet sind, schauen sie einander noch genau so verliebt an wie am Verlobungstag.“
Er nahm sich noch einmal Fisch. „Das frent mich herzlich,“ meinte er trocken. Julia fand nicht den Muth, ihn dabei anzublicken.
„Morgen wirst wohl droben Deine Aufwartung machen,“ fuhr Tante Riekchen fort, „und auch bei Tante Minna drüben? Da kannst Du es selbst sehen, wie Junges erblüht und Altes abstirbt. Ja, mein Bub’, viel später hättest Du nicht kommen dürfen, wolltest Du mich überhaupt noch finden.“ Und der alten Dame rannen die Thränen über die Wangen, die sie nicht zu trocknen vermochte mit den armen hilflosen Händen.
„Du mußt zu Bett gehen,“ sagte endlich Julia leise.
„Ach, nicht so rasch, ich kann doch nicht schlafen,“ bat die Tante. „Hol’ Aepfel und Nüsse, Julia, es ist dann wieder wie damals, als Ihr Kinder waret.“
Gehorsam trug Julia das Verlangte herzu, und Frieder begann wieder zu plaudern. Dann verstummte er jäh, und eine dunkle Röthe überzog sein Gesicht. Droben wurde Klavier gespielt.
„Es ist Thereschen,“ sagte die alte Dame stolz, „es gilt dem Bub’.“
[781]
[782] Julia hing mit angstvollen Blicken an seinen Zügen; von droben klangen schwermüthige Melodien, es war eine Variation über das Lied „Ein Wanderbursch mit dem Stab in der Hand.“
„Es ist ein Lieblingsstück von Fritz,“ bemerkte Julia laut und setzte geräuschvoll die Teller zusammen. Und die alte glückselige Frau sprach leise die Worte der Dichtung nach, während sie die Hand des Mannes streichelte:
„So sehr auch die Sonne sein Antlitz verbrannt,
Das Mutteraug’ hat ihn doch gleich erkannt.“
„Aber anders siehst Du aus, als wie Du fortgingst, Frieder; hübscher bist Du geworden, so hübsch fast, wie Dein Vater war.“
Er erhob sich plötzlich, denn von droben ertönte jetzt der Faustwalzer.
„Nun schlaft wohl,“ sagte er, „wir sind alle müde. Auch bin ich noch nicht wieder so ganz auf der Höhe, morgen erzähle ich mehr. Hilf mir den Mantel umlegen, Julia, und dann, Gute Nacht! Den Weg weiß ich ja noch.“
„Nein, ich komme mit,“ wehrte sie. Und zusammen schritten sie durch die verschneiten Gartenwege.
„Also eine Thür ist jetzt hier,“ murmelte er. Und als wollte er gewaltsam alle Erinnerungen abschütteln, sprach er laut: „Die alte Frau ist recht hinfällig geworden – Ach, grüß’ Gott – Herr Krautner! Freut mich, daß Sie mir gastlich Ihr Haus öffnen; wie ist’s Ihnen gegangen?“
Julia, die bei der Begrüßung der beiden sofort umgekehrt war, hörte noch, wie der alte Herr sagte. Willkommen, Herr Lieutenant! Nun, wie geht’s, wie steht’s? Haben sie sich auch, wie ich Ihnen beim Abschied empfahl, ein paar solide Träger in ihren lustigen Kopf eingezogen? Ja? Na, das soll mich freuen. Nun treten Sie ein und lassen Sie es sich wohlgehen bei mir!“
Als sie zurückkam, war die Musik droben verstummt. Sie traf im Flure den Doktor, der eben aus seinem Studierzimmer trat.
„Sag’ mal, Unnütz,“ fragte er, „hab’ ich mich geirrt oder spielte Therese wirklich?“
„Ja, sie spielte.“
„Wunderlich!“ murmelte er. Dann wandte er sich noch einmal um. „Ist Dein Bruder glücklich eingetroffen?“
„Ja!“ erwiderte sie kurz und verschwand.
Oben im Boudoir fand der Doktor seine Frau aufgeregt hin und her gehend.
„Es ist gut, daß Du kommst,“ sagte sie, „ich habe so ein Angstgefühl, das muß wohl der Wind machen.“
„O Du kleine Weisheit!“ neckte er. „Draußen rührt sich kein Lüftchen; es schneit nur in großen dicken Flocken, damit Du zu Weihnachten Schlitten fahren kannst. Uebrigens, hast Du etwas gemerkt von dem Afrikaner?“
„Ich? Nein – was habe ich mit ihm zu thun?“ erwiderte sie hastig.
„Nun, sei nur nicht böse, es liegt doch keine Beleidigung in meiner Frage, Schatz!“
„So hab’ ich’s auch nicht gemeint.“
„Na also! Aber es freut mich, daß Du wieder einmal Klavier gespielt hast, liebes Herz.“
Sie antwortete nicht.
Nun war der junge Offizier bereits drei Wochen in der Heimath. Es ließ sich gar nicht leugnen, er hatte „Leben in die Bude“ gebracht, wie Doktor Roettger gut gelaunt zu seiner Frau sagte.
Die Abneigung der beiden alten Spielkameraden schien völlig geschwunden. Wenn sie sich auch nicht vor Zuneigung „aufaßen“, so war doch gegenseitige Achtung an Stelle der früheren Zurückhaltung getreten; jeder achtete im anderen den tüchtigen Mann, der für seinen Beruf alle Kräfte einsetzt. Das hochfahrende Gebahren des Lieutenants war einem liebenswürdigen bescheidenen Wesen gewichen, und des anderen Derbheit einer Milde, die ihren Ursprung in seinem häuslichen Glücke zu haben schien. Und so gab es jetzt gemüthliche Plauderstunden am Theetisch beim Doktor oben, zu denen sich die ganze Familie versammelte und wobei der Weitgereiste den Mittelpunkt bildete; es gab festliche Sonntagsbraten in der Krautnerschen Villa, und sogar die Frau Räthin hatte sich zu einer Kalbskeule aufgeschwungen.
Das Weihnachtsfest war vorübergegangen mit seinem Lichterglanz; droben im Eßzimmer des jungen Paares hatten reiche Gaben die Familie um den Tisch versammelt, und das Stimmchen des Kindes, das jauchzend vor Freude nach dem schimmernden Baum die Händchen ausgestreckt hatte, war beglückend in aller Ohren geklungen.
Selbst von Julias Brust war ein Druck gewichen, sie athmete freier jetzt; die Wunde, welche die schöne blonde Frau einst dem Herzen des Bruders geschlagen, schien völlig vernarbt, und Therese – ja Therese hatte weniger als je Ohren und Augen für jemand anders als für ihren Mann. Nie konnte Julia entdecken, daß die beiden, der Frieder und die Therese, auch nur einen Blick wechselten, der über das zwischen harmlosen Bekannten oder Verwandten übliche Maß von Vertraulichkeit hinausgegangen wäre. Sie standen auf dem Fuße gegenseitiger freundlicher Werthschätzung und verkehrten, als hätte nie dieser schöne blonde Kopf an seiner Brust gelegen, als hätte er nie den rothen Mund der reizenden Frau geküßt, als hätten nie ihre Augen die heißesten Thränen um ihn geweint.
Julia freute sich; aber sie staunte über diese Thatsache wie über etwas Unbegreifliches. Ob ihm das Herz nicht ein bißchen wehthat?
„Des Löwen Spur.“
Vineta, die vom Meere verschlungene Wendenstadt mit ihren marmornen Palästen und güldenen Dächern, wem wäre sie
nicht bekannt! Oder die über den Wellen stehen gebliebene nordische Trümmerstadt Wisby, wer hätte nichts von ihr gehört!
Wie aber steht es um unser niedersächsisches Wisby, die alte Bardenstadt Bardowiek? Nur wenige wissen von ihr, und als
am 28. Oktober 1889 zum siebenhundertsten Mal der Tag sich jährte, da Bardowiek von Heinrich dem Löwen zerstört wurde,
weil es ihm in den Tagen seiner Acht die Thore verschlossen hatte, da haben nur wenige Zeitungen Bardowieks gedacht. Und
doch kann es mit Stolz darauf hinweisen, daß es eines der ältesten, wenn nicht gar das älteste deutsche Gemeinwesen ist!
Aber es liegt seit Jahrhunderten in Trümmern, dank der gar zu gründlichen Zerstörung sind nur wenige Spuren seiner einstigen
Größe übrig geblieben, und unsere Forscher haben vielleicht zu wenig gethan, um das Dunkel zu lüften, das über diesen
Ruinen schwebt.
Ja, ein märchenhaftes Dunkel liegt über dem Ursprung von Bardowiek, und wie gar oft, so hat auch hier geschäftige Phantasie des Wissens Lücke zu füllen sich bemüht. Alte Chronisten und mit ihnen auch Christian Schlöpken, dem wir die einzige Chronik von Bardowiek verdanken, sind nicht abgeneigt, es für eine phönizische Kolonie zu halten. Der Mindener Dominikanermönch Heinrich von Herford aber erzählt. „Zween aus denen 72 Jüngern Christi sind von dem heiligen Apostel Petrus in Teutschland gesandt, das Wort Gottes zu predigen. Der eine unter ihnen, nämlich Maternus, gen Trier an der Mosel; der andere, nämlich Egistus, nach Bardowick an der Elmenow, in Begleitung des Mariani, der sein Archediakonus gewesen; welche beyde auch zu Bardowick die Märter-Krone erhalten haben, und ruhen ihre Gebeine noch daselbst und zwar des Egisti seine am unbekandten Orte bey dem großen Altare zu St. Peter daselbst.“
Wenn also nach dieser Nachricht Bardowiek schon im ersten Jahrhundert n. Chr. Geburt bestanden haben müßte, so verlegt eine räthselhafte Inschrift im Dome seine Anfänge noch viel weiter zurück, nämlich 1065 Jahre nach Abraham und 250 Jahre vor Rom, das wäre rund das Jahr 1000 vor [783] Chr. Geburt. Können auch diese Zeugnisse auf geschichtliche Glaubwürdigkeit keinen Anspruch machen, so weisen sie doch darauf hin, daß man die Stadt im Mittelalter schon für außerordentlich alt hielt; „vetustissma urbs“, eine uralte Stadt, nennt sie auch eine Urkunde aus der Zeit Kaiser Heinrichs VI. (1190 bis 1197), und sicher ist, daß sie schon zu Karls des Großen Zeit von hervorragender Bedeutung war.
Nach dem, was bis jetzt über Bardowiek erforscht ist, haben wir es bei seinem Eintritt in das Licht der Geschichte als die Hauptstadt eines sächsischen Gaues anzusehen, welcher unter dem Namen „Bardengau“ bekannt und berühmt geworden ist und der sich seinem Umfang nach ungefähr mit dem heutigen Regierungsbezirk Lüneburg deckt. Es war ein gefährlicher Posten, hier außen an der Grenze des Deutschthums gegen das Wendenthum, und lange Jahre war der Bardengau der Schauplatz des heißen Kulturkampfs zwischen den beiden Völkern, eines Kampfes, an dem die Sachsenherzöge, das aus dem Bardengau stammende Geschlecht der Billunger, so hervorragenden Antheil genommen haben. An das Christenthum haben sich die Bardengauer verhältnißmäßig früh angeschlossen; schon 780 erschienen sie bei Ohrum an der Ocker, um die Taufe zu empfangen, während ihre Stammesgenossen noch lange für ihren angestammten Glauben gegen die gewaltsame Propaganda Karls des Großen stritten, und daraus mag es sich auch erklären, daß Karl der Große, wenn er wie 785 und 795 im Sachsenlande Hof hielt, gerne die Lüneburger Gegend wählte. Da mag auch Bardowiek unter den Plätzen gewesen sein, welche das kaiserliche Hoflager aufzunehmen hatten.
Bardowieks Glanzzeit fällt indessen unzweifelhaft in die Regierungszeit der Billunger, dieses tapferen Geschlechts, das von Otto dem Großen zum Grenzwächter des deutschen Reiches ausersehen war. Hermann Billung und seine tapferen Nachfolger Benno, Bernhard, Ortulf und Magnus sind es gewesen, welche der von Osten herandrängenden slavischen Fluthwelle einen starken Damm entgegensetzten und in dem kritischen Augenblick, in welchem das Uebergewicht der Slaven im ganzen Norden entschieden zu sein schien, mit der Kraft ihrer Mannen den letzten Schatten einer Herrschaft des Deutschthums aufrecht erhielten und Deutschland vielleicht vor einer gewaltigen Krisis bewahrten. Ein Stück jenes grausamen Kampfes hat uns Christian Schlöpken in seiner Chronik überliefert.
Aus der Bedeutung des Gaues ergiebt sich auch die Bedeutung seiner Hauptstadt. Sie war schon zu Karls des Großen Zeit befestigt, und bis hierher erlaubte er den deutschen Kaufleuten mit ihren Waren vorzugehen. Die Lage der Stadt war eine überaus günstige, an der schiffbaren Ilmenau unweit der Elbe, für den Seehandel erreichbar, zugleich vor den Seeräubereien der Normannen geschützt und doch auch wieder für den Binnenhandel geeignet.
Ein großartiger Zwischenhandel zwischen Sachsen und Wenden wurde hier betrieben, und außerdem führte über Bardowiek die große, im Mittelalter sehr bedeutende Straße von Artlenburg an der Elbe, welche hauptsächlich den Dänen, Mecklenburgern und Holsteinern als Handelsweg diente. Noch trägt eine benachbarte alte Furch über die Ilmenau den Namen der „Holstenfurth“. Für den südlichen Theil des Sachsenlandes war Bardowiek der Ort, von wo die Erzeugnisse des Meeres und überseeische Produkte geholt wurden. So sandte u. a. Helmstedt seine Dienstpflichtigen dahin, um Seefische einzukaufen, ebenso das Kloster Corwey. Desgleichen legen die aus Urkunden bekannten Zölle Zeugniß von Bardowieks ausgedehntem Handel ab. Aber das wichtigste Zeichen seiner Macht und Freiheiten ist wohl die Bardowieker Münze, nach Schlöpken „Bardowieker Pfennig“ genannt. Sie scheint nicht nur in ganz Norddeutschland, sondern auch im Obotritenland gegolten zu haben, denn nach einer alten Nachricht gaben die Circipaner dem Zwantewit jährlich „entweder einen Fuchsbalg oder sechzig Geldstücke, die ganz so aussahen wie Bardowieker Münze, wenn sie nicht gar dazu gehörten“. Und um das Bild des alten Bardowiek zu vervollständigen, möge hier noch erwähnt werden, daß die Stadt zur Zeit ihrer Blüthe nicht weniger als neun Kirchen besaß. Heute freilich find von allen nur noch zwei übrig, der Dom und die Nikolaikirche.
Nach dem Aussterben der Billunger, deren Regentenreihe mit Herzog Magnus abschließt, kam das Herzogthum Sachsen und mit ihm Bardowiek an Lothar von Suplinburg und später durch Verleihung an die Welfen. Unter den Welfen war besonders Heinrich der Löwe bemüht, den Handel Bardowieks zu heben und es zur nördlichen Hauptstadt seines Reiches zu machen; aber auch Lübeck, nach dem sich mehr und mehr der Handel der nordöstlichen Länder hinzog, erfreute sich seiner Begünstigung, und aus diesem Umstand wird wohl die Spannung zwischen ihm und Bardowiek herzuleiten sein, welche später in so bitteren Haß umschlug. Heinrich der Löwe, welcher dem Kaiser Friedrich Barbarossa den Gehorsam verweigert hatte, war von den deutschen Fürsten in die Acht erklärt und mußte sein Land verlassen. Als dann der Kaiser im Jahre 1189 den Kreuzzug nach dem fernen Osten angetreten hatte und Heinrich – gegen seinen Eid – aus der Verbannung zurückkehrte, verschloß ihm Bardowiek die Thore und wollte den Geächteten nicht als Herrn anerkennen. Erzürnt rückte Heinrich mit Heeresmacht herbei und belagerte die Stadt, aber die trotzigen Bürger gaben nicht nach, sie setzten sich tapfer zur Wehr, ja sie sollen ihren Gegner noch durch derbe Verhöhnung von der Mauer herab besonders gereizt haben. Zwei Tage lang brach sich des Löwen Wuth an den festen Mauern. Schon verzweifelte Heinrich an dem Gelingen, da, am dritten Tage, ward ein Zufall der übermüthigen Stadt zum Verderben. In das herzogliche Lager hatte sich ein Stier verirrt. Die Soldaten wollten ihn fangen, allein der Stier flüchtete sich vor ihnen durch die Ilmenau in die Stadt, wohin er gehörte. Verwundert bemerkten seine Verfolger, daß dem Thiere das Wasser nur bis an den Leib reichte – es mußte dort eine Furth vorhanden sein. Zudem war die Stadtmauer an dieser Seite nur schwach vertheidigt, da die Belagerten auf den Schutz des Wassers rechneten. Ehe sie ihren Fehler verbessern konnten, setzte die Reiterei Heinrichs durch den Fluß, das Fußvolk folgte nach, und bald hatten die Bardowieker um ihr Leben zu kämpfen. Nach einem furchtbaren Blutbade, in dem selbst Weiber und Kinder nicht verschont blieben, sank die Stadt in Asche und Trümmer.
So zertrat des Löwen Fuß die reiche Stadt, die sich nie wieder aus ihren Trümmern erhob. Nur der Dom erhielt sich, jedoch seiner kostbaren Gefäße und Schätze beraubt, bis auf die späte Nachwelt. Ueber seine Hauptthür ließ Heinrich einen aus Holz geschnitzten Löwen setzen mit der Inschrift „Vestigia leonis“ – „des Löwen Spur“.
Aus den Trümmern von Bardowiek erhob sich später ein Gemüse bauender Flecken. Wenn demselben auch manche Rechte und Freiheiten verblieben, so sank doch sein Ansehen immer mehr. Nicht einmal die alte Stadtmauer wurde wieder aufgerichtet, sondern die gewaltigen Granitquadern, aus denen sie erbaut war, wurden von den Bardowiekern an die Hamburger verkauft, welche daraus ihre großen Ufermauern an der Elbe herstellten. Dafür erhielten die Bardowieker in Hamburg gewisse Rechte, u. a. auch ein Haus zur Niederlage ihrer Gemüse, vom Volke das „Zippelhaus“ (Zwiebelhaus) genannt. Leider ist dieser altehrwürdige Rest aus Hamburgs Vergangenheit dem neuen Hafenbau zum Opfer gefallen und damit wieder ein bedeutungsvolles Stück Bardowieker Erinnerung von der Bildfläche verschwunden. A. Kohlenberg.
[784]
C. W. Allers und seine Bismarck-Mappe.
Ich sitze seit einigen Tagen höchst gemüthlich beim Eisernen Kanzler,“ so lautete der Zettel, den mir mein Freund Allers – er schreibt fast immer auf ein beliebiges Stück Papier, das ihm gerade zur Hand ist – vor längerer Zeit von Friedrichsruh aus schickte und der mich vermuthen ließ, daß dort ein neues Werk seines Stiftes im Werden begriffen sei. Ich hatte mich nicht getäuscht, denn in jenen Tagen entstand die Mappe „Fürst von Bismarck in Friedrichsruh“, welche in 70 Blättern das Leben des greisen Kanzlers in seinem von Buchen umrauschten Tuskulum vor Augen führt und welche nunmehr das Licht der Oeffentlichkeit erblicken soll.
Keine Lobrede will ich halten, man kann es den Werken von Allers und insonderheit diesem neuesten ruhig überlassen, für sich selbst zu sprechen. Nur soviel will ich mir zu bemerken erlauben, daß gerade dieser Bismarck-Mappe eine Bedeutung zukommt, die weit über das Interesse des Tages, auch über das künstlerische, hinausragt. Noch späte Geschlechter werden es dem Maler dank wissen, daß er ihnen den Mann, der einst so viel erstritten hat und so viel umstritten wurde, in lebenswahrer Anschaulichkeit verewigt, daß er es ihnen ermöglicht hat, diesen Mann zu sehen, wie er als Mensch im Kreise der Seinen lebte.
Und ein anderer als Allers mit seinem angeborenen Humor wäre auch nicht leicht imstande gewesen, ein solches Werk wie das vorliegende zu schaffen. Der echte und unverfälschte Humor des Künstlers war es wohl auch, welcher diesem die Sympathie des großen Staatsmanns eintrug und welcher es Bismarck leicht gemacht haben mag, sich vor seinem Gaste ganz zu geben, wie er ist, was auf die Arbeit des Malers von vortheilhaftestem Einfluß sein mußte.
Fürst Bismarck ist nie ohne Besuch; abgesehen von den Passanten sind stets einige seiner Familienangehörigen oder seiner Freunde auf längere Zeit zugegen. Allers, der durch Dr. Schweninger dem Fürsten vorgestellt wurde, hatte das Glück, zu denjenigen gezählt zu werden, welche „nicht stören”, die also vollständig zum Familienkreise gehörten, wie der heitere, stets gern gesehene Leibarzt, wie Lenbach, dort „Achill“ genannt, wie Dr. Chrysander oder der nun verstorbene Lothar Bucher, der immer noch ein Stündchen mit dabei saß, um dann sanft einzunicken oder sich heimlich zu entfernen. Und so konnte es Allers gelingen, den Fürsten, beinah ohne daß dieser es merkte, am Abend nach Tisch, wenn er seine Pfeife dampfte und mit überlegenem Lächeln die Zeitungen las, auf dem Spaziergang, oder wo es sonst war, auf das Papier zu fesseln. Aber nicht nur in seiner Eigenschaft als Maler verweilte Allers über ein Vierteljahr in Friedrichsruh und in Varzin, auch als freundlicher Erzähler für Alt und Jung war er geschätzt, und außerdem lag ihm die wichtige Aufgabe ob, allzulange haftende Besucher, die den Heimweg nicht mehr finden konnten, in höflich liebenswürdiger Weise flott zu machen. „Es ist wohl bald Zeit zum Zuge“ – „Jetzt muß der Fürst Ruhe haben,“ das waren so die feinen Winke mit dem Zaunpfahl, welche dabei angewendet wurden.
Am Abend las zuweilen der Fürst oder die Fürstin vor, man spielte Skat oder sang mit Begleitung des Dudelkastens, die Enkel des Hauses führten kleine Tänze auf; bei schönem Wetter bot der Wald einen willkommenen Aufenthalt, Picknicks wurden veranstaltet, bei denen Allers gewöhnlich das Backen der Pfannkuchen zufiel, weil er die größte Gewandtheit im Umdrehen derselben aus freier Hand entwickelte. Zum Kummer der drei Enkel Rantzau fiel dabei keiner in die glühende Asche.
Es ist leicht, mit Allers bekannt zu werden, vorausgesetzt, daß er sich von innen heraus zu jemand hingezogen fühlt; sonst freilich kann er auch ein ziemlich abweisendes Wesen an den Tag legen.
„Der Mann gefällt mir nicht!“ damit ist oft die Sache abgethan, und Allers bleibt kühl bis ans Herz hinan, denn nach seinem Wahlspruch: „Ich bin ein freier Mann und singe!“ thut er sich niemals Zwang an. Am wenigsten läßt er sich zu Europens übertünchter Höflichkeit herab, wenn sie ihm nicht von Herzen kommt. So erschien auf Capri einmal eine Amerikanerin bei ihm, die ihm goldene Berge bot, wenn er sie zeichnete. „Nicht rühr’ an!“ dachte Allers, und wirklich mußte die alternde Schöne unverrichteter Sache wieder abziehen.
Wir beide fanden uns schnell, als Allers in Meiningen die „Meininger“ zeichnete. Bei allen seinen großen Erfolgen ist er stets der gemüthliche Hamburger geblieben, der sich durch nichts aus seiner Ruhe bringen läßt. Etwa 30 Jahre alt, ist Christian Wilhelm Allers wohlbeleibt und hat ein Paar Augen, aus denen uns Gutmüthigkeit und überwältigender Humor entgegenblitzen. Was er auch sagt, kommt drollig heraus, und wenn er von seiner Jugend erzählt, die er theils bei seinen Eltern in Hamburg, theils auf dem Dorfe bei seinem Großvater verlebte, oder von seiner Sturm- und Drangperiode plaudert, in der er sich für Kost und Unterkunft durch ganz Italien „pinselte“, wo er Direktor eines wandernden Liebhabertheaters war, bei dem jeder nur spielen durfte, wenn er ein gewisses Honorar bezahlte, stets entwickelt er jenen köstlichen Humor, der dem Zuhörer das Zwerchfell erschüttert und zugleich die Augen feuchtet.
Auf Capri sahen wir uns wieder. Plötzlich stand er in seinem großen Schlapphut vor mir, ganz der Alte, nur gebräunt von der Sonne des Orients, den er auf der „Augusta Viktoria“ kurz vorher besucht hatte.
„Jetzt geht’s los, Major, Capri-Mappe!“ rief er mir entgegen.
„Mensch,“ war meine Antwort, „hundertmal habe ich Sie herbeigesehnt, denn alles scheint hier für Ihren Stift geschaffen zu sein!“
[785] Am nächsten Morgen um sechs Uhr stand schon das erste Modell vor ihm. Man muß es sehen, wie Allers zeichnet. Gummi, irgend welche Hilfsmittel kennt er nicht – Papier, ein mittelweicher Bleistift stets derselben Sorte, das ist alles, was er braucht. Aber nein, doch noch etwas: den kleinen und den Mittelfinger der rechten Hand, mit denen er die zarten Töne auf das Papier wischt.
In höchstens fünf Minuten sind die allgemeinen Umrisse seiner Modelle, welche er niemals gekünstelt hinstellt, sondern sich selbst überläßt, mit wenigen Strichen hingeworfen; dann schreitet er zu der Ausarbeitung des Kopfes, die mit einer so großen Schnelligkeit und Sicherheit vor sich geht, daß die Aehnlichkeit dem Beschauer sozusagen entgegenwächst. Er zeichnet nie etwas aus dem Kopfe, der kleinste Gegenstand seiner Blätter ist stets von der Natur abgenommen, und darauf beruht zum großen Theil die überzeugende Wahrheit seiner Darstellungen. „Schönheitspinsler bin ich nicht,“ pflegt er zu sagen, und die Nase von Herrn Soundso wird ebenso dick auf das Papier geworfen, wie Mutter Natur sie ihm in das Gesicht gepflanzt hat, und Fräulein Rosamundens Leberfleckchen wird zu ihrem Kummer auch verewigt.
Allers unterhält sich bei der Arbeit gern, und niemals schafft er flinker und besser, als wenn es um seine Staffelei recht lustig hergeht, wenn der Becher kreist, wenn Musik erklingt oder wenn ihm jemand etwas vorliest. Zu dem letzteren versteht sich, wenn er ausnahmsweise „ohne Hofstaat“ arbeitet, besonders seine prächtige Mutter, das Musterbild einer biederen echten Holsteinerin, an der er mit rührender Zärtlichkeit hängt und welcher er, gleich wie seinem Vater, einem früheren Hamburger Kaufmann, den Lebensabend zu verschönen sucht, so viel er nur kann. Sie wohnen in Karlsruhe in seiner Villa und führen dort ein beschauliches Dasein, begleiten ihn auch oft auf seinen Reisen.
Ich sprach vorhin von Allers’ Staffelei, und jetzt fällt mir ein, daß er, wenn er mit Bleistift zeichnet, eine solche niemals benutzt, sondern daß ihm ein einfacher Pappendeckel, den er auf die Knie legt oder in der Linken hält, als solche dient. Er zeichnet stehend, sitzend, liegend, wie es die augenblickliche Lage eben mit sich bringt, und ist niemals seiner Stimmung unterworfen, er kann eben schaffen, wann er will – und er will immer. Daher auch die reiche Fülle seiner Werke. Wie viele Mappen hat er nicht schon geliefert? „Silberne Hochzeit“, „Mikado“, „Spreeathen“, „Hochzeitsreise“, „Hinter den Coulissen“, „Marine“ – Allers diente als strammer Einjähriger bei der Marine – „Capri“, „Bakschisch“ etc. – und jetzt dieses Prachtwerk „Fürst von Bismarck in Friedrichsruh“!
Allers hat übrigens keineswegs, wie manche annehmen, ohne ernste Lehrjahre, sozusagen spielend seine jetzige Höhe erklommen; nachdem er eine Zeit lang Lithograph und Photograph gewesen war, trieb er bei Professor Keller in Karlsruhe eifrige Studien und hat zu dessen talentvollsten Schülern gehört.
Nach echter Malerart liebt er es, die Welt zu durchstreifen, ohne daß es ihm dabei an Sinn für die Häuslichkeit fehlt; dafür spricht sein Haus in Karlsruhe, seine alte Burg „Hohenklingen“ am Rhein und seine Villa auf der Insel Capri, die er sich an der Punta Tragara, also auf einem der herrlichsten Punkte der göttlichen Insel, erbaut hat, hoch über dem tosenden Meere, mit dem Ausblick nach Süden, über die weiten tiefblauen Wasser, zwischen Weingerank, Orangen, Oliven und Feigen. Hier mag es sich gut ruhen! Ruhen? „Hier mag es sich gut arbeiten!“ so muß es heißen, denn ohne Arbeit ist für Allers kein Leben. Mögen ihm dort mit den Seinigen noch viele schöne Tage beschieden sein, und möge er uns und der Nachwelt noch manches Prachtwerk seines Meisterstiftes schenken! Ich weiß noch um verschiedene Pläne, mit denen sich der Unermüdliche trägt, bin aber zu verschwiegen, sie auszuplaudern.
Beseitigung lästiger Haare.
Die Natur hat den Haarschmuck gar ungleich unter die Menschen vertheilt. Der eine verdeckt seine Blöße mit der Perücke, der andere kauft Bartwuchspomaden, die bekanntlich nur den Beutel erleichtern, ein dritter reißt sich in voller Verzweiflung die Barthaare aus.
Es gab und giebt auf der Welt außerordentliche Bärte, ellenlange Bärte, sie brachten aber den Besitzern nicht immer Glück und Segen. Hans Steininger, Bürgermeister zu Braunau, kam ja anno 1572 durch seinen bis auf den Erdboden reichenden Bart ums Leben, da er ihn beim Besteigen des Pferdes in den Steigbügel verwickelte und dadurch zu Falle kam. Außergewöhnlich sind jedoch nicht bloß solche Riesenbärte, außergewöhnlich sind auch kurze Bärtchen, wenn sie ein Frauenantlitz – schmücken. Sorgsame Raritätenforscher haben eine ganze Reihe von Bildnissen bärtiger Frauen aus verschiedenen Zeiten gesammelt, und wenn man den Spezialärzten Glauben schenken darf, so soll der Frauenbart eigentlich kein so seltenes Vorkommniß sein. Nur wird er nicht stolz zur Schau getragen, sondern im stillen Kämmerlein in seinem Wachsthum unterdrückt, sobald er sich vorwitzig über die Hautoberfläche hinauswagt.
Dieselben Erfahrungen wie die Aerzte machen auch die Redakteure der Familien- und Frauenblätter, auf deren Tischen sich nicht selten zierlich geschriebene anonyme Briefchen einfinden, in denen höflich und dringend gebeten wird, im Briefkasten unter „Treue Abonnentin“ ein Mittel anzugeben, das den Haarwuchs gründlich und ein für alle Mal beseitigt.
Bis vor wenigen Jahren waren Aerzte und Redakteure in der schlimmen Lage, erklären zu müssen, daß sie nicht zu helfen vermöchten; man konnte das Haar nicht nach Belieben auf kahlen Stellen wachsen lassen und an behaarten es nicht gründlich vertilgen.
Da das Rasieren die Spuren nicht vollständig genug entfernt, hat man seit uralten Zeiten verschiedene „Depilatorien“, Enthaarungsmittel, ersonnen: aus ätzenden Stoffen bereitete Pasten, welche auf die zu enthaarenden Stellen gestrichen werden. Je nach der Zusammensetzung der Masse läßt man dieselbe 3 bis 8 Minuten auf der Haut liegen; in dieser Zeit werden die Haare völlig erweicht, so daß sie sammt der Paste mit lauem Wasser abgewaschen werden können. Die enthaarte Stelle erscheint rein und glatt, manchmal auch geröthet und empfindlich, die Grübchen der Haarbälge heben sich als braune und schwarze Punkte ab, ein „Fehler“, der leicht durch Puder verdeckt werden kann. Die Haare sind auf solche Weise tief in die Haut hinein zerstört, allein die Haarpapille bleibt erhalten, und so erneuert sich das Haar mit der Zeit, aber es wächst so langsam nach, daß die Vertilgung nur alle zwei bis vier Wochen vorgenommen zu werden braucht.
[786] Bekanntlich enthalten manche dieser Depilatorien, wie das orientalische Rusma, das giftige Schwefelarsen, von ihrem Gebrauch ist daher dringend abzurathen.
Ein anderes Mittel besteht darin, daß man die Haare vermittelst einer Haarpincette oder – klebender Pechflaster ausreißt. Doch sogar das mit Schmerzen ausgerissene Haar wächst nach einiger Zeit nach.
Erst der Neuzeit blieb es vorbehalten, ein Mittel zur dauernden Entfernung lästigen Haarwuchses zu erfinden, das bei seiner Anwendung keine Narben zurückläßt. Allerdings geschah die Erfindung zuerst nicht in der Absicht, das schöne Geschlecht schöner zu machen, sondern um den Menschen in einem ernsten Leiden zu helfen.
Die Wimperhaare pflegen mitunter in fehlerhafter Richtung zu wachsen, sie üben dann einen fortwährenden Reiz auf das Auge aus, führen zu Augenentzündungen und selbst zu Verletzungen der Hornhaut, die für das Augenlicht gefährlich werden können. Reißt man ein solches Wimperhaar aus, so wächst es von neuem und ruft wieder die alten Beschwerden hervor. Die Aerzte waren darum von jeher bemüht, die Wimperhaare, wo es anging, durch Operationen in eine richtige Lage zu bringen oder auch sie dauernd zu beseitigen durch Zerstörung der Haarpapille. Das war auf verschiedene Art möglich, allein nach den Eingriffen blieb stets eine lästige Narbe zurück. Da wandte Dr. Michel in St. Louis im Jahre 1879 die Elektrolyse zuerst und mit Erfolg zur dauernden Beseitigung fehlerhaft gewachsener Wimperhaare an. Die Methode wurde zunächst unter den Augenärzten bekannt, nach und nach aber fand man heraus, daß sie sich ebenso dazu eigne, andere Haare, die an unrechtem Ort sich hervorwagten, zu entfernen, da bei ihrer Anwendung keine Narben an den enthaarten Stellen entstehen.
Die Elektrolyse, die man in Amerika, Deutschland und Frankreich mit Erfolg benutzt, wird derart ausgeführt, daß man den konstanten elektrischen Strom vermittelst einer Nadel auf die Haarpapille einwirken läßt. Der Strom ruft in den Geweben unter Entwicklung von Wasserstoff eine chemische Zersetzung hervor, durch welche die Haarpapille zerstört und das Haar ein für allemal beseitigt wird, so daß es nicht mehr nachwachsen kann.
Die Operation selbst geschieht in folgender Weise. Vor uns steht eine galvanische Batterie, die Patientin hält das mit dem positiven Pol verbundene Drahtende in der Hand, am Drahte des negativen Pols ist eine Stahlnadel befestigt. Der Operateur tritt vor die Patientin, in der linken Hand eine Haarpincette, mit welcher er das zu beseitigende Haar erfaßt und ein wenig vorzieht. In der rechten Hand hält er die Nadel, die er dicht am Haare in die Haut einsticht, bis er die Haarpapille erreicht hat. Dann wird der elektrische Strom geschlossen, und man läßt ihn etwa 15 bis 20 Sekunden einwirken. Nachdem die Nadel herausgezogen worden ist, wird das Haar mit der Pincette herausgehoben. Ist die Haarpapille wirklich zerstört, also die Operation gelungen, so läßt sich das Haar ohne merklichen Kraftaufwand leicht entfernen. Sitzt es noch fest, so ist das ein Zeichen, daß die Haarpapille nicht erreicht wurde und die Operation noch einmal vorgenommen werden muß. Die Sache ist natürlich nicht schmerzlos und nicht eben bequem. Die Operation ist eine langwierige, denn es können in einer Sitzung nur verhältnißmäßig wenig Haare, etwa 20 bis 30, beseitigt werden. Die Hand des Operateurs ermüdet und auch sein Geist wird bei dieser Arbeit abgespannt, andererseits wollen die Patientinnen meist zunächst das Schwinden der unausbleiblichen Hautröthung abwarten, bevor sie sich weiter operieren lassen.
Die dauernde Beseitigung der Haare auf elektrolytischem Wege ist somit nicht so einfach, sie erfordert Geschick und Geduld, ist eine Miniaturarbeit in vollem Sinne des Wortes. Sie erfordert auch so viel Sachkenntniß, daß sie nur vom Spezialarzte ausgeführt werden kann. C. F.
Alle Rechte vorbehalten.
Gretchens Liebhaber.
(Schluß.)
Die Zeit rieselte hernieder über Anton Rövers Vergangenheit, gleichmäßig, Tag um Tag, Woche um Woche, sein Leid wie seine Liebe vergrabend und verschüttend unter ihrer grauen Asche. Es ward ruhig in ihm, und er hütete sich wohl, an die verhüllende Decke zu rühren. Er mied Gretchens Wege, und sie kreuzte die seinigen nicht. So vergingen fast zwei Jahre, bevor er sie wiedersah.
An einem Sonntag gegen Dunkelwerden war es, auf dem Schützenplatz, wo ein Ballfest stattfand. Begleitet von Mutter und Bruder schritt sie selbstbewußt einher, im knappen hellen Kleide, und die Augen der Burschen folgten ihr, wo sie vorüberging. Auch Anton Röver sah ihr nach, in düsteres Sinnen verloren. Wußte sie um das Verbrechen ihres Bruders? – Er hatte während der zwei letzten Jahre in seinem Beruf soviel Verderbtheit kennengelernt, seine Meinung von den Menschen war so herabgedrückt worden, daß er, vollends in dem nie ganz überwundenen Groll, der sein Herz gegen Grete erfüllte, ihr Wissen um das Verbrechen des Bruders für wohl möglich hielt. Konnte die ganze Sache nicht ein abgekartetes Spiel zwischen ihr und dem geliebten Bruder sein – sie rief ihn ans Telephon und gab die Gelegenheit, er nützte dieselbe! Den Kassierer hatte sie immer gehaßt – was kümmerte es sie, daß er das Opfer wurde?
In einem der vornehmsten Schützenzelte, zu dem nur eingeladene Gäste Zutritt hatten, verschwanden die Drei; Röver ging ihnen nach und stellte sich an den Eingang des hellerleuchteten Raumes. Mit finsteren Blicken beobachtete er das Geschwisterpaar, aber so sehr er sich sträubte, sich einen weichherzigen Thoren schalt – sein Argwohn auch gegen die Schwester wollte nicht stand halten. Geradezu erquickend berührte ihn die gute trotzige Ehrlichkeit in Gretens Mienen, das kernhafte Selbstbewußtsein in der Haltung ihres Köpfchens, in den raschen knappen Bewegungen, der bestimmten Sprache. Nein, sie war keines Betruges fähig – sie konnte unmöglich auch nur Nachsicht üben gegen ein Verbrechen, sie, die jede Nachsicht für sich zurückzuweisen schien.
Und vor dieser Erkenntniß fühlte er seinen Haß gegen sie hinschmelzen in heißem Mitleid. Welche Qual, wenn sie des Bruders Schuld und Schande erfuhr – sie mit ihrem unbestechlichen Rechtsgefühl; wenn sie erfuhr, wie tief sie selbst sich an einem Unschuldigen versündigt hatte!
In diesem Augenblick wandte sich Grete mit einer raschen Bewegung dem Eingang zu, und ihre Blicke begegneten für eine Sekunde denjenigen Rövers, der im Bemühen, ihre Gestalt nicht aus den Augen zu verlieren, weiter vorgetreten war. Zusammenzuckend wandte sich Grete zu ihrem Bruder, der eben auf sie zukam.
„Sieh doch, Julius, der Röver! Der untersteht sich, hierher zu kommen!“
„O, der darf jetzt überall hinkommen, von Amtswegen. Er gehört zur geheimen Polizei.“
„Zur Polizei? Das ist hübsch! Erst selbst betrügen, dann andere ans Messer liefern!“
Es war Julius nicht angenehm, an Röver erinnert zu werden. aber er unterdrückte sein Unbehagen. „Wie hart Du wieder urtheilst, Schwesterchen! Bedenke doch die Macht der Versuchung und daß nicht jeder sich eines Vaters und einer Mutter rühmen darf, wie sie uns beiden geworden sind.“
Er sagte das mit leiser Stimme – er redete jetzt immer leise – aber doch so laut, daß Frau Meermann, die breit und kerzengerade hinter ihnen auf einem Stuhle saß, den letzten Satz hören konnte, und der Weihrauch zog ihr gar lieblich in die Nase, obgleich sie sich nichts merken ließ.
Das Verhältniß zwischen ihr und Julius war seit einiger Zeit besonders innig geworden. Ihr Sohn wuchs sich aber auch täglich mehr zu einem Mustermenschen aus. Hatte er vordem leichtsinnig ausgeplappert, was ihm die Seele bewegte, so wurden nunmehr seine Reden, sein ganzes Wesen von Tag zu Tag gesetzter und überlegter, der Inhalt dessen, was er sagte, immer mehr der Ausdruck eines edlen vortrefflichen Gemüths.
So schien es wenigstens der Mutter. Wenn sie aber in die Brust dieses „Mustersohnes“, wie sie ihn nannte, hätte schauen können, sie würde sich entsetzt haben vor der berechnenden Verderbtheit, die hier wohnte. Julius Meermann sagte sich, um sich dauernd zu sichern, müsse er vor den Augen der Menschen dastehen als einer, dem man „das“ auch nicht im entferntesten zutraute. „Das“! Es war ihm nichts bewiesen, er hatte nicht einmal in Verdacht gestanden; es war Gras über die Geschichte gewachsen, die Menschen dachten an anderes; zwischen ihm und Habermann rauschte das Weltmeer, er selbst war ein strebsamer, junger Kaufmann, der Liebling seines Chefs, das angestaunte und beneidete Vorbild seiner Freunde. Dennoch war „das“ nicht gestorben, nicht einmal eingeschlummert, vielmehr unheimlich lebendig. Es saß ihm im Herzen und grub und bohrte, es schaute ihm über die Schulter höhnisch in seine Bücher, es war sein unzertrennlicher Gefährte bei Tag und Nacht. Langsam wühlend, hatte es ihn von Innen heraus umgemodelt, einen völlig anderen Menschen aus ihm gemacht. Und nun kam er sich vor wie eine Doppelexistenz, ihm war, als stecke sein eigentliches Ich mit dem [787] angstvollen schuldbewußten, aber heiß und begehrlich schlagenden Herzen in dem fremden kalten gemessenen Menschen, den er vor der Welt spielte, wie in einer steinernen Hülle, welche enger und enger wurde von Tag zu Tag und ihm Athem und Leben zu nehmen drohte. Und eine furchtbare Bangigkeit packte sein bedrängtes Selbst, es mußte sich Luft schaffen, sich den Beweis liefern, daß es noch lebe, und weil ihm dafür neben dem neuerstandenen Julius Meermann am Tage kein Raum blieb, so wählte es die Nacht, sich auszurasen. Ein gefährliches Rasen! Habermann zwar war über der See, aber Julius fand mit Erstaunen, daß die Habermanns nur so aus den Pflastersteinen aufschossen und daß seine wilde Laune ihn wieder genau in dieselbe gefährliche Lage brachte, aus der jene That der Verzweiflung ihn einst hatte retten müssen. Sorgfältiger noch als vor zwei Jahren verhüllte er dieses nächtliche Treiben. Grete wurde nicht mehr in Anspruch genommen, um die knarrende Thür seiner Kammer einzuölen. Der Nothausgang, den er früher nur ein paar Mal zum Scherz benutzt hatte, war sein gewöhnlicher Weg geworden, durch den er zur Nachtzeit aus und ein ging. Das Licht auf seinem Schreibtisch brannte derweil hell, und wenn Mutter oder Schwester, aus dem Schlaf aufwachend, ihre Augen rieben, sahen sie das erleuchtete Viereck seines Fensters über den Hof schimmern und waren voll Bewunderung für die Arbeitskraft und Arbeitslust ihres Lieblings und höchstes in Sorge, daß der unermüdlich Thätige sich zu viel zumuthe. Frau Meermann machte dem Sohne auch ab und zu gelinde Vorstellungen über sein langes Aufsitzen, besonders wenn die Schatten unter seinen Augen einmal wieder ungewöhnlich tief wurden, aber Julius lächelte nur ablehnend dazu.
„Man muß seine Schuldigkeit thun, Mutter, so gut man kann. Haben der Vater und Du mir nicht das Beispiel gegeben? Mein Prinzipal rechnet auf mich, ich darf sein Vertrauen nicht täuschen.“
Und Frau Meermann trug den Kopf noch einmal so hoch nach solch stolz bescheidener Antwort; im geheimen betete sie den Sohn an. Ihr Mann hatte ja auch seine Schuldigkeit gethan, gewiß – aber prunklos, nüchtern, platt, als etwas, über das zu reden sich nicht lohnt, weil es sich von selbst versteht; ja er hatte sogar einen unüberwindlichen Widerwillen bekundet gegen alle schön klingenden Redensarten. Es war aber doch etwas Hübsches und Einnehmendes um weise Worte, das sah Frau Meermann jetzt mit steigender Bewunderung an ihrem Sohne. –
Von der Stadt hallte zum Schützenplatz herüber der Schlag der Mitternachtsstunde. Julius, der sich in dem „spießbürgerlichen“ Zelt grausam langweilte und seine Nacht gern lustiger beschlossen hätte, zog mahnend die Uhr hervor. „Es wird hohe Zeit, Mutter,“ sprach er sanft, doch mit der Miene eines Paschas, der gar nicht daran denkt, daß jemand ihm widersprechen könne.
Die Mutter widersprach auch nicht, obgleich ihre Tochter den ganzen Abend und eben jetzt wieder auffallend von einem jungen Kaufmann ausgezeichnet worden war, welcher Inhaber eines flotten Geschäfts und deshalb bei den Müttern heirathsfähiger Töchter wohl gelitten war. Allein Grete in ihrer raschen Weise fuhr dazwischen.
„Heimgehen? Jetzt schon? Ich denk’ nicht dran!“
Auf diesen „unschönen“ Ausbruch antwortete Julius nicht; er redete weiter zur Mutter, ebenso leise, ebenso gemessen wie zuvor und ohne jedes Zeichen von Ungeduld. „Ich halte es doch für besser, aufzubrechen, Mutter. Bis jetzt war das Fest durchaus hübsch. Später möchte ich hier keine Verantwortlichkeit mehr meiner Mutter und Schwester gegenüber übernehmen.“
„Hast recht, Julius! Alle Freude muß Maß und Ziel haben – also mach’ Dich fertig, Grete, hörst Du?“
Grete rüstete sich nur langsam und verdrossen zum Heimgehen; sie hätte gar zu gern noch eine Weile getanzt, wenn auch nur, um diesem frechen Menschen, dem Röver, der schon seit mehr als einer Stunde wieder am Eingang des Zeltes stand und sie mit seinem unheimlichen Blicke anstarrte, zeigen zu können, daß seine Gegenwart nicht imstande sei, ihr das Vergnügen zu verderben.
Als sie dann zu Hause ihren Feststaat abgelegt hatte und ihr Lager in der Kammer ihrer Mutter aufsuchte, zog Frau Meermann sachte die Gardine von den Scheiben zurück und deutete hinüber nach dem hell erleuchteten Fenster des Sohnes.
„Siehst Du, Grete, er arbeitet wieder, der brave Junge! Sein Pflichtgefühl hat ihn heimgetrieben. Wie selbstsüchtig würde es von uns gewesen sein, hätten wir noch mehr von seiner kostbaren Zeit für unser Vergnügen beanspruchen wollen.“
Und Grete schämte sich ehrlich.
Julius Meermann aber arbeitete wirklich während dieser Nacht, allerdings nicht in seiner Kammer, sondern auf dem Festplatz der Schützengilde; auch nicht an einer kaufmännischen Unternehmung, sondern an seinem Unglück und an der Schande der Seinigen. Es ward eine verhängnißvolle Nacht für ihn, er verlor im Spiele eine bedeutende Summe, die innerhalb einiger Tage beglichen werden mußte – und er beglich sie auf dieselbe Weise, wie er in letzter Zeit auch für manche andere dringende Fälle Rath geschafft hatte. Die Sache machte sich wirklich ganz einfach – ihn selbst nahm’s wunder, wie viel leichter als das erste Mal ihm jetzt der Schritt über das Gesetz hinaus wurde. – –
Etwa eine Woche nach dem Schützenfest kam Julius schon vor der Mittagszeit nach Hause.
„Grete, thu’ mir die Liebe und packe meinen Koffer! Ich habe noch einige Gänge vor.“ Er war sehr blaß, seine Augen brannten wie im Fieber.
„Willst Du denn verreisen?“ fragte Frau Meermann.
„Ja, in Geschäftssachen. Mein Prinzipal schickt mich. Wie gesagt, ich habe nicht einen Augenblick zu verlieren.“
Und dann zögerte er doch auf der Schwelle und wandte seine heißen Blicke zurück auf das Stübchen mit seiner behaglichen Wohlhabenheit, auf die Kuckucksuhr, die einst des Knaben Freude gewesen war, auf das dunkelbraune Spind, in dem die Honigkuchenvorräthe der Mutter verwahrt wurden, auf das schwarze Ledersofa, auf dem der Vater abends sein Pfeifchen geraucht und seinen Jungen auf den Knien geschaukelt hatte. Zuletzt, am längsten, hafteten seine Augen auf dem Antlitz der Matrone, die in dem Urvätersessel Platz genommen hatte, zwischen dessen weitgeschweiften Backenlehnen der alte Meermann einst zu einer besseren Welt hinübergeschummert war, und ein eigenthümliches Schlucken zerschnitt dem Scheidenden die Rede. „Ich – ich habe noch nicht gefragt, Mutter – wie geht’s Dir heute?“
Seit einiger Zeit litt Frau Meermann an Gicht, und der Arzt fürchtete, daß sie völlig lahm werden könne, aber sie ertrug diese Aussicht mit Spartanermuth. „Meine Kinder werden meine Krücke sein,“ sagte sie denen, die sie bemitleideten.
„Wie immer, wie immer,“ erwiderte sie auch jetzt wohlgemuth. „Mach Dir keine Sorge um meinetwillen, mein Junge! Ich bin alt, habe mein Theil in der Welt geschafft und genossen und darf mich getrost in diesen Winkel da setzen, wenn meine Füße einmal nicht mehr mit wollen. Aber Du bist jung und sollst noch viel beschicken in der Welt. Und mir scheint, Du siehst angegriffener aus als seit langer Zeit. Du mußt Dich besser schonen lernen!“
Bewegt ergriff Julius die Hand seiner Mutter. „Mir geht’s gut, ganz gut,“ sagte er gepreßt. „Ich bin stark, und wenn ich wiederkomme –“ Plötzlich fiel er der Greisin um den Hals und küßte sie, wie er es seit seiner Kindheit nicht mehr gethan hatte. „Werde gesund, Mutter, ganz gesund und kräftig – damit Du keiner Stütze mehr bedarfst!“
Frau Meermann wischte verwundert einen heißen Tropfen von ihrer Wange, der aus des Sohnes Augen darauf gefallen war, und sagte zu Grete, als Julius hastig hinausgeeilt war: „Er hat sich ernstlich übernommen – der arme Schelm ist ganz nervös. Ich werde wahrhaftig, wenn er wiederkommt, mit dem Arzte reden müssen.“
Wenn er wiederkommt! –
Grete ging in des Bruders Kammer, nahm den Koffer vom Brett und füllte ihn sorgsam und flink. Erst das Leinenzeug, dann die Stiefel, die Hausschuhe, den feinen Sonntagsrock, den Frack für alle Fälle, die Handschuhe, das Kursbuch oben auf; nun noch Plaid und Schirm. War das alles? – Er sah nicht gut aus, der Bruder, die Mutter hatte recht. Und wie überreizt er war! Aufgeregt bis zu Thränen über eine Trennung von Tagen! Es mußte etwas für seine Gesundheit geschehen. Als Knabe hatte er einmal in ähnlicher Weise gekränkelt, damals waren ihm vom Arzte Chinintropfen zur Stärkung verordnet worden mit gutem Erfolg. Seitdem bewahrte er beständig ein [788] Fläschchen mit diesen Tropfen in seinem Schreibtisch auf, sie nach Bedarf einzunehmen, manchmal täglich, dann wieder in monatelangen Zwischenräumen. Diese Arznei, wenn er noch davon besaß, wollte sie ihm in den Koffer legen. Sein Schreibtisch war verschlossen; aber sie wußte, der Schlüssel hing im Kleiderschrank; richtig, da war er! Sie öffnete eine Schublade nach der anderen, das Fläschchen fand sich nicht. Doch vielleicht stand es in dem geheimen Fache, das sich hinter einer der Laden befand. Grete kannte es wohl, es war in ihrer Kindheit immer ihre Hauptfreude gewesen, wenn sie es, auf dem Schoße des Vaters sitzend, hatte öffnen dürfen. Mit ihren kleinen Händchen hatte sie dann nach der Feder getastet und aufgejauchzt, wenn auf einen leichten Druck die Klappe emporschnellte. Sie kannte die Stelle der Feder noch genau – ein Druck, und die Klappe sprang auf. Sie griff in das Fach. Kein Fläschchen! Nur ein zusammengelegtes Papier lag drin. Neugierig zog sie es hervor ... am Ende gar ein Liebesbrief, und der Duckmäuser von Bruder that immer, als sei sein Herz unverwundbar! Nun, diesmal wollte sie ihm schon auf seine Schliche kommen! Aber das war ja gar kein Brief, sondern ein Blatt mit Zahlen, eine Berechnung – das war ... Sie stieß einen gellen Schrei aus und fiel vor dem Schreibtisch auf die Knie, das Blatt in der Hand. Ob sie es kannte, dieses Blatt mit Rövers Handschrift, obgleich sie es nie mit Augen gesehen hatte! Mit eifriger Spannung war sie seinerzeit dem Prozeß gegen den Kassierer gefolgt, sie und ihre Freundinnen. Einige von ihnen pflegten den Gerichtssitzungen beizuwohnen. Er hatte es oft und genau beschrieben in seiner Vertheidigung, der Unglückselige! Das war die Form des Papiers gewesen, das hatte darauf gestanden, so lautete die Berechnung, so die Summe – o, sie kannte es! Und nun lag es im Geheimfach ihres eigenen Bruders!
Ein wilder Ruf schreckte sie aus ihrer Betäubung. Julius stand auf der Schwelle, aschfahl, mit weit aufgerissenen Augen.
„Was – was geht hier vor?“
„Schließ’ die Thür!“ herrschte Grete ihn an und richtete sich langsam vom Boden auf. Dann, vor ihn hintretend, hielt sie ihm das Blatt vor die Augen.
„Kennst Du dies?“
„Dies?“ Er taumelte zurück. „Wie kommt dies in Deine Hand? Wie kannst Du Dich unterstehen –“
Und wüthend haschte er nach ihrem Arm, um ihr das Blatt zu entreißen, aber sie stieß ihn zurück.
„Dieb!“
Es war das Wort, das sein Gewissen ihm wiederholt hatte Tag und Nacht, das nun zum ersten Male eine Menschenstimme ihm ins Gesicht schleuderte, und vor seinem Klang ließ er die Maske fallen, die er bis zur Stunde zur Schau getragen hatte. Er sank auf den Stuhl vor dem Schreibtisch, schlug beide Hände vor sein Gesicht und weinte.
Ihre Hand, die das verhängnißvolle Papier hielt, sank schlaff herab, ihre ganze Gestalt bebte.
„Julius,“ begann sie tonlos, „sag’ nur ein Wort, daß es nicht wahr ist, daß Du trotzdem unschuldig bist. Julius,“ schrie sie auf, „sag’ mir, daß Du das nicht gethan hast!“
Er aber senkte den Kopf noch tiefer. „Ich hab’s gethan, Grete. Ich bin ein schwacher, schlechter Mensch! Die Versuchung war zu mächtig – wenn Du wüßtest – wenn ich Dir sagen könnte –“
Mit schneidender Verachtung unterbrach sie ihn. „Hast’s gethan und konntest dulden, daß der andere, daß Dein Freund zu Grunde gerichtet wurde durch Deine Schuld?! Hast es mit angesehen und hast dazu geschwiegen?!“
„Ich hab’s ja nicht gewollt! Bei allem was mir heilig ist, ich hab’ das nicht gewollt! Es hat mich nachher genug gequält, daß ich in der Eile die Zeitung mit seinem Namen unterschoben habe. Ich hatte gemeint, sie sollten die Post verantwortlich machen, und es würde nie herauskommen. Für so schlecht wirst Du mich doch nicht halten, daß ich diesen Ausgang beabsichtigt hätte! Und glaub’ mir, wenn er elend geworden ist – ich bin zehnmal elender! So elend, daß es schier eine Wohlthat für mich ist, endlich einem Menschen – Dir, Grete, sagen zu können, was ich leide, wie grenzenlos ich mich verachte. Und wenn ich mich nicht entschließen konnte, den Zeugen da zu vernichten, so ist’s, weil mir davor graute, an diese Vergangenheit zu rühren.“
Grete war hart wie Stein seinem Jammer gegenüber. „Weißt Du, daß ich Anton Röver grausam beschimpft habe in seinem Unglück? Weißte Du, daß er mir geflucht hat? Und Du, Du warst der Verbrecher! O, schön, schön!“ Und in sinnloser Verzweiflung packte sie den Arm des Schluchzenden. „Gieb mir das Wort zurück, das ich zu jenem gesprochen, den Hohn, mit dem ich ihn todlich verwundet! Aber – was denk’ ich an mich, was liegt an mir, an uns! Wer giebt dem Aermsten die Jahre wieder, die ihn durch Schimpf und Schande verbittern mußten, wer seine verlorene Zukunft, auch wenn er von jetzt an gerechtfertigt dasteht?!“
Julius hob horchend den Kopf.
„Gerechtfertigt? Du denkst doch nicht – – Grete, willst Du Deinen Bruder verrathen?“
„Hast Du geglaubt, daß ich mich zu Deiner Mitschuldigen machen werde?“
Er wagte, ihr in die funkelnden Augen zu sehen. „Um unserer Mutter willen –“ stammelte er.
Da rief sie außer sich: „Elender, und er – hat er nicht eine Mutter so gut wie wir?“
Julius sprang empor; angesichts dieser Gefahr, an die er bisher noch gar nicht gedacht hatte, fand er seine Fassung wieder, und eine leise Unentschlossenheit, die er bei der Nennung der Mutter trotz der heftigen Entgegnung auf dem Gesicht der Schwester zu lesen glaubte, gab ihm einen Theil seiner Sicherheit zurück.
„Thu’, was Du glaubst verantworten zu können,“ sagte er entschlossen. Wenn Du Dich verpflichtet fühlst, der Mutter das Herz zu brechen – ich kann Dich nicht daran hindern. Aber mich wirst Du nicht wiedersehen –“
„Was soll diese Andeutung, diese ganze überstürzte Reise?“
Grete erhielt nur einen unsicheren Blick des Bruders zur Antwort. Und plötzlich begriff sie – o, sie begriff jetzt wunderbar gut. „Julius! Du hast abermals gestohlen!?“
Ich kann’s nicht leugnen,“ sagte er trotzig, „ein paar hundert Mark aus des Chefs Kasse, zu der ich den Schlüssel führe. Ich hoffte, sie gestern oder heute ersetzen zu können, aber das Pech im Spiel verfolgt mich ohne Unterlaß. Und er kommt heut’ abend schon heim, zwei Tage früher, als wir angenommen hatten. Er muß die Sache entdecken. So wird’s wohl das Beste sein, ich geh’ übers Meer, und dazu hab’ ich mir noch einiges – Reisegeld genommen. Es ist die letzte Schande, die ich Euch mache,“ fügte er mit einem nervösen Zucken seiner Mundwinkel hinzu.
Sie ergriff mit wilder Hast seinen Arm. Du bleibst! Tausend Mark habe ich auf der Sparkasse. Ich erhebe sie. Du deckst davon die Summe, die Du unterschlagen hast. Dein letztes Verbrechen ist ungeschehen zu machen – um unserer Mutter willen –“
„Grete, Du wolltest ...?“ In dem Augenblick, da er im Begriff stand, mit seiner behaglichen geachteten Existenz zu brechen,
[789][790] in Schande, Gefahr und Elend hinaus zu gehen, in diesem Augenblick bot sich ihm Aussicht auf Rettung! Er sollte in den bequemen Verhältnissen bleiben dürfen, ein angesehener, beneideter Mensch nach wie vor!
„Grete, wie gut Du bist!“
„Ich begehre keinen Dank von Dir,“ erwiderte sie mit eisigem Nachdruck, dem Kuß ausweichend, den er in überströmender Dankbarkeit auf ihre Wange drücken wollte; unwillkürlich strich sie über die Stelle ihres Kleides, welche seine ausgestreckte Hand berührt hatte, als müsse sie da etwas wegwischen.
Er ließ sich dadurch nicht irre machen. „Ich will mich bessern, Grete! Gewiß und wahrhaftig, Dein Opfer wird nicht umsonst gebracht sein. Ich will ein braver rechtschaffener Mensch werden – ich schwöre Dir, das will ich!“
„Kannst Du das?“ fragte das Mädchen schneidend und deutete auf das Blatt in ihrer Hand. „Kannst Du das – nach diesem?!“
„Gieb mir den Zettel, Grete!“
„Nein!“
Er erbleichte. Ein grausamer Zug von Härte lag um ihren zusammengepreßten Mund! „Grete – Du wirst Deine Gutthat an mir nicht selbst zu nichte machen wollen?“
Sie schwieg.
„Grete!“
„Ich weiß nicht, ich verspreche nichts!“
„Thu’ das kleinere menschlichere Unrecht – rette Mutter und Bruder! Was geht Röver Dich an? Ein Fremder, ein Dir verhaßter Mensch!“
„Um so unerträglicher, in seiner Schuld zu stehn, gedemüthigt vor ihm bis in den Staub! Es bringt mich um den Verstand!“ Sie brach in krampfhaftes Schluchzen aus.
Er ließ nicht ab, zu betteln. Einschmeichelnd, überredend klang seine Stimme. „Keine Pflicht der Welt gebietet Dir, Zeugniß abzulegen wider Deinen Bruder. Nicht einmal das Gericht würde Dich zu einer Aussage gegen mich zwingen. Denk’ an unsere Kindheit, Grete, an unsere brave rechtschaffene Mutter! Du brauchst ja nicht zu lügen und zu heucheln, nur zu schweigen. Grete, nicht wahr, Du wirst schweigen?“
„Ich will’s versuchen – sage der Mutter irgend einen Grund, warum Deine Reise unterbleibt!“ Die Worte rangen sich mühsam los von ihren Lippen und fielen wie eine Centnerlast auf ihr Gewissen. Schwankend ging sie zur Thür, ungeduldig die Zärtlichkeiten abwehrend, mit denen der Bruder sie zu überschütten suchte. –
Es war eine qualvolle Zeit, die jetzt für Grete begann. Sie hatte den verhängnißvollen Zettel in ihrer Kommode verborgen. So oft sie nun die Lade aufzog, war es ihr, als schauten daraus zwei dunkle Augen, die sie nur zu gut kannte, vorwurfsvoll drohend zu ihr auf. Sie versteckte das Papier in den fernsten Winkel ihres Kleiderschrankes, zuletzt verschloß sie es in ein Kästchen – es half nichts; ein unheimliches Leben steckte in dem Blatt; auch durch die Wände des Schrankes schien es zu schimmern, und die schwarzen vorwurfsvollen Augen verfolgten sie bis in den Traum. Wachend und schlafend schleppte sie das Bewußtsein ihrer unfreiwilligen Schuld mit sich herum.
Diese Schuld hatte schon des Bruders Wesen verwandelt, jetzt verwandelte sie auch das der Schwester.
Der Mutter fiel’s auf, wie still und gedrückt ihre fröhliche Grete einherging; die Freundinnen wunderten sich, wie allmählich der stolz zurückgeworfene Kopf herabsank auf die Brust, und dem braven Julius, der seit seiner unverhofften Errettung sich in rosigster Stimmung befand, lief’s eiskalt über den Rücken, so oft er inmitten seiner scheinheiligen Reden dem Blicke der Schwester begegnete. Er fand es bald noch ungemüthlicher daheim als früher und nach einer Enthaltsamkeit von vierzehn Tagen fing er von neuem an, bei seinen alten Freunden Zerstreuung und Betäubung zu suchen.
Grete aber hatte den gesunden Schlaf der Jugend verloren. So oft sie nachts müde auf ihr Lager sank, schauten durch die Dunkelheit Anton Rövers Augen sie an, wie sie sie angeschaut hatten an jenem Tag, als man ihn verhaftete. Und ein Dämon wiederholte ihr jedes Wort, das sie damals zu ihm gesprochen hatte, immerfort, immerzu. „Mengen Sie meines Bruders ehrlichen Namen nicht in Ihre unsauberen Häbdel!“ – „Nicht lächerlich, nein verächtlich macht die Zuneigung eines Betrügers!“ Da war kein Wort vergessen, keines gemildert, und immer von vorne fing die Stimme an, in entsetzlicher Einförmigkeit. Es konnte so nicht dauern – sie mußte Befreiung suchen von dem Bann, in den des Bruders That sie geschlagen hatte. Aber was sollte sie thun? Die Ehre, die der Bruder Röver genommen hatte, konnte, durfte sie dem Beraubten nicht zurückgeben! Aber vielleicht ließ sich gut machen, was sie persönlich gegen ihn gefehlt hatte? Sie war dazu bereit, ernstlich und ohne Bedingung! Ihren Besitz, ihre Arbeit, ihre Person – sie würde klaglos alles hingegeben haben zur Tilgung dieser Schuld. Das erste war – sie mußte ihm ihre Grausamkeit abbitten, ihn anflehen um Verzeihung! Vielleicht daß dann diese furchtbare Spannung von ihr wich.
Wenn sie nun abends aus dem Geschäft heimkehrte, legte sie es darauf an, Röver zu begegnen; sie machte häufig einen Umweg durch die Straße, in der er wohnte, und nach einigen fruchtlosen Vers[uc]hen gelang ihre Absicht – aber er sah sie nicht oder wollte sie nicht sehen. Am nächsten Tage wiederholte sie den Versuch um dieselbe Zeit. Diesmal ging sie dicht an ihm vorüber, sie streifte ihn fast, allein sein Blick blieb starr geradeaus gerichtet. Nun blieb kein Zweifel mehr – er wollte sie nicht bemerken. Sie hätte sich’s denken können – er behandelte sie, wie sie es verdiente. Aber Frieden – wie sollte sie Frieden finden!
Und von plötzlicher Eingebung geleitet, kehrte sie um und schlich dem Heimkehrenden nach auf den Hof, auf den die Fenster seiner Wohnung gingen. Vor einem dieser Fenster stand sie mit klopfendem Herzen still, scheu wie eine Verbrecherin, und suchte durch die Vorhänge in das erleuchtete Zimmer hineinzuspähen. Das eine Rouleau, das schadhaft gewesen und bei der Ausbesserung ein wenig zu kurz gerathen sein mochte, schloß nicht völlig, so konnte sie einen Blick hineinwerfen in die Stube.
Eben trat er ein. Der Hund flog mit Freudengebell an ihm empor, und die alte Frau – wie rasch sie vom Stuhle sich erhob, ihrem Sohn entgegen! Freude leuchtete aus jedem Zuge des kleinen runzligen Gesichtes! Er aber lächelte, als er sich herabbeugte, ihr welkes Antlitz zu küssen, und alles Finstere, Drohende in seinen Mienen löste sich in diesem Lächeln. O, er war ein guter Sohn – diese Züge heuchelten nicht, während daheim . . . Daß sie diesen Vergleich nicht unterdrücken konnte, so weh er ihrem Herzen that!
Warum hatte sie diesen Mann gehaßt, der zehnmal mehr werth war als ihr Brnder! Ueber ihn war das Unglück in seiner schlimmsten Gestalt, waren unverdient Armuth und Schande zugleich hereingebrochen, und sie hatten ihn fest gefunden, unerschütterlich, entschlossen thätig, rücksichtsvoll gegen die Mutter im Leid wie im Glück. Eine heiße Fluth stieg ihr in die Augen und ließ das Zimmer und die Gegenstände darin vor ihrem Blicke verschwimmen. Leute kamen über den Hof. Sie entfloh und kehrte heim, nur noch bedrängter in ihrem Innern. Ihr war die Macht verliehen, diesen beiden Menschen das volle Glück zurückzugeben, den Druck, der auf ihnen lastete, fortzunehmen – und sie durfte diese Macht nicht brauchen, durfte diesen Weg nicht gehen, den einzigen, das fühlte sie, der zugleich ihre eigene Verschuldung gemildert hätte.
Eine verzehrende Sehnsucht ergriff sie, etwas, nur etwas zur Freude und zum Glücke der Heimgesuchten ins Werk setzen zu können. Sie grübelte darüber Tag und Nacht – vergebens! Es gab nur das eine: die Ehre der Ihrigen preisgeben, um sie jenen zurückzubringen. Und das konnte sie nicht! Aber wenn Julius jetzt in seiner glatten schmeichlerischen Weise der Mutter nach dem Munde redete, und diese, stolz wie eine Herrscherin in ihrem Sessel thronend, bewundernd zu dem vergötterten Sohne hinüberschaute und von der Ehrbarkeit und Tüchtigkeit sprach, die sich von den Eltern auf die Kinder vererbe, von den Vergehen der Söhne, in denen sich die Schuld der Väter räche – dann wurde Grete von einer erstickenden Angst gepackt vor der ungeheueren Lüge, zu der ihr und der Ihrigen Leben geworden war. Und eine Besorgung, einen Abendbesuch bei einer Freundin vorschützend, stürzte sie hinaus in den Regen, in das Dunkel, Straße um Straße durchjagend, bis sie sich vor den Fenstern der Röverschen [791] Wohnung wiederfand, um durch die Lücke des Vorhangs hindurch eine strickende alte Frau zu beobachten oder den Bewegungen des Mannes am Schreibtisch zu folgen, angstvoll nach dem Ausdruck größeren oder geringeren Wehs in den Zügen desjenigen zu spähen, der einst seine beiden Hände unter ihre Füße hätte breiten mögen, ohne daß sie ihm nur einen flüchtigen Blick des Dankes dafür gegönnt haben würde. Jetzt lagen Haß und Fluch und Sünde zwischen ihnen, und eine lähmende Angst vor ihm war über sie gekommen.
Längst schon wagte sie nicht mehr, seinen Weg zu kreuzen. So oft sie seine Gestalt von weitem sah, durchrieselte sie ein kalter Schauer. Wenn er wüßte! O, der Blick, mit dem er sie anschauen würde, vor dem sie versinken mußte, wenn er erfuhr, daß sie ihn hätte retten können und keine Hand gerührt habe! So wich sie ihm aus, sorgfältiger noch als zu der Zeit, da seine Neigung sie verfolgt hatte, und doch schien es ihr täglich mehr, als ob der Friede ihrer Seele abhänge von einem versöhnlichen Worte aus seinem Munde.
Eben in dieser Zeit war es, daß der junge Kaufmann, der Gretchen auf dem Schützenfest ausgezeichnet hatte, das nachdenkliche stille Wesen, welches Fräulein Meermann seit kurzem angenommen hatte, auf eine keimende Neigung zu seiner eigenen geschätzten Person deutend, Frack und Cylinder ausbürstete und als ehrbarer Freier die Treppe zu Frau Meermanns Wohnung hinaufstieg. Er wurde von der alten Frau so zuvorkommend aufgenommen wie gute Partien von den Müttern heirathsfähiger Töchter aufgenommen zu werden pflegen; und obwohl noch ohne das Jawort, kehrte er doch ruhig und freudig im Gemüth nach Hause zurück, während Frau Meermann, des Ausgangs der Werbung ebenso sicher wie er, zu ihrer Kommode humpelte und vorsorglich ihr schönstes Taschentuch hervorholte, um gegen die Thränen gewaffnet zu sein, wenn sie der Heimkehrenden das große Glück verkünden würde.
Endlich hallte der feste Schritt ihrer Tochter im Flur. Grete öffnete die Thür und blieb verwundert stehen. So feierlich das Gemach – Julius mit Predigermiene, die Mutter in frischer Haube, das gestickte Taschentuch in der Hand – – „Was giebt es denn hier?“
„Grete, mein gutes Kind, komm zu mir! Laß mich Dich segnen! Der junge Märtens war hier, er hat sich erklärt. Du wirst sehr glücklich werden, mein Kind.“
Das Mädchen stand wie angewurzelt. „Mit – Märtens?“ Wie lange hatte sie an den nicht mehr gedacht; sie erinnerte sich kaum mehr, daß er auf der Welt war!
„Wenn Dein Vater noch lebte,“ fuhr Frau Meermann unbeirrt fort, „er würde Euren Bund segnen, wie ich es thue. Du heirathest in ein solides altbegründetes Geschäft, einen Mann von makellosem Ruf und Charakter.“
„Heirathen? Ich werde Märtens niemals heirathen, Mutter. Ich denke, Du hast ihm keine Hoffnung gemacht.“
„Wie Du daherredest! Freilich hab’ ich ihm Hoffnung gemacht. Hast Du selbst es doch gethan!“
Hatte sie das? Vielleicht – damals, ehe das eine geschah, das jetzt ihr Sein und Denken ganz allein erfüllte!
Frau Meermann begriff nicht, was die Brust ihrer Tochter bewegte, warum diese, statt zu antworten, nur immer wieder stumm den Kopf schüttelte. „Ueberlege doch nur, Grete,“ mahnte sie vorwurfsvoll. „Es ist Dein Lebensglück, das Du von Dir stößt. Nimm Vernunft an, Kind! Du bist so wunderlich in letzter Zeit! Wenn Du einen Mann wie Märtens ausschlägst, auf wen willst Du denn warten?“
„Auf niemand! Verzeih’, Mutter, aber ich hab’ mir’s überlegt, ich werde überhaupt nicht heirathen. Sag’ ihm das, bitte! Er soll mir nicht böse sein, ich erkenne an, daß er’s redlich mit mir meint, und ich danke ihm für die gute Meinung.“
„Liebe Grete,“ kam jetzt Julius, der aus mancherlei Gründen seine Schwester gern verheirathet gesehen hätte, der verblüfften Mutter zu Hilfe, „das sind Mädchenlaunen, die Dir nimmermehr ernst sein können. Wirst doch keine alte Jungfer werden wollen!“
„Ja, das will ich!“ rief sie erregt. „Und ich denke, Du könntest meine Gründe verstehen, gerade Du! Also rede mir nicht drein!“ Und gelassener sich zu ihrer Mutter wendend, die in steigender Verwunderung dem Auftritt lauschte, fuhr sie fort: „Noch einmal, Mutter, ich kann nicht. Ich werde auch meinen Sinn nicht ändern. Sag’ ihm das!“
So mußte denn Frau Meermann, so schwer es ihr wurde, auf die „glänzende Partie“ für ihre Tochter verzichten. Sie ächzte und stöhnte viel dabei. Das gestickte Tüchlein feuchtete sich statt mit den Thränen der Rührung, die ihm zugedacht waren, mit den Schweißtropfen, die auf ihrer Stirn perlten, während sie den langen verbindlichen Absagebrief an Märtens verfaßte. Sie meinte, so sauer sei ihr noch nie eine Arbeit geworden, konnte es auch nicht unterlassen, ein Wörtlein einfließen zu lassen von der Wandelbarkeit der Mädchenherzen und dem besseren Rathe, der über Nacht kommt.
Grete wurde von jetzt an noch stiller und gedrückter, in ihrem Verkehr mit den Ihrigen noch einsilblger als vorher.
An einem regnerischen Mittag, als sie aus dem Geschäft heimkehrte, sah sie Anton Röver vor sich hergehen, den Hut in die Stirn gedrückt, den Blick zu Boden gesenkt, wie das seine Art war. Sie verlangsamte ihren Schritt, um ihm Vorsprung zu lassen, und hatte ihn fast aus dem Gesicht verloren, als sie nahe an einer Straßeukreuzung von Waldmann überholt wurde, der eingesperrt gewesen war und nun, der Haft entronnen, die Nase an der Erde, auf der Spur seines Herrn dahinjagte, so ungestüm vertieft in seine Suche, daß er einem um die Ecke rasselnden Bierwagen gerade in den Weg lief.
Im nächsten Augenblick sah Grete ihn zwischen den Hufen. Ein schmerzliches Aufwinseln – er stürzte, von einem Schlag getroffen; in der nächsten Sekunde mußten die Räder über ihn weggehen. Wie ein körperlicher Schmerz durchzuckte es das Mädchen; auch diese Freude des Vereinsamten sollte verloren sein!
Mit einem Sprunge war sie neben dem Fuhrwerk und schrie den Kutscher an, so laut und befehlend, daß der Mann zusammenfahrend die Zügel an sich riß und das aufbäumende Pferd zum Stehen brachte, gerade noch zeitig genug, um es Grete zu ermöglichen, das blutende Thier unmittelbar vor den Rädern hervorzuziehen. Sie nahm, ohne sich weiter um den Kutscher und das verwunderte Publikum zu kümmern, das sich rasch gesammelt hatte, den winselnden Hund auf ihren Arm und eilte ihrer Wohnung zu.
Der Straßenschmutz, der an Waldmanns Füßen klebte, das Blut, das aus der verwundeten Vorderpfote troff, befleckte ihren hellen Regenmantel – sie beachtete es nicht, so wenig wie das Aufsehen, das sie erregte.
Die Mutter, welche Kartoffeln schälend in der offenen Küchenthür saß, sah sie mit ihrer Last die Treppe heraufkommen und schlug vor Erstaunen die Hände zusammen.
„Lieber Himmel, was für ein Aufzug! Grete, bist Du verrückt geworden? Der schöne Mantel! Was willst Du denn mit dem schmutzigen Köter?“
„Ein Pferd hat ihn geschlagen, um ein Haar wäre er überfahren worden. Er blutet, Mutter, wir müssen ihn verbinden.“
„So, müssen wir das? Ueber meine Schwelle kommt das Vieh nicht,“ rief Frau Meermann zornig. „Ich wohne nicht im Stalle. Was gehen Dich fremder Leute Hunde an? Wirklich, Grete, Du wirst alle Tage wunderlicher. Aber ein bißchen Rücksicht auf mich verlange ich denn doch!“
Grete wandte sich kurz zu Julius um, der an der Küchenthür lehnte, sehr guter Laune, denn in der vorigen Nacht hatte er beträchtlich gewonnen.
„Deinen Zimmerschlüssel, Julius!“
Aber er sträubte sich.
„Es ist Rövers Hund,“ sagte das Mädchen mit bebenden Lippen, und wie elektrisiert von dem Namen eilte Julius davon, um aufzuschließen.
„Du reibst Dich auf, Grete,“ flüsterte er leise der Schwester zu, die dem vierfüßigen Patienten auf des Bruders Bett ein Lager bereitete. „Glaube mir, Du nimmst es zu schwer.“
„Jeder nimmt’s eben, wie er kann. Hol’ eine Schale Wasser!“
Julius gehorchte, und Grete wusch dem Hunde sorglich den Schmutz und das Blut von der Pfote; sie zerriß eines ihrer
[792][793] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [794] Taschentücher zu Streifen, um kalte Umschläge auf die verletzte Stelle zu legen. Es gewährte ihr eine eigene Genugthuung, Waldmann zu pflegen, liebkosend über das glänzend schwarze Fell zu streichen. Seltsame Wendung des Schicksals! Sie hatte Röver selbst hochmüthig von sich gewiesen und mußte es nun als Glück empfinden, daß sie sich seinem Hunde hilfreich erweisen durfte. Sie schleppte dem Verletzten Leckerbissen herbei, von denen er ab und zu etwas nahm; dann rollte er sich auf seinem weichen Lager zusammen und stieß nur von Zeit zu Zeit ein leises Wimmern aus.
Als Grete am Abend nach Schluß des Geschäfts zurückkehrte, fand sie den Hund bedeutend besser. Nachdem sie ihn vom Bette heruntergehoben hatte, fing er sogar an, in der Stube herumzuhumpeln. Und jetzt mußte sie an seinen Herrn denken, der jedenfalls in bekümmerter Sorge um den geliebten Kameraden war. Sie schlug den Hund in ein Tuch, nahm ihn auf den Arm und schlich sich scheu und vorsichtig durch die nächtlichen Straßen zu dem ihr so vertraut gewordenen Hofe. Von ihrem alten Lauscherposten aus sah sie Mutter und Sohn traurig um den Tisch des Wohnzimmers sitzen; Waldmann aber, seine Heimath erkennend, bellte laut auf. Schleunig setzte Grete ihn auf den Boden, denn sie bemerkte, wie sein Herr bei dem bekannten Tone aufsprang und ans Fenster eilte. Und dann entfloh sie, so rasch sie konnte.
Es war hohe Zeit gewesen, daß Waldmann sich wieder einstellte. Frau Röver, die ihren Empfindungen in Gegenwart des Sohnes sonst nicht gern die Zügel schießen ließ, konnte bei diesem neuen Mißgeschick ihre überquellende Bitterkeit nicht zurückhalten.
„Natürlich,“ fing sie an, „so mußte es kommen. Hattest noch eine Freude in der Welt, die konnte einem armen Menschen, wie Du bist, unmöglich bleiben. Irgend einer Deiner ‚guten‘ Bekannten wird sich’s gemerkt haben, wie sehr Du dem Waldmann zugethan bist, und knallt ihn weg oder ersäuft ihn – einer Deiner braven Freunde, die Dich nicht mehr grüßen, wenn sie Dir auf der Straße begegnen, wie der junge Meermann neulich!“
„Mutter, den Julius Meermann grüß’ ich nicht mehr. Und warum soll jemand absichtlich dem Hund ein Leid zugefügt haben? Er kann auch durch ein Ungefähr verunglückt sein. Für uns freilich bleibt’s dasselbe.“
Er war bei den Hundefängern gewesen, auf der Polizei, er hatte eine Anzeige ins Tageblatt aufgegeben – weiter konnte er nichts thun. Er klagte nicht, es war nicht seine Art. Aber er schob sachte das Abendbrot zurück, das seine Mutter ihm hingestellt hatte, und das zum ersten Male seit Jahren Waldmann nicht mit ihm theilen sollte.
„Wir müssen uns in Geduld fassen, Mutter,“ sagte er dabei mit wehmüthigem Lächeln.
Doch die alte Frau erwiderte unwirsch: „Gut, Du, wenn Du’s kannst. Bei mir wird die Ungeduld größer von Tag zu Tag.“
In diesem Augenblick bellte Waldmann vor dem Fenster und gleich nachher an der Hausthüre. Mit einem Sprunge war Anton an der Schwelle, um ihm zu öffnen.
„Da siehst Du’s, Mutter! Da ist er zurück, heil und unverletzt! Nein, nicht ganz. Er ist verwundet. Aber schau’ nur, ein barmherziger Mensch hat ihm die Pfote verbunden. – Still doch, Waldmann! – Ist’s nicht, als wollte er uns sein Abenteuer erzählen? Ja, ich möchte schon, daß Du mir den Namen Deines Wohlthäters nennen könntest, armer Kerl! Und was ist denn das? Trotz des Regens draußen sind ja seine Füße ganz trocken – er muß bis zu unserer Thür getragen worden sein.“
Daraufhin lief Frau Röver eilends hinaus und spähte auf den Hof und die Straße, aber nur der Regen rauschte und eilige Menschen hasteten im Schutze der Regenschirme durch die Nacht.
„Draußen ist niemand,“ berichtete sie kopfschüttelnd. „Wüßt’ auch nicht, wer uns ’was zuliebe thun sollte!“
Anton löste nachdenklich die bunt gemusterte Leinenbinde, die um den Fuß des Hundes gewickelt war – der Theil eines Taschentuches ohne Zweifel; er betrachtete den Streifen nach allen Seiten, ob nicht ein eingezeichnetes Monogramm ihn auf die Spur des unbekannten Freundes leiten konnte. Aber es fand sich nichts.
„Mußt Dir die Bitterkeit nicht über den Kopf wachsen lassen, Mütterchen,“ sagte er dann begütigend und faßte die Hand der alten Frau. „Waldmanns glückliche Wiederkehr nehm’ ich für ein Zeichen von guter Vorbedeutung; wer weiß, ob sich nicht auch das andere früher, als wir denken, zum Guten wendet.“
Frau Röver zuckte stumm die Achseln zu dieser Vertrauensseligkeit. –
Zwei Tage später wurde Röver zu seinem Chef gerufen.
„Es ist gekommen, wie ich Ihnen vorhergesagt habe, Röver. Ihre Ernte reift. Julius Meermann ist dringend verdächtig, Gelder seines Prinzipals unterschlagen zu haben. Wilson und Kompagnie haben selbst die Anzeige erstattet. Verfügen Sie sich sofort in die Wohnung Meermanns und halten Sie Haussuchung. Ist der Mann selbst anwesend, so verhaften Sie ihn. Und halten Sie die Augen offen, vielleicht fällt Ihnen irgend etwas in die Hände, was auf Ihre eigene Angelegenheit Bezug hat. Gehen Sie rücksichtslos vor und seien Sie meiner Unterstützung gewiß!“
Anton Röver wurde erst sehr roth, dann bleich; der Gedanke an Grete schoß blitzschnell durch sein Gehirn. Nun war er da, der erhoffte, ersehnte, durch zwei lange bittere Jahre hindurch ersehnte Augenblick, und doch war seine Empfindung keine freudige.
„Ich – ich soll – ich selbst –“ stammelte er.
Der Kommissar trat auf den Verwirrten zu und legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Muth, Röver! Muth und Umsicht! Halten Sie sich wacker! Es freut mich, daß ich Ihnen diese Genugthuung bereiten kann. Es wird mich freuen, wenn es Ihnen gelingt, den letzten Verdacht von Ihrer Person abzustreifen, obgleich ich fürchte, dadurch einen zuverlässigen Beamten und Mitarbeiter zu verlieren. Denn ich sehe wohl, Sie fühlen sich nicht glücklich in Ihrem neuen Beruf und werden die erste Gelegenheit benutzen, uns den Rücken zu kehren. Doch nun gehen Sie und thun Sie Ihr Bestes!“
In tiefer Erregung verließ Anton Röver das Polizeigebäude. So sehr er entschlossen war, seine Pflicht zu erfüllen, sein eigenes gutes Recht mit Aufbietung aller Kräfte zu verfolgen und womöglich diesen Schurken zu entlarven – das bange Mitleid mit Grete hörte nicht auf, ihn zu foltern. Als er, den Verhaftsbefehl in der Tasche, begleitet von zwei Schutzleuten, die Treppe im Meermannschen Hause emporstieg, schlug ihm das Herz zum Zerspringen. Er klingelte an der Vortür, und Grete erschien, um zu öffnen.
Als sie Röver in Begleitung der Polizisten sah, wurde sie weiß wie die Wand und griff nach dem Thürpfosten, um sich zu halten.
Dem Manne schnürte heißes Mitleid das Herz zusammen, seine Stimme klang fast tonlos und seine düsteren Augen waren feucht, als er sagte:
„Fräulein Meermann, Sie werden entschuldigen – ich komme in einer traurigen Angelegenheit –“
Sie richtete sich gewaltsam auf und warf den Kopf in den Nacken. „Sie kommen in Ihrem Amte, Herr Röver. Thun Sie Ihre Pflicht, wie Sie müssen, nur –“ ihre Lippen zuckten und ihre Zähne schlugen leise aneinander – „nur, wenn Sie können, schonen Sie meine Mutter!“
Röver nickte zustimmend mit dem Kopfe. „Bereiten Sie sie vor! Wir folgen Ihnen auf dem Fuße.“
Am runden Tische in der Stube saß Frau Meermann mit zerrauftem Haare; sie hatte das Gesicht in die Hände vergraben und weinte und schrie. Vor wenigen Minuten war ihr Sohn ins Zimmer gestürzt, blaß, athemlos, mit weit aufgerissenen Augen. „Rettet mich! Rettet mich! Aus Barmherzigkeit – Geld, Geld zur Flucht! Sonst schleppen sie mich ins Zuchthaus!“ Sie hatte erst gar nicht verstanden, hatte gemeint, der Uebereifer in seinem Beruf habe seinen Geist umnachtet, aber Grete hatte entsetzt ausgerufen. „So bist Du wieder zum Diebe geworden?!“
„Wieder!“ – Nun wußte die Mutter, was auf ihrer Tochter gelastet hatte, wie tief ihr Abgott gefallen war; mit einem [795] Schrei war sie in sich zusammengesunken. Aber Grete hatte den Kopf oben behalten - sie war an den Schrank gestürzt, hatte dem Bruder das Geld aus der kleinen Kasse in die Hand gedrückt und ihn in seine Kammer geschoben. „Flieh’ – dort der Gang – – vielleicht ist’s noch möglich, daß Du entkommst! Wo nicht, verbirg Dich darin, bis die Gefahr vorüber ist.“ Julius war in dem düsteren Gange verschwunden, ohne Widerrede, ohne Dank, ohne Abschied, und hinter ihm hatte die Schwester aufathmend die Thüre geschlossen. Dann war draußen die Klingel gezogen worden –
„Mutter, Mutter!“ rief Grete, als sie jetzt der Polizei voraus ins Zimmer stürzte, „sei stark!“
Frau Meermann hob den Kopf, verstört die Tochter anstarrend, und da erschien auch schon Röver mit den Schutzleuten unter der offenen Thür. Die alte Frau brach bei seinem Anblick in ein wildes Lachen aus.
„Sie?! Sie! O, das ist ja schön, daß einer kommt, meinen Sohn fortzuschleppen, welcher selber – ein Dieb den anderen!“
„Mutter!“ fiel Grete ihr tödlich erschrocken ins Wort.
Röver aber that, als sehe und höre er nicht. Er drehte sich um und ertheilte seinen Untergebenen den Befehl zur Haussuchung so laut und rasch, daß seine Stimme die seiner Beleidigerin übertönte.
„Zeigen Sie mir das Zimmer Ihres Bruders!“ wandte er sich dann kurz an Grete.
Sie schritt ihm schweigend voran.
„Ist er zu Hause?“
„Ueberzeugen Sie sich!“
Röver trat in die Kammer – der erste Blick zeigte ihm, daß sie leer war; sein zweiter fiel auf den Schrank dem Eingang gegenüber, und erschrocken fuhr er sich an die Stirn. Daß er das hatte vergessen können - die geheime Treppe! Hastig stürzte er vorwärts. Da sah er Grete zusammenzucken, wanken; ihre Augen begegneten in tödlicher Angst den seinen, ihre Augen, die nicht lügen konnten. Seine Ahnung wurde zur Gewißheit, der Gesuchte mußte durch diesen Gang entflohen sein, wohl erst vor Minuten. Es galt die höchste Eile – – dennoch blieb er stehen wie gebannt. Wenn er die Pflicht preisgab um der Liebe willen, wenn der Beamte sich dessen nicht erinnerte, was dem Menschen bekannt war, wenn er dem geliebten Mädchen, das fast verging vor Angst und Beschämung, das Aeußerste ersparte - wer wollte ihm beweisen, daß er pflichtvergessen gehandelt habe! In seinen Schläfen hämmerte es, seine Pulse flogen.
Einer der Schutzleute erschien in der Thür. „In der Wohnung ist der saubere Vogel nicht, Herr Röver!“
Entschlossen wandte sich Röver nach ihm um; sein innerer Kampf war entschieden. „Durchforschen Sie das ganze Haus vom Keller bis zum Boden, und wenn Sie ihn dann nicht finden, erstatten Sie sofort die Anzeige davon am Bahnhof!“
Grete war’s, als drehe sich die Stube um sie. Was? Er kannte den Gang und schwieg, er ahnte, wußte, daß ihres Bruders Flucht auf diesem Wege erfolgt war, und verrieth ihn nicht! Der Mißhandelte wollte seinen Beleidiger nicht verderben! Er verletzte seine Pflicht, belastete sein Gewissen – für wen? für was? Für einen nichtsnutzigen herzlosen Buben, für eine vor Hochmuth unkluge Frau, für sie, die ihn verachtet, mißhandelt hatte?! Sie wollte es nicht! Es sollte nicht sein! Dieser Mann war ein Rasender in seiner heiligen Langmuth!
Die Hand auf seinen Arm legend, deutete sie nach dem Schranke. Sie überlegte nicht, sie dachte nicht, es trieb sie vorwärts mit übermächtiger Gewalt.
„Dort, hinter jener Thür befindet sich ein geheimer Gang! Lassen Sie dort nachsuchen!“
Sie hatte mit klingender Stimme gesprochen Der Schutzmann stürzte auf den Schrank zu, fand die Feder und verschwand auf der dunklen Treppe. Es war geschehen! – Die Schritte des Mannes verhallten, es ward totenstill um die beiden. Grete stand da, die Hände auf das Herz gepreßt, zitternd vor den Folgen ihrer That, doch ohne Reue; er sah sie an mit langem, düsterem Blicke. Endlich öffnete er die Lippen.
„Warum haben Sie das gethan?“
„Weil ich’s nicht dulde, daß Sie sich zu Grunde richten – für uns!“ Es lag eine grenzenlose Verachtung in der Betonung dieser zwei Worte. „Sie wollten schweigen ... leugnen Sie nicht! Ich sah’s, und darum redete ich.“
„– und verrathen Ihren Bruder, nur um mir nicht verpflichtet zu werden, nicht durch meine Hilfe die schwerste Stunde Ihres Lebens erleichtert zu wissen - o, ich kenne, ich verstehe Sie!“
Sie zog statt der Antwort ein zusammengefaltetes Papier aus der Tasche. „Nehmeu Sie! Es hat schwer auf mir gelastet, monatelang. Ich trag’s nicht länger, ich kann es nicht. Ich weiß, daß Julius Meermann der Dieb auch jener dreitausend Mark ist, derentwegen Sie verdächtigt wurden - hier, hier haben Sie den Beweis!“
Anton nahm betroffen den Zettel und faltete ihn auseinander. Die spurlos verschwundene Berechnung! Und sie – sie, seine Feindin, gab den Namen des geliebten Bruders preis, um den seinigen vom Makel zu befreien! Warum nur, warum? Sollte er sich getäuscht haben, sollte dennoch ihr Herz – Thorheit, es nur zu denken! Und doch – in der gleichen Sekunde fiel sein Blick auf das Muster des Taschentuchs, das Grete, in Thränen ausbrechend, vor die Augen preßte, und ein heißes Glücksgefühl durchzuckte ihn. Kein Zweifel mehr! Die ihm seinen ehrlichen Namen zurückgab, war auch die Freundin, die sich liebevoll seines verwundeten Hundes angenommen hatte!
„Fräulein Meermann,“ preßte er hervor, geblendet von der Erkenntniß, die plötzlich sonnenhell auf ihn eindrang, „haben Sie Dank, Dank für alles!“ Mit einem innigen Aufleuchten seiner dunklen Augen ergriff er ihre Hand.
In diesem Augenblick kehrte der Schutzmann zurück, ohne den Entflohenem. Julius war entkommen.
Es war ein fast hörbares Aufathmen, mit dem sich Röver zu seinem Untergebenen wandte. „Besorgen Sie die nöthigen Meldungen auf dem Bahnhof! Dem Chef werde ich selbst Bericht erstatten.“ Dann trat er zu dem jungen Mädchen.
„Leben Sie wohl, Fräulein Meermann,“ sagte er ernst. „Auf Wiedersehen!“
Sie antwortete nicht, sie hob nicht den Kopf. Sie hatte ihre Schuldigkeit gethan, er würde glücklich sein. Für sie selbst waren Glück und Hoffnung zu Ende. – –
An diesem Abend erkrankte Frau Meermann schwer und rang wochenlang zwischen Leben und Tod; Grete hatte Tag und Nacht zu schaffen und in ihrem Gemüth verdrängte eine Sorge die andere. Ins Geschäft war sie nicht mehr gegangen. Von der Außenwelt drang fast keine Kunde zu ihr. Ihre Mutter und sie hatten keine Freunde mehr, seit das Vergehen und die Flucht des Sohnes bekannt geworden waren, seit Röver unter der Beihilfe des Kommissars durch ein erneutes Gerichtsverfahren gläuzend gerechtfertigt und endgültig von dem auf ihm ruhenden schimpflichen Verdacht gereinigt worden war. Die Zeitungsnummer, die den Bericht darüber sammt einigen keineswegs schmeichelhaften Betrachtungen über den flüchtigen Dieb enthielt, bekam Grete von einem Ungenannten zugesandt; aber die Absicht, ihr damit wehzuthun, erreichte derselbe nicht. In ihr war es sehr still geworden.
Von ihrem Bruder verlautete nichts, er mußte jetzt längst in Sicherheit sein. Ihre Mutter genas. Was durfte sie darüber hinaus hoffen oder wünschen?
An dem Tage, an welchem der Arzt Frau Meermann außer Gefahr erklärt hatte, brachte ein Gärtnerbursche einen Veilchenstrauß für Grete; der ihn sandte, wünschte nicht genannt zu werden. Diese Gabe wiederholte sich alle zwei Tage, und Grete erröthete, wenn die Blumen gebracht wurden, jedesmal so tief, wie sie im Gedanken an ein Paar dunkler gefürchteter Augen zu erröthen pflegte.
„Gewiß von Märtens,“ sagte Frau Meermann, als sie wieder anfing, Interesse an ihrer Umgebung zu nehmen. „Das gefällt mir von dem jungen Manne, daß er gerade jetzt an Dich denkt.“
Grete mußte ein Lächeln unterdrücken. „Warum sollen die Blumen denn gerade von Märtens sein? Könnten wir nicht auch sonst noch einen Freund besitzen, der uns seine Treue in so zarter Weise beweisen will?“
Es war ein sonnenheller Sonntagmorgen. Grete hatte die Kammerfenster weit geöffnet, damit der Klang der Kirchenglocken [796] zu der Genesenden hereindringen könne. Die lag still da und schaute sinnend auf ihre abgemagerten Hände. Noch hatte sie den Namen des verlorenen Sohnes nicht wieder über ihre Lippen gebracht, aber mit der fortschreitenden Genesung begann ein Schimmer von Frieden sich über ihre gealterten Züge zu breiten. Die Tochter hatte die Wohnstube sauber aufgeräumt, das Veilchensträußchen auf dem Sofatisch zurecht gerückt und war im Begriff, zur Bereitung des bescheidenen Mahls hinauszugehen, als draußen die Vorthür ging, die sie nicht verschlossen hatte, und gleich darauf an die Zimmerthür gepocht wurde.
„Herein!“
„Guten Morgen, Fräulein Grete!“
„Herr Röver –“
Er war’s und doch ein anderer als früher, denn seine Lippen lächelten zuversichtlich, und ein Strahl tiefen Glückes leuchtete aus seinen Augen. Er eilte auf die Erröthende zu und faßte ihre beiden Hände.
„Sie haben einen neuen Menschen aus mir gemacht, Grete, und einen glücklichen. Allein der Erfolg macht übermüthig. Noch ist mein Glück nicht vollkommen, ich komme, zu holen, was daran fehlt.“
Grete blieb stumm. Sie wagte nicht, die Augen aufzuschlagen, und sie, die sonst so entschlossen war, zitterte vor scheuer Befangenheit.
„Vor Jahren,“ sprach er und sah den Veilchenstrauß auf dem Tische an, „träumte ich von einer geachteten Stellung in weiter Ferne, und wenn ich die gefunden hätte, dann wollte ich zurückkehren und vor ein geliebtes Mädchen treten, wollte sie bitten, mein Glück zu theilen, es erst vollkommen zu machen. Der erste Theil dieser Wünsche ist erfüllt. Ich habe den Polizeidienst aufgegeben und durch Verwendung meines früheren Chefs in einer großen Seestadt eine Anstellung gefunden, die meine
kühnsten Erwartungen übertrifft. Und jetzt muß ich wohl oder übel versuchen, auch den zweiten Theil meines Programms zu verwirklichen. Grete – nur Dich habe ich lieb gehabt, solange ich denken kann! Willst Du mich begleiten? Willst Du mein Weib sein?“
Sie war sehr blaß geworden. „Ich verdiene es nicht –“ stammelte sie.
„Grete, hast Du mich lieb?“
„Nach dem Hohn und Schimpf, den ich Ihnen angethan habe – jetzt, jetzt, da wir arm sind, mit Schande bedeckt, da all unsere Freunde sich von uns wenden!“
„Hast Du mich lieb, Grete?“
Da warf sie sich erglühend in seine Arme und vergrub ihr Gesicht an seiner Brust. „O Du bester, gütigster der Menschen – nimm mich hin! Ich habe keinen Willen, keinen Stolz mehr vor Dir! Dir folge ich, wohin Du mich führst!“
| * | * | |||
| * |
Es geht Anton Röver gut in der neuen Heimath. Die Jahre, die er im Dienst der Polizei zubringen mußte, haben ihn gelehrt, mit Menschen umzugehen, und dadurch seinen Kenntnissen erst den rechten lebendigen Werth gegeben. Er arbeitet sich stetig empor zur Freude und zum Stolz seines alten Mütterchens, das nun endlich gute Tage genießt. Frau Meermann, sehr still und mild geworden, lebt bei ihm. Sie spricht wenig mehr von Rechtschaffenheit und Pflichttreue und niemals nennt sie den Namen ihres Sohnes. So oft jedoch ein Schiff aus entlegenen Welttheilen im Hafen gemeldet wird, wankt sie, auf ihren Stock gestützt, zur Landungsbrücke, um den ankommenden Fahrgästen ins Gesicht zu schauen. Sie sagt es nicht, aber tief im Herzen hegt sie unwandelbar die Hoffnung, daß eines Tages der verlorene Sohn, reuig und gebessert, in ihre Arme zurückkehren werde.
Grete ist eine glückliche Frau, eine glückliche Mutter. Wenn jemand das hübsche Aussehen ihres Erstgeborenen rühmt, streicht sie liebkosend über sein dichtes Haar und sagt mit besonderem Stolze: „Ja, ja – und er hat die Augen seines Vaters.“
Sie hat sie lieben gelernt, diese Augen.
[797]
Verstummt im Wald ist Klang und Schall,
Die heit’re Vogelweise;
Die Drossel und die Nachtigall,
Sie sind schon auf der Reise.
Da kommt mein alter Hausgenoß’,
Der lange fern gewesen –
Er hatte sich im Wald ein Schloß
Zum Sommerheim erlesen –
Der mir, als noch die Flocke flog,
Den Frühlingspsalm gesungen –
Vom Garten in die Büsche zog
Der Alte mit den Jungen.
Nach seinem braunen Kästlein sieht
Noch einmal er beim Scheiden
Und singt mir dann ein Abschiedslied
Hoch in den Pappelweiden
Und ruft mir zu: „Komm’ mit hinaus
Jenseit der Alpenrücken,
Da sollst du dir den Blumenstrauß
In Wintersmitten pflücken!
Da lacht ein Grün, das ewig frisch!
Aus dunklen Laubeskronen
Holst du dir flugs für deinen Tisch
Orangen und Citronen!“ – –
Zieh’ weiter, Star, zu Südlands Saum
Bei Palmen und Cypressen
Kann ich den grünen Tannenbaum
Des Nordens nicht vergessen!
Und, wenn dein Blüthensegen kann
Kein Frost den Tod bereiten,
Fühl’ ich mich doch als fremder Mann.
In Treibhausherrlichkeiten!
Ja, wären deine Flügel mein,
Du Starmatz, ließ ich’s gelten,
Für Wochen möcht’ Genosse sein
Ich dir in wärmern Welten –
Für jene Zeit, wo niedermäht
Die Blätter das Verderben –
Der Schöpfung Tod hat Majestät,
Doch traurig ist ihr Sterben!“ – –
Ob Nord, ob Süd – wem ziemt der Preis? “ –
Wie strahlt im Sonnenlichte
Im Funkelkleid von Schnee und Eis
Stolz unsre Nordlandsfichte!
wie jauchzt um sie beim Kerzenlicht
Der Kinder bunt’ Gewimmel –
Und ein „Bambino“ ist noch nicht
Das Christkind mit dem Schimmel!
Mein Herz, einst war es hoch beglückt,
Wenn unter Lorbeerkronen
Im Winter Veilchen ich gepflückt
Und prächt’ge Anemonen.
Doch hat’s im stillen stets gefragt,
Ob wohl im Waldesmoose
Daheim schon aus dem Schnee sich wagt
Hervor die Christusrose?
Ob jetzt beim Eislauf auf dem Teich
Sich Hand in Hand verstricke,
Und ob die Meise in dem Zweig
Sing’ lustig ihr „Spinn’ dicke“? –
Starmatz, zieh’ hin! Ich bleib’ daheim!
Mir weckt’s den Frühlingsglauben,
Seh’ ich am Hyazinthenkeim
Die ersten Knospentrauben!
Ein Käferlein, das übrig blieb
Und klettert an den Ranken,
Ruft wach in mir den Maientrieb
Lichtseliger Gedanken!
Mein junges Vöglein hat studiert
Schon gut das Lied der Alten
Und will mir, wenn es schneit und friert,
Die Lenzespredigt halten.
Und, was mir über alles werth,
Wie man für Südland schwärme,
Es ist mein Haus, mein eigner Herd,
An dem ich mich erwärme,
Und Weib und Kind, mir zugesellt,
Wie auch der Winter dräue,
Mein Allerbestes auf der Welt,
Die Liebe und die Treue!
Mir summt durchs Herz ein leiser Ton.
Was will das wohl bedeuten? –
In meinen Träumen hör’ ich schon
Die Weihnachtsglocken läuten!
Emil Rittershaus.
Vergiftete Nadelhölzer.
Es war im Hochsommer des Jahres 1890, als eine Kunde durch das Land ging, welche jeden Naturfreund mit Trauer erfüllen mußte.
In dem durch seine herrlichen Wald- und Gebirgsgegenden ausgezeichneten Bayerland waren Millionen von Raupen aufgetreten, welche sich die harten Nadeln der Fichten, Tannen und Kiefern zur Nahrung ausersehen hatten, und bald zeigten sich endlose Strecken vorher im prächtigsten Grün prangender Nadelwälder vollständig kahl gefressen, und die schlanken Kinder des Forstes streckten die ihres grünen Schmuckes entblößten Zweige trauernd zum Himmel.
Damit war nicht allein dem Walde sein schönster Schmuck geraubt, sondern der Bestand des Waldes selbst bedroht, insofern der seiner Nadeln (welche hier die Stelle der Blätter vertreten) beraubte Baum nicht mehr imstande ist, sich zu ernähren, und daher einem baldigen Siechthum, dem Hungertod verfällt.
Betrachten wir einmal das Blatt eines Laubbaumes, z. B. der Linde oder der Buche, so finden wir die Oberseite desselben gleichmäßig mit einer glänzenden Haut von meist dunkelgrünem Aussehen überzogen. Die Unterseite dagegen entbehrt dieses glänzenden dunkelgrünen Anblicks, erscheint mattgrün, und wenn wir genauer zusehen, so erkennen wir oft schon mit bloßem Auge, leichter und einfacher mit einem Vergrößerungsglas, eine ungeheure Anzahl kleiner Punkte, mit welchen die ganze Blattunterseite dicht besetzt ist. Nimmt man nun mit einem scharfen Rasiermesser ein kleines dünnes Stück der unteren Blattfläche hinweg und bringt es unter ein gutes Mikroskop, so lassen sich diese kleinen Punkte deutlich als ovale oder rundliche Zellgebilde – die Spaltöffnungen oder Poren – erkennen. Sie liegen einzeln zwischen den Zellen der Blattaußenhaut (Epidermis) und bestehen gewöhnlich aus zwei sogenannten „Schließzellen“, zwei aneinanderliegenden, halbrunden oder länglich halbrunden, mit Zellinhalt und meist einigen grünen Chlorophyllkörnern versehenen Zellen, welche in der Mitte ihrer aneinandergrenzenden Scheidewände eine längliche Spalte zwischen sich lassen.
Diese Spalten nun sind die Ausgänge der mit Luft erfüllten Gänge der inneren Gewebe, der „Intercellularräume“, die sich hier nach außen öffnen. Man könnte sie gewissermaßen die Mundöffnungen oder Nasenlöcher der Pflanzen nennen, denn sie sind es, welche den Hauptnahrungsstoff der Pflanze, die Kohlensäure, aus der Luft aufnehmen und den inneren grünen Geweben zuführen, in welchen dieselbe weiter zu festerer Nahrung verarbeitet wird.
[798] Die Natur hat hier einen äußerst sinnreichen Apparat geschaffen, indem diesen Schließzellen die Eigenschaft zukommt, sich unter dem Einfluß des Lichtes zu öffnen und zu schließen. Sobald nun die Kohlensäure durch die Spaltöffnungen in das Blattgewebe eingetreten ist, so trifft sie auf ein lockeres Gewebe, aus Zellen bestehend, welche reichlich wasserreiches Protoplasma und grüne Chlorophyllkörner enthalten. Es ist dies das sogenannte „Schwammgewebe“, welches das nun in Wasser gelöste Kohlelisäuregas aufnimmt und einem dichteren, oberhalb desselben liegenden, noch dichter erfüllten Zellgewebe, dem „Pallisadengewebe“, zuführt, in welchem hauptsächlich die Verarbeitung zu festen Nährstoffen, nämlich zu Stärke und Zucker, vor sich geht. Wir könnten deshalb das lockere Schwammgewebe des Blattes annähernd als Lunge und das dichtere Pallisadengewebe als Leber der Pflanze bezeichnen.
Eine weitere wichtige Aufgabe in der Ernährung der Pflanze ist dem Blatte zugetheilt durch die hier hauptsächlich stattfindende Verdunstung des Wasserdampfes (Transpiration), welche sowohl an der ganzen Außenfläche (Epidermis) desselben als auch durch die Spaltöffnungen sich vollzieht. Diese Verdunstung des Wassers aus dem Blattfleisch dient wesentlich mit zur Regelung des aufsteigenden Saftstromes, der Bewegung der von den Wurzeln angesaugten Flüssigkeit nach den Orten des Verbrauches hin. Dieser aufsteigende Saftstrom, welcher die mit dem Wasser aus dem Erdboden aufgenommenen und gelösten anorganischen Salze mit sich führt, hat seinen Weg vorwiegend im Holze des Stammes. Letzteres bildet einen Bestandtheil der Gefäßbündel, eines zusammenhängenden Systems in der ganzen Pflanze, welches, von allen feinsten Wurzelverzweigungen beginnend, durch Hauptwurzel, Stamm und Aeste in alle Blätter (hier die Rippen und Nerven darstellend) führt.
In der Pflanze sind mehrere Kräfte thätig, welche diese Bewegung des Wassers nach oben veranlassen.
Erstens der sogenannte „Wurzeldruck“; die Wurzel mit ihren zahlreichen kleinen Wurzelfasern saugt nämlich mit solcher Kraft das Wasser auf, daß sie selbst es schon auf eine beträchtliche Strecke in der Pflanze emporzutreiben vermag. Wir können dies beobachten bei manchen Bäumen, besonders bei der Birke, der Hainbuche, oder bei dem Weinstock vor der Belaubung im Frühling, wo beim Einschneiden in den Stamm der Saft lange Zeit aus der Wunde fließt.
Zweitens wirken umgekehrt die Blätter durch den Wasserverlust bei der Verdunstung, welcher Ersatz desselben von unten her nöthig macht, saugend auf die unter ihnen befindliche Wassersäule im Stamme. Durch diese Wasserbewegung und Verdunstung findet auch innerhalb der Pflanze eine gewisse Abkühlung statt, welche eine allzu große Erhitzung verhütet.
Wie nun schon oben erwähnt, findet die Verarbeitung der rohen Nährstoffe zu den organischen unmittelbaren Bestandtheilen der Pflanze, die sogenannte „Assimilation“, in den grünen Pflanzentheilen und vorzugsweise in den Blättern statt. Von den Blättern aus wandern die assimilierten Nährstoffe in die Zweige und weiter nach den Früchten und im Stamme abwärts nach den Wurzeln, überhaupt nach allen Organen, welche Nahrung bedürfen. Dies ist der sogenannte „absteigende Saftstrom“.
Hierfür genügt jedoch das Holz allein nicht, der absteigende Strom nimmt vielmehr seinen Weg zum größten Theile durch Bast und Rinde; namentlich finden sich in den weichen dünnwandigen Theilen des Bastes eigenthümliche Gefäße, die Siebröhren, welche durch eine besondere Wucherung ihrer durchlöcherten Querwände, den sogenannten Callus, wahrscheinlich ventilartige Wirkung zur Abwärtsleitung besitzen.
In Pflanzentheilen, welche im Wachsthum begriffen sind, werden nun diese frischgebildeten Nährstoffe zur Schaffung neuer Organe verwendet, in solchen dagegen, welche in einen Ruhezustand übergehen, werden sie in verschiedener chemischer Form in den Zellen als sogenannte Reserve-Nährstoffe aufgespeichert, hauptsächlich in den Samen, bald als Oel (z. B. beim Leinsamen), bald als Stärke (z. B. im Getreidekorn), in den Knollen, Wurzeln (Kartoffeln), ferner im Holze der Bäume und Sträucher, wo während des Winters das Mark und die Markstrahlen etc. reichlich mit Stärkemehl erfüllt sind. Mit dem Wiedererwachen der Vegetation vor dem Knospentrieb oder bei der Keimung des Samens verschwinden diese Reservenährstoffe wieder aus ihren Speicherräumen, indem sie zu dieser Zeit, in welcher die noch blattlose Pflanze ihre Nahrungsstoffe nicht selbst zubereiten kann, zur ersten Ernährung der neu sich bildenden Organe, der Knospen, verwendet werden.
Wir haben nun gesehen, welch’ wichtige Rolle die Blätter, beziehungsweise die mit Spaltöffnungen versehenen grünen Theile eines Baumes oder Strauches für die Ernährung des einzelnen Individuums spielen, und es ist daher leicht einzusehen, daß ein Baum, welcher aller oder des weitaus größten Theiles seiner Blätter in der für das Wachsthum wichtigsten Zeit beraubt wird, nicht mehr imstande ist, die für seine Ernährung nothwendige Menge organischer Substanz zu bilden, und auch durch die empfindliche Störung des regelmäßigen Verlaufs des Saftstromes verhindert wird, vorhandene Nährstoffe rasch an diejenigen Stellen der Pflanze hinzuführen, welche jener zur Neubildung einzelner Organe bedürfen. Zugleich wird infolge der mangelnden Abkühlung durch den auf- und absteigenden Saftstrom die Erhitzung durch die unmittelbare und mittelbare Bestrahlung der Sonne eine so große, daß eine Vertrocknung der sekundären Rindenschicht, welche für das Wachsthum von besonderer Bedeutung ist, wesentlich befördert wird.
Wie im komplizierten Baue eines mechanischen Triebwerkes das Fehlen eines Radzahnes Stillstand hervorbringt, so geräth hier die wunderbare Maschinerie des Pflanzenlebens ins Stocken, der Baum ist krank. Nur das Auftreten neuer Blätter könnte ihn retten und den Lebensstrom nach und nach wieder in seinen alten Gang bringen. Aber dazu fehlt eben die genügende Menge der zur Neubildung der Knospen und deren weiterer Ernährung bis zur selbständigen Assimilation nothwendigen Reservenährstoffe, denn der seiner Blätter oder Nadeln beraubte Baum war ja nicht imstande, solche zu bilden und für Nothfälle aufzuspeichern.
Während wir nun bei allen Laubbäumen beobachten, daß die Blätter im Herbste gelb werden und abfallen, der Baum selbst während der nun folgenden kalten Jahreszeit einen Ruhezustand durchmacht und gewissermaßen einen Winterschlaf hält, wissen wir von fast allen Nadelhölzern das Gegentheil. Diese behalten ihre harten, spitzen, nadelähnlichen Blätter auch während der strengsten Winterszeit, sie sind immergrüne Gewächse. Sie erfreuen das Auge des Wanderers durch ihr dunkles Grün in einer Zeit, in welcher die übrige Natur öde und still ein betrübendes Bild von der Vergänglichkeit alles Schönen auf Erden bietet.
Diese Eigenschaft des „ewigen Grünens^, welche die Nadelhölzer anszeichnet, hat nun in neuerer Zeit vielfach Veranlassung gegeben, die schlanken Kinder des Waldes als Zierde der städtischen Anlagen und Gärten zu verwenden, wo sie im Sommer zwischen dem hellgrünen Laube der Birken und Linden, dem dunkelrothen der Blutbuche entzückende Schattierungen hervorbringen. Und selbst wenn Schnee und Eis alles Leben in der Natur scheinbar ertötet haben, verweilt das Auge des Spaziergängers gern auf den oft groteske Figuren bildenden, schwer mit Schnee beladenen Zweigen des Fichten- und Föhrenbaumes.
Aber dem aufmerksamen Beobachter wird eines nicht entgehen: je dichter die Häuser emporsteigen um die grünen Oasen der Großstädte, je weiter hinaus die Stadt ihre Arme ausstreckt, und je mehr Reihen von Miethkasernen entstehen, umso spärlicher werden die Nadelbäume in den straßenumsäumten Anlagen, in [799] den Gärten vor und hinter den Häusern. Von Jahr zu Jahr wird der Spitzentrieb kümmerlicher, die Nadeln werden dürr und fallen ab, kahler und kahler strecken sich die Aeste empor, und schließlich kommt der Gärtner und haut den verdorrten Baum ab, und der hübsche Vorgarten, den sonst ein halbes Dutzend stattlicher Christbäume zierte, hat seinen schönen Winterschmuck eingebüßt, das weiße Leichentuch des Schnees deckt alles in gleichförmiger Oede.
Woher kommt dieses Absterben der Nadelbäume in den Stadtgärten, während doch die Laubbäume weiter gedeihen und verhältnißmäßig sogar prächtige Baumkronen entwickeln?
Gerade die Eigenschaft welche uns den Christbaum so lieb macht, nämlich daß er „zur Sommer- wie zur Winterszeit grün“ ist, bringt ihm Verderben, denn sein bitterster Todfeind ist der Schnee. Allerdings nicht der Schnee an und für sich, wie er draußen im endlosen Walde auf seinen Zweigen ruht, sondern der Schnee in der Stadt, der durch die Verbrennungsgase zahlloser Stadtessen verunreinigte Schnee.
Weitaus der größte Theil der Stadthaushaltungen heizt jetzt mit Steinkohlen. Zahllose Centner dieser schwarzen Diamanten gehen in Gas- und Rauchform täglich in die Luft der Städte über, und während im Sommer die Windströmungen diese Verbrennungsstoffe rasch hinwegführen und durch Vermischen mit überwältigenden Mengen atmosphärischer Luft so verdünnen, daß sie keinem organischen Wesen schädlich werden, ist es im Winter der Schnee, welcher in seiner unschuldigen Weiße begierig eines der schädlichsten Verbrennungsgase ansaugt und in sich aufspeichert. Um dies zu erklären, müssen wir uns ein wenig in das Labyrinth der chemischen Formeln wagen.
Alle Steinkohlen enthalten mehr oder weniger Schwefel, ihm verdanken die einzelnen Sorten das raschere oder kürzere Verbrennen. Sobald nun Schwefel verbrennt, geht er mit dem Sauerstoff der Luft eine direkte Verbindung ein, ein säuerlichschmeckendes, erstickendes Gas, aus einem Theil Schwefel (S) und zwei Theilen Sauerstoff (O) bestehend, die schweflige Säure (Schwefeldioxyd) (SO2). Tritt nun zu dieser schwefligen Säure (SO2) noch ein Molekül Wasser (H2O), so entsteht mit Hilfe des Sauerstoffs der Luft die Schwefelsäure (SO2 + H2O + O = H2SO4), eines der schärfsten Gifte, welches selbst schon in geringen Mengen alles organische Leben zerstört.
Der Schnee nun enthält eine eigenthümliche Verbindung, aus zwei Theilen Wasserstoff und zwei Theilen Sauerstoff bestehend, welche, auf künstlichem Wege hergestellt, in der Technik neuerer Zeit vielfach Verwendung findet. Diese Verbindung – Wasserstoffsuperoxyd genannt – findet sich in geringen Mengen in der Atmosphäre, im Regen, Thau und Schnee. Ihre chemische Zusammensetzung unterscheidet sich insofern von der des gewöhnlichen Wassers, daß sie ein Atom Sauerstoff (O) mehr als dieses enthält, wir schreiben daher seine chemische Formel H2O2. Das zweite Atom Sauerstoff im Wasserstoffsuperoxyd ist jedoch nur lose gebunden, weshalb diese Verbindung durch Wärme leicht in ihre Bestandtheile, nämlich Wasser und Sauerstoff, zerfällt. Diesem Verhalten nun verdankt das Wasserstoffsuperoxyd auch seine geschätzte Eigenschaft, leicht mit anderen Körpern neue Verbindungen einzugehen, und daher ist es erklärlich, daß der Schnee, in welchem vermöge der niedrigen Temperatur ein Zerfallen des Wasserstoffsuperoxydes verhindert wird, begierig das Verlangen zeigt, die beim Verbrennen des in den Steinkohlen enthaltenen Schwefels entstehende gasartige schweflige Säure anzusaugen und als Schwefelsäure aufzuspeichern (SO2 + H2O2 = H2SO4).
Ein Chemiker am hygieinischen Institut der Universität München, welches bekanntlich von Pettenkofer geleitet wird, hat es unternommen, diese Eigenschaft des Schnees, Schwefelsäure aufzuspeichern, Schritt für Schritt nachzuweisen[1]. Er entnahm aus dem Hofraum des genannten Instituts im Winter 1886 vom 6. bis 22. Februar eine bestimmte Menge Schnee und wies nach, daß der Gehalt an Schwefelsäure täglich zunahm. So fand er am 6. Februar in einem Kilogramm Schnee 6,96 Milligramm Schwefelsäure, am 10. Februar schon 32,80 Milligramm, am 12. Februar 40,60 Milligramm, am 14. Februar 48,40 Milligramm, am 16. Februar 62,20 Milligramm, am 22. Februar 91,50 Milligramm. Leider unterbrach hier starker Schneefall die interessante Untersuchungen. Während derselben Zeit entfernt von der Stadt auf freiem Felde aufgenommene Schneeproben waren ganz oder fast frei von Schwefelsäure.
Es mag hier noch bemerkt sein, daß das hygieinische Institut in München in einem noch wenig bebauten Stadttheile an der Theresienwiese liegt, der namentlich auch im Winter häufigen Süd- und Westwinden ausgesetzt ist und besonders im Jahre 1886 noch fast ringsum frei war.
Wenn man nun die immergrüne Eigenschaft der Nadelhölzer in Betracht zieht, so ist es leicht erklärlich, warum gerade diese rauhen Kinder des Waldes die Stadtluft nicht vertragen. Die bei den Fichten und Kiefern ringsum mit Spaltöffnungen versehenen Nadeln sind dem mit Schwefelsäure durchtränkten Schnee eben schutzlos preisgegeben. Die Laubbäume sind in der milderen Jahreszeit, in welcher die Natur schneefrei ist, vor den in den Regen übergehenden Verbrennungsgasen durch die glatte, mit gewissen Wachsarten getränkte Oberhaut ihrer Blätter geschütz, während sich bei ihnen fast ausnahmslos die Spaltöffnungen nur auf der Blattunterseite befinden. Luft und Wind trocknen
außerdem etwa auf den Blättern sitzenbleibende Wassertropfen rasch ab und verhindern eine Aufspeicherung der schwefligen Säure, so daß die Laubbäume ganz gut gedeihen, solange nicht übermäßiger Ruß oder Staub die Blätter dicht belegt und die kleinen Spaltöffnungen an der Unterseite verstopft. Aber selbst für diesen Fall hat die gütige Mutter Natur häufig Vorsorge getroffen, indem die Blattunterseite namentlich bei ganz jungen Blättern der neuen Triebe oft mit kleinen, dem bloßen
Auge nicht sichtbaren Haaren oder haarähnlichen Gebilden besetzt ist; sie dienen einestheils zum Schutze der Spaltöffnungen, anderntheils erfüllen sie oft drüsenartige Aufgaben, indem sie Körper,
welche durch den Stoffwechsel im Blatte entstanden und zur weiteren Ernährung der Pflanze nicht mehr nöthig sind, aufnehmen und ausscheiden.
Kündigt sich nun der Winter an, so sucht der Laubbaum sich seiner für eine kalte Temperatur nicht eingerichteten Blätter zu entledigen; er bildet, nachdem alle noch werthvollen Stoffe aus dem Blatte in den Stamm zurückgetreten sind, an der Ansatzstelle des Blattstiels am Zweige eine Korkschicht, welche, undurchlässig für den Saftstrom, den nun zur Winterruhe bereiten Baum hermetisch abschließt. Das vom Gesammtorganismus abgetrennte Blatt wehrt sich noch eine Zeitlang gegen sein Schicksal, es wird roth und gelb und dürr, fällt schließlich bei einem kräftigen Windstoß ab und giebt die Salze, welche es dem Boden entzogen hat und welche nun durch Fäulniß frei werden, der Mutter Erde wieder zurück.
[800] Anders der mit harten Nadeln an Stelle von Blättern bewehrte Zapfenträger. Seine durch eine dicke Epidermis geschützten Nadeln vermögen den Winterfrost unseres Klimas wohl zu ertragen, und nur sein Stoffwechsel wird infolge der geringeren Sonnenwärme ein langsamerer, die Farbe seines Grüns infolgedessen dunkler. Betrachten wir z. B. die Nadel einer Fichte (Pinus excelsa Lk.) mit einem guten Vergrößerungsglase, so bemerken wir ringsum an derselben in unregelmäßigen Zwischenräumen zahlreiche kleine, weiße Punkte. Es sind dies die Spaltöffnungen, in ihrer ovalen Gestalt deutlich zu erkennen, sobald man mit einem scharfen Rasiermesser ein kleines Flächenstückchen von der Nadel abhebt und unter das Mikroskop bringt. Ist nun im Winter der Zweig dicht mit Schnee bedeckt, so nimmt letzterer vermöge seiner oben erläuterten Ansaugungsfähigkeit die schweflige Säure der Verbrennungsgase aus der Luft auf, bildet mit derselben, wie gezeigt, Schwefelsäure und übermittelt sie mittels der Spaltöffnungen unmittelbar den Innenräumen des Nadelblattfleisches. Hier durchdringt sie die zarten Zellwände und tötet den Inhalt der einzelnen Zellen – das Protoplasma. Mit der Lebensfähigkeit des Zellinhalts hört auch seine Assimilationsfähigkeit auf, der Baum kränkelt und geht nach und nach zu Grunde, er stirbt an Vergiftung.
Wenn man sich eine Lösung von Schwefelsäure mit der oben angegebenen Stärke, z. B. 90 Milligramm auf 1 Liter Wasser, bereitet und in dieselbe einige Nadeln einer Fichte oder Föhre einlegt, so kann man das Zerstörungswerk des ätzenden Giftes genau verfolgen. Schon nach 24 Stunden zeigt ein dünner Querschnitt der betreffenden Nadel unter dem Mikroskop eine Verkohlung seines Zellinhalts, welcher jetzt anstatt des schön leuchtenden Grüns eine schmutzig braune Farbe angenommen hat, er ist getötet.
Wir besitzen daher in unseren Nadelhölzern gewissermaßen einen Gradmesser für die größere oder geringere Verunreinigung der Luft in Städten oder Stadttheilen, einen Gradmesser, der freilich sein gefährliches Amt mit einem langsamen Sterben bezahlen muß.
Blätter und Blüthen.
Die Einweihung der Schloßkirche zu Wittenberg. (Zu dem Bilde S. 789) Eine wechselvolle Geschichte, reich an Mißgeschick, war es, welche die dreieinhalb Jahrhunderte seit Luthers Tod der Stadt seines Wirkens, der Wiege der Reformation gebracht haben. Fast jeder der großen Kriegsstürme, die über Deutschland hereinbrachen, hat seine Wolken auch über Wittenberg entladen – im Schmalkaldischen, im Dreißigjährigen und Siebenjährigen Kriege, in den napoleonischen Kämpfen haben die Kugeln der Kanonen die stattliche Festung an der Elbe bedroht. Und nicht zum wenigsten hat unter diesen Unbilden die Schloßkirche mitgelitten, an deren Thür der kühne Augustinermönch am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen angeschlagen, bei einer Beschießung der Stadt am 13. Oktober 1760 wurde sie in Brand geschossen, so daß fast nur die nackten Mauern stehen blieben; wieder ausgebaut, erfuhr sie neues Unheil in den Jahren 1813 und 1814, in denen sie eine Zeitlang als Magazin benutzt wurde: in der Nacht vom 27. zum 28. September 1813 bei einem fürchterlichen Bombardement, fing der schöne Kirchthurm Feuer, und bloß das untere Gemäuer desselben konnte gerettet werden. Seitdem waren die großen Erinnerungsfeste an die Reformation zugleich der Anlaß zur Erneuerung des ehrwürdigen Baues. Nachdem das Jahr 1815 die bis dahin sächsische Stadt an die preußische Krone gebracht hatte, wurde die Schloßkirche durch die Fürsorge König Friedrich Wilhelms III. einer gründlichen Reparatur unterworfen, so daß sie bei der dreihundertsten Wiederkehr des Thesenanschlags wenigstens keinen unwürdigen Mittelpunkt der Feier bildete. Allein es that je länger je mehr eine Erneuerung im großen Stile noth, und der Entschluß dazu entstand in jenen festlichen Tagen, welche das alte Wittenberg 1883 aus Anlaß von Luthers vierhundertjährigem Geburtstag erlebte. Besonders der damalige Kronprinz des Deutschen Reiches, der spätere Kaiser Friedrich, hat diesem Werke der Pietät bis an seinen allzufrühen Tod eine lebhafte Theilnahme zugewandt, und Kaiser Wilhelm II. hat die Vollendung des Angefangenen als ein willkommenes Vermächtniß übernommen. So konnte denn am 31. Oktober dieses Jahres der in neuer Schönheit, aber in der alten gothischen Gestalt wiederhergestellte Bau in feierlicher Weise eingeweiht werden. Der Kaiser selbst, an der Spitze der protestantischen Fürsten Deutschlands, war herbeigeeilt, das Fest mit zu begehen, und es war ein glänzendes Bild, als sich der farbenreiche Zug, den Kaiser in der Mitte, über den ehrwürdigen Marktplatz hinweg zur Kirche in Bewegung setzte. In den Nachmittagsstunden schloß sich dann dem ernsteren Theile der Feier ein Festzug an, der in charakteristischen Gestalten und künstlerisch angeordneten Abtheilungen den Beschauer im Fluge durch die letzten sieben Jahrhunderte führte. Unser Bild giebt aus dem Zuge die Figuren des sächsischen Kurfürsten Friedrich des Weisen und des Schwedenkönigs Gustav Adolf wieder, sowie die Gruppe, welche im Kostüm des 12. Jahrhunderts den Reigen eröffnete. –
Ein goldiger Herbsttag leuchtete dem Feste, und es waren gewaltige Eindrücke, welche dort in Wittenberg am 31. Oktober wachgerufen wurden inmitten der stummen Zeugen jener Geistesthat, aus der ein neues Völkerleben entsprossen ist.
Wie kann man die Sonne belauschen? Die menschliche Stimme reicht bekanntlich nicht weit; wir wissen, wie schwer es z. B. ist, über einen nur einigermaßen breiten Strom hinüber den Fährmann durch Zuruf zu erreichen. Der Befehlshaber eines Seeschiffes ist schon bei etwas bewegter Luft darauf angewiesen, seine Stimme durch das Sprachrohr zu verstärken, um sich dem Schiffsvolk vernehmlich zu machen.
Die Erfindung des Telefons hat dies von Grund auf geändert. Sie ermöglichte es, die Unterhaltung auf eine Entfernung von mehreren hundert Kilometern zu führen, ohne eine größere Anstrengung als das gewöhnliche Sprechen erfordert. So beträgt z. B. die durch das Telefon beherrschte Strecke zwischen München und Berlin 720 Kilometer, zwischen Paris und Marseille 1000 Kilometer. Sogar durch das Meer hindurch, wie auf der Strecke Paris-London, sind direkte Telephonlinien angelegt, und es haben sich auch hier der Uebertragung der menschlichen Stimme keine nennenswerthen Schwierigkeiten entgegengestellt.
Freilich ist die Art der Uebertragung beim Telephon eine ganz andere als bei der gewöhnlichen Uebertragung des Schalles. Sollte der Schall den Weg von Berlin nach München in der gewöhnlichen Fortpflanzungsweise der Töne zurücklegen, so würde – die Möglichkeit vorausgesetzt – nach dem Aufgeben des Gespräches ein Zeitraum von etwa 36 Minuten verstreichen, bis der erste Laut in München angelangt wäre. Der Berliner könnte dann mit Muße wieder an seine Arbeit gehen; denn wenn ihm München sofort antwortete, so könnte er doch erst nach Ablauf von einer Stunde und zwölf Minuten die Antwort erwarten.
Bei unserem jetzigen Fernsprechen aber setzen sich die zu übertragenden Tonwellen im Telephon in eine andere Energieform um, sie verwandeln sich in elektrische Schwingungen, und diese legen die weite Reise in der ganz unmerklich kurzen Zeit eines geringen Bruchtheiles einer Sekunde zurück.
Mit dieser Errungenschaft sind aber die Elektriker noch nicht zufrieden. Sie sagen sich, daß es doch recht fatal sei, von einem solch materiellen Drahte abhängig zu sein; es gilt, diesen überflüssig zu machen, frei soll die Bahn sein, nicht an Irdisches gebunden, so wie auf freier Bahn der Lichtstrahl durch das Weltall dringt. Und in der That hat man den Lichtstrahl zum Vermittler gewählt.
Schon seit längerer Zelt ist bekannt, daß das Licht eigenthümliche elektrische Erscheinungen hervorrufen kann. Als mit Hilfe des Mikrophones Preece es dahin gebracht hatte, das Laufen einer Fliege so laut vernehmbar zu machen, daß es dem Trampeln eines Pferdes auf einer Brücke glich, wurde er durch Smith weit übertroffen, der behauptete: „Ich kann etwas noch viel Wunderbareres erzählen, nämlich, daß ich mit Hilfe des Telephons einen Lichtstrahl auf eine Metallplatte fallen hörte.“
Diese äußerst merkwürdige Erscheinung wurde mit Hilfe einer Selenplatte wahrgenommen, und man benutzte dazu die eigenthümliche Fähigkeit des Selens, Lichtschwingungen in elektrische Schwingungen umwandeln zu können. Da die elektrischen Schwingungen sich aber unserem Gehör bemerkbar machen, so war die Grundlage der neuen Erfindung gegeben.
Vor etwa zwölf Jahren brachte Bell sein Photophon – eine Art Telephon, jedoch mit Selenplatte – von Amerika zu uns und machte schon damals darauf aufmerksam, daß jede Helligkeitsänderung sein Photophon zum Tönen bringe. Da er nun, sobald die Sonne auf das Photophon schien, in diesem Töne wahrnahm, die er sich durch irdischen Einfluß nicht erklären konnte, so nahm er an, daß die Veränderungen, die im Lichte der Sonne stattfinden, diese Töne hervorbringen müßten. Fortgesetzte Beobachtungen bestätigten die Vermuthung und machten den Zusammenhang der Töne mit den Sonnenflecken immer wahrscheinlicher.
Jetzt will Edison der Sache auf den Grund gehen und versuchen, die Sonnengeräusche deutlicher vernehmbar zu machen, die sich auf der Sonne abwickelnden großartigen Vorgänge zu verfolgen und somit die Sonne aus zwanzig Millionen Meilen Entfernung zu belauschen.
[801] Seinen Plan dürfen wir wohl nach dem Bericht eines amerikanischen wissenschaftlichen Blattes verrathen.
Edison besitzt in dem Staate New-Jersey einen natürlichen festen Block magnetischen Eisenerzes, der anderthalb Kilometer lang, dreißig Meter breit ist und bis zu einer unbekannten Tiefe in das Erdinnere hineinragt. Diesen großen Magnet will er mit einer geeigneten Zahl von Drahtwindungen umgeben, deren Enden in eine Art Telephon auslaufen. Der magnetische Block soll also den Kern des Telephons bilden, das mit Registrierapparaten versehen und mit Beobachtungsstellen ausgerüstet werden soll.
Vielleicht bringt Edisons Plan ganz neue Aufschlüsse über uns bis jetzt unbekannte und unerklärliche Erscheinungen in den kosmischen Vorgängen unseres Centralkörpers! Ob sich dann wohl Goethes Worte bestätigen werden:
„Horchet! horcht! dem Sturm der Horen!
Tönend wird für Geistesohren
Schon der neue Tag geboren.
Felsenthore knarren rasselnd,
Welch Getöse bringt das Licht!“
Ottilie Wildermuth. Eine litterarische Erscheinung, die sich im Wechsel der Zeiten zu behaupten weiß, die allen Veränderungen im Geschmack und in den Anschauungen zum Trotz fortfährt, ihre eifrige und zahlreiche Gemeinde zu versammeln, die hat den Beweis ihres inneren Werthes geliefert. Und das ist mit Ottilie Wildermuth der Fall. Nicht als ob die Zeitgenossen Ottilie Wildermuths an dem inneren Werth ihrer literarischen Schöpfungen gezweifelt hätten – nein, eine so einstimmige Verehrung hat selten eine Schriftstellerin genossen. Aber es ist doch schön, das Urtheil der Mitwelt, dem man leicht eine gewisse Befangenheit zutraut, durch das objektivere der Nachwelt bestätigt zu finden. So haben denn auch die „Gesammelten Werke“ Ottilie Wildermuths, welche ihre Tochter Adelheid gegenwärtig herausgiebt, eine gute Statt im deutschen Volke gefunden; die beiden bis jetzt erschienenen Bände, welche der unsern Lesern wohlbekannte Maler Fritz Bergen mit hübschen Bildern versehen hat, umfassen die „Bilder und Geschichten aus Schwaben“, kleine Skizzen in humorvoll erzählender Form, die den Typus urschwäbischen kleinstädtischen Lebens und Denkens mit all seinen Schwächen und wiederum mit all seinen liebenswürdigen Zügen so getreu verkörpern, wie dies eigentlich in keinem anderen Werke unserer Litteratur, auch der schwäbischen nicht, der Fall ist.
Während so die „Gesammelten Werke“ die Wildermuthschen Schöpfungen in immer weitere Kreise tragen, wirken auch ihre beiden Töchter Agnes Willms und Adelheid Wildermuth in dem Geiste der Mutter weiter, hauptsächlich durch die Fortführung des „Jugendgartens“, den einst Ottilie Wildermuth gegründet hat. Auch dieses Jahr liegt uns wieder ein stattlicher Band vor, mit Erzählungen, Märchen, Gedichten, geschichtlichen, biographischen, kulturgeschichtlichen, geographischen und naturwissenschaftlichen Aufsätzen, mit Räthseln, Knacknüssen, Spielen u. dergl., endlich mit trefflichen Bildern, darunter vielen farbigen, reichlich ausgestattet, eine Festgabe, die unserer Jugend gewiß nicht minder willkommen sein wird, als dem Alter die „Gesammelten Werke“ von Ottilie Wildermuth.
Die Ueberschwemmung. (zu dem Bilde Seite 792. und 793.)
„Kein Damm, kein Feld! Nur hier und dort
Bezeichnet ein Baum, ein Thurm den Ort.
Bedeckt ist alles mit Wasserschwall – –“
Diese Verse aus „Johanna Sebus“ kommen uns in Erinnerung beim Anblick unseres Bildes, das wir einem der hervorragendsten Landschaftsmaler der Gegenwart, dem Professor Fr. Kallmorgen in Karlsruhe, verdanken. Wie verlorene Inseln ragen fern ein paar Baumgruppen, ein vereinzeltes Haus aus der endlosen Fluth, und der Vordergrund zeigt uns deutlich die Spuren des verheerenden Elements. Glücklicherweise scheinen die Gewässer bereits im Zurückgehen begriffen zu sein, denn der Gartenzaun, welchen die anstürmenden Fluthen zum Theil niedergerissen haben, ist bereits wieder außer Wasser. Aber noch liegt eine Spur der ausgestandenen Angst auf den Gesichtern der Anwohner des entfesselten Stromes, und mit einer seltsamen Mischung von Angst und Neugier besprechen sie die Ereignisse der verflossenen Tage.
Das letzte Jahrzehnt hat dem Künstler leider häufig genug Gelegenheit zu Ueberschwemmungsstudien gegeben. Möge sie nicht so bald wiederkehren!
Die Liebhaberkünste. In Nr. 7 der von uns schon früher genannten Zeitschrift „Die Liebhaberkünste“ (München, Oldenbourg) vertheidigt Professor M. Haushofer die vielangegriffene Neigung zur dilettantischen Kunstübung mit folgenden Sätzen, die einer allgemeinen Beherzigung werth sind. „Die Liebhaberkünste sind eine berechtigte Reaktion gegen die weit gediehene Berufsgliederung der Gegenwart, der Mensch ist von Natur aus nicht zur einseitigen Berufsmaschine bestimmt. Jeder normale Mensch hat etwas vom Künstler, vom Erfinder, vom Konstrukteur in sich, weil in den Anfangszuständen der Kultur jeder diese Eigenschaften brauchte, sobald er sich über das Thier erheben wollte. . . . Wenn man bedenkt, wie fein und verwickelt der Mechanismus ist, den die Natur in unsere zehn Finger gelegt hat, so kann man es nur sehr beklagen das, so viele Menschen diesen leistungsfähigen Mechanismus völlig veröden lassen. Gegen diese Verwahrlosung der Handfertigkeit richten sich die Liebhaberkünste. Sie richten sich aber auch gegen die Vernachlässigung der Phantasie und der Erfindungsgabe, welche unbestreitbar unter die höchsten menschlichen Eigenschaften gehören. Aber wie wenig Berufsarten geben Gelegenheit, diese Eigenschaften berufsmäßig zu üben und auszubilden!“
Nachdem Haushofer nachgewiesen, daß gerade der Kaufmann, der Beamte, der Richter und viele andere eine glückliche Ergänzung ihres rein verstandesmäßigen Arbeitens in solcher Thätigkeit finden und ihre freien Stunden damit doch wohl fruchtbringender ausfüllen könnten als mit Skat oder Kegelspiel, entkräftet er zum Schlusse noch den Vorwurf der Stümperei mit der sehr berechtigten Bemerkung, daß jede Stümpernatur Stümperarbeit hervorbringt, ob dies nun in Berufsarbeiten oder in Liebhaberkünsten geschieht. „Nur ist’s bei ersteren bedenklich und gefährlich, bei letzteren harmlos. Damit aber die Liebhaberkünste keine Stümperarbeit liefern, verdienen sie, erzogen zu werden.“
Mit diesem Worte hat er sehr glücklich Richtung und Verdienst der neuen Zeitschrift gekennzeichnet. Ob sie Vorlagen zu Ofenschirmen, Thürfüllungen, Gläsern, Vasen und Tellern, zum Punzieren und Fournieren, zu Stickereien und zum Metalltreiben, zur Plastik aus Gummi, zur Verschönerung von alten Oefen und Verwendung von anscheinend unbrauchbaren Dingen geben – überall steht dabei die Mahnung, ordentlich zeichnen zu lernen, um nicht werthlose Spielereien statt erfreulicher Arbeiten zu liefern. Ein stark in Anspruch genommener Fragekasten giebt Aufschlüsse und Anregungen und dient als Sprechsaal der Abonnenten untereinander.
Wir sehen in der vortrefflich geleiteten Zeitschrift einen wahren
künstlerischen Hausfreund, den wir für die Weihnachtsarbeiten unseren Lesern
und Leserinnen nochmals bestens empfehlen möchten. Bn.
Pflügender Araber. (Zu dem Bilde S. 796.) Neidischen Blickes schauten viele Völker des Alterthums nach Aegypten hinüber – aber nicht die stolzen Bauten und nicht das in den Archiven des Reiches gesammelte [802] Wissen erregten damals den Neid, sondern das goldene Korn, das am heiligen Nil so reichlich gedieh. Sahen doch die Söhne Israels mit staunenden Blicken das Getreide an, welches Joseph vor ihnen ausbreitete, „über die Maßen viel, wie Sand am Meere“! Später war Aegypten eine der Kornkammern der Weltbeherrscherin Rom, und unter den drei Getreideflotten, welche die Stadt versorgten, der sicilischen, ägyptischen und pontischen, war die ägyptische die reichste und wichtigste.
Zwei Jahrtausende sind seit jenen Zeiten dahingerauscht, das Volk der alten Aegypter ist in der Flut anderer Völker untergegangen, die Götter, die Sitten und die Sprache der Vorväter sind den heutigen Aegyptern fremd, aber sie hängen wie diese an der Scholle und machen sie urbar just wie die fleißigen Ahnen vor fünftausend Jahren.
Wir stehen in der Ebene von Unterägypten in dem Ueberschwemmungsgebiet des Nils; scharf heben sich die Palmen von dem blauen Himmel ab und vor ihnen sehen wir den ägyptischen Bauer im Schweiße seines Angesichts das Feld bestellen. Ein Kamel und ein Ochse ziehen im Joche den Pflug, ein trauriges Geräth, das kaum drei bis vier Zoll tief in die Erde greift. Und doch ist ihm schon vor vielen tausend Jahren die Ehre der Abbildung zu theil geworden! Wir finden ihn schon unter den ägyptischen Hieroglyphen wo zwei Ochsen im Joch ihn wie heute noch an einer Deichsel bewegen. Er besteht aus zwei im spitzen Winkel vereinigten, einen Haken bildenden Hölzern. Das untere ist an der Spitze mit Eisen vorgeschuht und bildet die dürftige Pflugschar.
Wir würden jedoch irren, wenn wir annehmen wollten, daß alle Ackerbauer Aegyptens den Boden so bestellen wie der schlichte Bauer auf unserem Bilde. Aegypten giebt zwar noch heute Korn an andere Völker ab und viele Engländer leben von Brot, das aus ägyptischem Mehl gebacken wurde, aber seine Hauptausfuhr besteht heute in Spinnstoffen, in Baumwolle, und auf den Pflanzungen der Regierung und der großen Besitzer wühlt bereits seit Jahrzehnten der Dampfpflug den alten, vom Nil stets neu befruchteten Boden auf.
Der schlichte Mann Aegyptens aber geht noch jetzt hinter demselben einfachen Pfluge wie die Erbauer der Pyramiden und seufzt vielleicht noch mehr unter Fron und Lasten als die Unterthanen der Pharaonen.
Eine gefährliche Künstlerin. (Zu dem Bilde S. 788.) Von jeher haben die kunstreichen Werke der Spinnen die Aufmerksamkeit der Forscher wie der Laien aufs lebhafteste beschäftigt. Eine der verblüffendsten Leistungen ist wohl das Nest der in Spanien und im südlichen Frankreich vorkommenden Minierspinne (Cteniza fodiens), dessen Abbildung und Beschreibung wir dem soeben erschienenen 13. Jahrgang des „Neuen Universums“ entnehmen. Die Minierspinne bohrt sich eine runde Röhre etwa 10 cm oder tiefer in die Erde und tapeziert diesen Schacht mit einem feinen sammetartigen Gewebe aus. Hierauf baut sie von Erde einen Deckel, welcher genau auf das an seinem oberen Rande etwas schräg erweiterte Loch paßt. Die untere Seite des Deckels wird gleichfalls besponnen und dieses Gespinst mit dem in der Röhre in Verbindung gebracht, derartig, daß an dem Deckel ein Band als Scharnier angebracht wird. Dieses Scharnier ist kräftig genug, den aufgeklappten Deckel zu halten damit er nicht nach hinten über fällt.
Die Oberseite des Deckels ist nicht besponnen, sondern gleicht der die Röhre umgebenden Erde, so daß die Wohnung der Spinne nicht leicht aufzufinden ist. An seinem inneren Rande befinden sich viele Löcher, in welche das Thier die Krallen steckt, sich einhängt, um den Deckel geschlossen zu halten, wenn es sich in der Röhre befindet. Will die Spinne ein Insekt fangen, so öffnet sie den Deckel und schließt ihn, sobald ein unvorsichtiges Thier in die Falle gegangen ist, jedenfalls in der Weise, daß sie das Scharnier anzieht. Der Deckel soll so fest schließen, beziehungsweise von der Spinne so fest zugehalten werden, daß man Mühe hat, ihn mit Hilfe eines Messers zu öffnen.
Wir machen bei dieser Gelegenheit wieder auf das „Neue Universum“ aufmerksam, das auch in seinem neuesten Jahrgang eine Fülle von Anregung und Belehrung, insbesondere für die reifere Jugend, bietet.
Die „Amateur-Photographen.“ Die gewaltigen Fortschritte auf dem Gebiet der Photographie haben zur allgemeinen Verbreitung einer „Kunst“ geführt, die vordem nur von Zünftigen als Erwerb betrieben wurde. Die Einfachheit des Verfahrens, die Billigkeit der Apparate setzen jedermann instand, Lichtbilder anzufertigen, Augenblicksaufnahmen, die mit aller Schärfe und Naturtreue die flüchtigsten Erscheinungen im Bilde festhalten.
Besonders im Freien, in den Sommerfrischen, im Bade und am Strand sieht man den meuchlerischen Liebhaber-Photographen sein Handwerk treiben – wenn man ihn überhaupt erkennt! Denn die Apparate verrathen sich infolge ihres geringen Umfangs und ihrer unauffälligen Gestalt – man giebt der Camera die harmlose Form einer Cigarrenkiste, eines Buches u. s. w. – nur selten als das, was sie sind, und der „Momentverschluß“ setzt außerdem eine so kurze Expositionszeit voraus, daß wir, selbst bei einiger Achtsamkeit, ein paarmal hintereinander aufgenommen werden können, ohne es zu merken.
Das mag für den Amateur-Photographen recht hübsch sein und ihm zu einer interessanten Bildersammlung verhelfen, denn zu Hause lassen sich leicht saubere Kopien und Vergrößerungen anfertigen, – allein die Sache hat ihre Kehrseite.
Die Gelegenheit zu einem Mißbrauch, ja vielleicht zu einer frivolen Benutzung dieser neuen Kunstübung liegt nahe, und wenn es sich auch nur um die unfreiwillige Aufnahme etwa eines jungen Mädchenantlitzes handelte, das dem betreffenden Bilderfänger kein Porträt von sich schenken oder anvertrauen würde. Es kann sich dann jeder rühmen, ein Bild von der und der Dame zu besitzen, denn jeder Berufsphotograph kann nach einer solchen Vorlage ein Bild herstellen, dem nichts mehr anhaftet, was auf „Liebhaber“–Photographie schließen läßt.
Und dann – es giebt noch ernstere Fälle. Ich war in diesem Jahr auf der Waldquellen-Promenade in Marienbad Zeuge des folgenden Vorgangs: Ein junger Herr hatte neben zwei ihm bekannten Damen – Mutter und Tochter – infolge deren Aufforderung Platz genommen. Die Unterhaltung zwischen den Dreien war sehr belebt, als plötzlich der Arzt vorüberkam, der die Mama behandelte. Die Dame hatte ihm etwas zu sagen, es war ihr offenbar erwünscht, den vielbeschäftigten Mann wenigstens einige Minuten sprechen zu können, darum erhob sie sich rasch, um ihn anzuhalten.
In diesem Augenblick bemerkte ich einen „Liebhaber“-Photographen, allerdings einen sehr harmlosen Jüngling, welcher seinen Apparat gegen die auf der Bank Zurückgebliebenen richtete und die kleine Gruppe. Herr und Dame in heiterem Gespräch, ohne Zeugen, einsamer Waldhintergrund – auf seiner Platte festhielt. Dieser Fall zeigt ohne weitere Erläuterung, daß auf diese Weise sehr bedenkliche und verhängnißvolle Mißverständnisse entstehen können und daß hier eine Gefahr für den Ruf und den Frieden einzelner Personen und ganzer Familien drohen kann.
Man befindet sich – die geschilderte Scene ist nur ein Beispiel
dafür – hundertmal in Lagen, welche, in Wirklichkeit schnell
vorübergehend, nicht im entferntesten etwas Bedenkliches haben, die aber, im
Bilde verewigt, sehr verfänglich erscheinen können. Es entsteht daher die
ernste Frage, inwiefern sich ein anderer das Recht herausnehmen darf,
unsere Person zu photographieren ohne unser Wissen und ohne unsere
Zustimmung. Ist das nicht auch „Unfug“? Wer weiß, ob das künftige
Strafgesetzbuch, dort wo von persönlicher Freiheit und Sicherheit die Rede
ist, nicht auch einen Paragraphen enthalten wird, der sich gegen den
Mißbrauch der Amateur-Photographie richtet! P. v. S.
Eine Aeußerung Moltkes. Der fünfte Band der „Gesammelten Schriften und Denkwürdigkeiten“ des Grafen Hellmuth von Moltke (Berlin, Mittler und Sohn), welche eine so überaus reiche Ausbeute liefern für das Charakterbild des Mannes und für die Geschichte seiner Zeit, deren bedeutsamer Träger er gewesen, enthält die zweite Sammlung Briefe und Erinnerungen an ihn, Familienbriese, darunter das rührende Schreiben, in welchem er sich über den Tod seiner Gattin ausspricht, die ihm in der Fülle des Lebens, in Kraft und Schönheit dahingeschieden war. Doch auch gewichtige Briefe aus dem französischen Feldzug werden mitgetheilt, darunter einer vom 11. September 1870 aus Rheims, welcher eine sehr eindrucksvolle Wendung enthält: „Die Opfer,“ schreibt Moltke, „die der Krieg fordert, sind entsetzlich, und da wollen die Engländer uns mit Geld abgefunden wissen! So Gott will, sind wir binnen vierzehn Tagen in der Lage, 200 000 Mann jedem unberufenen Vermittler entgegenzustellen und mit dem Reste doch noch mit Frankreich fertig zu werden Die Leute haben noch nicht gelernt, was das sagen will, ‚Deutschland!‘, aber was das Wichtigste ist, Deutschland selbst hat es jetzt gelernt!“
Diese Aeußerung verdient unter die geflügelten Worte des deutschen
Volkes aufgenommen zu werden. †
Zur Geschichte des Dachziegels Der rothe Dachziegel ist der Vertreter einer Kulturepoche. Wo er so stolz und vornehm zwischen einfachen Stroh- und Schindeldächern die Häuser schützt und schmückt, da gilt er als ein Zeichen des Fortschritts. Im Osten Europas kann man ihm noch heute als einer erobernden Macht begegnen. In den Sitzen der Kultur sind ihm dagegen viele Nebenbuhler erwachsen, auf den Dächern der Großstädte erblickt man oft anderes Material: Schiefer, Zink, Pappe u. dgl.
Der Dachziegel ist aber nicht überall von derselben Form; denn er hat eine Geschichte, und im Laufe derselben wurde er von den Menschen umgemodelt.
Den alten Trojanern war er noch unbekannt, wenigstens hat Schliemann bei seinen Ausgrabungen in Ilios keine Dachziegel gefunden. Der älteste Dachziegel im Kreise der althellenischen Kultur stammt aus der Zeit um 1000 v. Chr., er wurde unter den Trümmern des Heratempels in Olympia gefunden. Er war ein Hohlziegel, wie wir ihn noch heute in Europa auf älteren Gebäuden sehen können. Die Hohlziegel bestehen aus leicht gewölbten Ziegelplatten; dort, wo diese sich mit ihren Längsseiten berühren, wird auf sie noch ein halbröhrenförmiger Ziegel gesetzt, der das Eindringen von Regenwasser in die Fugen verhindern soll. Die Ethnographen haben ihn den „Normaldachziegel“ genannt, da er allem Anschein nach die älteste Form darstellt. Er scheint in China erfunden worden zu sein und wird noch heute in Korea, China und Japan gebraucht; wie die Ausgrabungen lehren, war er auch der älteste Ziegel Westasiens, und von hier aus bürgerte er sich in den Mittelmeerländern ein. Bemerkenswerth ist es, daß die Japaner ihn „hongavara“, d. h. den „echten“ Dachziegel, nennen.
Im Laufe der Zeit versuchten die Menschen, die zwei Stücke des Hohlziegels zu einem Ganzen zu verschmelzen, und bildeten den sogenannten „Pfannenziegel“, dessen Durchschnitt die Form eines liegenden lateinischen S hat (∾). Die Geburtsstätte dieser Neuerung waren die Niederlande, von wo sie sich nach Skandinavien und England, sowie nach Nordwestdeutschland bis Pommern ausbreitete. Andererseits hat man den Dachziegel vereinfacht, ihn der Holzschindel ähnlich gestaltet, und so entstand die dritte Form, der einfache, flache Ziegel mit einer Nase am hinteren Ende zum Aufhängen an den Latten des Dachstuhls.
Der amerikanische Forscher E. Morse, der mit besonderem Eifer die
Geschichte des Dachziegels studierte, bemerkt, daß diese drei Formen auch
in Nordamerika auf Dächern alter Häuser vorkommen und andeuten, von
wem die einzelnen Gebiete zuerst besiedelt wurden. In Kalifornien, in
dem sich zuerst Spanier niederließen, ist der Normaldachziegel wie am
Mittelmeer zu finden, am Delawarefluß, an dem die Holländer als erste
Ansiedler auftraten, deckt der Pfannendachziegel die alten Häuser und in
Pennsylvanien, das den deutschen Einwanderern so viel verdankt, wiegt
auf alten Gebäuden der flache Dachziegel vor.*
[803]
Bernhard Windscheid †. (Mit Bildniß.) Der Tod hält eine
rasche Ernte unter den großen deutschen Rechtslehrern! Erst vor kurzem
hat er Jhering dahingerafft, jetzt ist ihm auch Bernhard Windscheid zum
Opfer gefallen, der unter allen deutschen Juristen wohl den höchsten Ruf
und die weitreichendste Bedeutung besaß. Keiner hat wohl je eine solch
gewaltige Hörerzahl um sich versammelt, und auf den deutschen Hochschulen
dürfte es wenige Studierende der Rechte, an den deutschen Gerichtshöfen
wenig Beamte geben, deren Bücherschatz nicht Windscheids
„Lehrbuch des Pandektenrechts“ als grundlegenden Bestandtheil aufwiese.
Unmittelbar für das ganze deutsche Volk aber hat er gewirkt als einer
der hervorragendsten Mitarbeiter an dem Entwurfe des bürgerlichen
Gesetzbuches für das Deutsche Reich.
Windscheid ist nur wenig älter geworden als Jhering. Geboren am 26. Juni 1817 zu Düsseldorf, hat er ein Alter von 75 Jahren erreicht. Auch er hat in seinen jüngeren Tagen ein Stück jenes Nomadenlebens erfahren, das die deutschen Gelehrten, und am meisten gerade die bedeutenden, von Hochschule zu Hochschule zu führen pflegt. Am Schlusse seines Lebens aber war ihm doch eine größere Seßhaftigkeit beschieden, denn die achtzehn letzten Jahre hat er der Leipziger Universität angehört.
Wohl ging schon einige Zeit von Semester zu Semester das Gerücht, Windscheid werde um seiner erschütterten Gesundheit willen seine Lehrthätigkeit einstellen. Aber immer wieder erschien er mit unbesieglicher Spannkraft auf seinem Lehrstuhl – nur diesmal sollte er ihn nicht wieder betreten. Am 26. Oktober, eben in den Tagen, da seine Schüler sich wieder in der Musenstadt sammelten, schloß der Tod sein klug leuchtendes Auge und seinen beredten Mund.
Kalte Füße. Der Wintersanfang bringt vielen Menschen ein unangenehmes „Leiden“, von
welchem sie im Sommer verschont blieben: die kalten Füße. Sie sind höchst unangenehm, namentlich für denjenigen, der sitzend arbeiten muß, der an die Arbeitsstube daheim oder an das Bureau
gefesselt ist. Filz und Pelzschuhe, Strümpfewechsel, Schlagen der Füße mit Holzbrettchen oder
Gummigeißeln nützen oft nicht oder nur vorübergehend. Und doch ist es für gesunde Menschen sehr leicht, das lästige Leiden gründlich zu heilen. Der Fuß rächt sich durch sein Kaltwerden für die Vernachlässigung, die ihm widerfährt. Auch er hat das Recht, gepflegt zu werden wie die Hand. Und in der That, die Erfahrung lehrt, daß bei sonst gesunden Menschen die kalten Füße schwinden, wenn man regelmäßige Fußwaschungen vornimmt. Es ist dabei gleichgültig, ob man kaltes oder warmes
Wasser anwendet, nur muß man darauf sehen, daß der Fuß gut abgetrocknet und kräftig abgerieben
wird. Aber der Fuß steckt in Strumpf und Schuh; die Leute sehen ihn nicht, und so wird der Strumpf gewaschen und der Stiefel gewichst, aber dem Fuße selbst eine entsprechende
Wohlthat bei so vielen Menschen nur bei der Generalreinigung des
Körpers, beim Bade, zu theil. Kein Wunder, daß er bei einer solchen
Behandlung kalt wird! *
„Gesammelte Dichtungen“ von Eduard Paulus. Es ist ein schwäbischer Dichter, der in diesem Buche die Summe dessen bietet, was in beinahe vier Jahrzehnten sich dichterisch in ihm formte, und schwäbische Eigenart spricht aus der Fülle seiner Lieder: eine knorrige und doch wieder wunderbar innige Ausgestaltung des eigenen Erlebens, der ganzen Persönlichkeit, ein vertrautes Leben mit der heimathlichen Natur, ein träumerisches Schauen in Vergangenheit und Zukunft des deutschen Volkes, während zugleich die Gegenwart in scharfe Beleuchtung tritt, ein handfester Humor, nicht zum letzten ein Widerwille gegen alle Schreier, gegen alles, was unecht ist. Bei Paulus hat man das wohlthuende Gefühl, um so wohlthuender, je seltener es einem sonst zu theil wird, daß hier in kraftvoller Natur ursprüngliche Poesie und ursprünglicher Gedanke sich verbunden haben, um ohne Rücksicht auf die Mode zu schaffen, was sie schaffen mußten. Deshalb ist er so fern jeder Schablone, von so ungewollter Besonderheit, und deshalb ist der Versuch so müßig, den Dichter und sein Können, den Menschen und seine „Weltanschauung“ fein säuberlich in irgend ein Schema einzuordnen. Unmittelbar wie diese Lieder geworden sind, müssen wir sie genießen.
Aus der Menge dessen, was aus den Blättern des Buches zum Herzen drängt, sei ein Sonett herausgehoben, das ebenso charakteristisch ist für die Heimathliebe des Dichters wie für die tiefe Art, mit der er im groß geschauten Naturbild sein eigenes Erleben spiegelt.
„Ihr Berge meiner Heimath, sanft und mild,
Ihr schmeichelt euch in meine Seele wieder,
Erweckt in ihr des Wohllauts Traumgefieder,
Daß mir die Thräne übers Auge rinnt.
Sah ich zu Euch vom Waldesrande nieder,
Ich kann mich nicht ersättigen, immer wieder
Hängt mir der Blick an eurem zarten Bild.
Nicht kühngezackt, in weicher Schwingung ziehn
Bis sie ins fernste Himmelslicht verthauen.
So ging auch meiner Seele längst dahin
Der Erde Kampf, und dieses Lebens Grenze
Verschwimmt mir sanft in einem ew’gen Lenze.“
Volksbibliotheken. In vielen größeren Städten wird durch Volksbibliotheken für das Lesebedürfniß und die geistige Fortbildung der ärmeren Klassen gesorgt, und es ist keine Frage, daß bei einer einsichtigen Auswahl des Lesestoffs durch diese Einrichtung eine sehr gute Wirkung auf Geist und Herz des Volks ausgeübt werden kann. Doch hat man neuerdings in der Reichshauptstadt die Erfahrung gemacht, daß gegen früher ein Rückgang in der Zahl der Leser und der ausgeliehenen Bände eingetreten ist.
Das Verhältniß wird noch ungünstiger, wenn man das jährliche Wachsthum der Bevölkerungszahl Berlins mit in Anschlag bringt. Im ganzen wurde jedes Buch nur dreimal ausgeliehen. Die Gründe mögen verschiedener Art sein. Eine der Ursachen finden wir in dem Bericht über die Gemeindeverwaltung der Stadt Berlin in den Jahren 1882 bis 1888 angegeben; es heißt dort, daß die Ergänzung einzelner Bibliotheken, nachdem in den letzten Jahren auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaften und der Technik so große und so schnelle Fortschritte gemacht worden seien, mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten konnte, so daß dem Publikum theilweise nur ein weniger werthvolles Material zur Verfügung gestellt wurde. Hier ist immerhin zu bemerken, daß es an neueren zusammenfassenden Werken nicht fehlt, deren Kaufpreis den Etat der Bibliotheken nicht übermäßig belasten würde.
Günstiger stellt sich die Lage der Volksbibliotheken in Dresden und Wien dar. Die neun, welche der „Gemeinnützige Verein“ in Dresden gegründet hat, haben einen Bücherbestand von 25201 Bänden und gaben 1890 122000 Bände an 8124 eingeschriebene Leser aus, also jeden Band etwa fünfmal. Die Volksbibliothek des niederösterreichischen Volksbildungsvereins (Zweig Wien und Umgebung) in Semmering bei Wien lieh 1890 bei einem Bestande von 2183 Büchern 26839 Bände aus, also jeden Band dreizehnmal. Der Wiener Volksbibliothekverein gab seinen Bücherbestand von 8453 Bänden 1890 achtmal aus, nämlich 65144 Bände. Und endlich eine Bonner Bibliothek von 8482 Bänden gab 1890 72914 Bande aus.
Jedenfalls sollten alle größeren Städte diese Einrichtung, welche dem Volkswohl in hohem Maße dient, eifrig pflegen, die dafür ausgeworfenen Summen möglichst erhöhen und die Auswahl der Bücher durch umsichtige und vorurtheilsfreie Männer besorgen lassen; doch auch unter den Ausgaben der kleineren Städte sollte der Posten für Volksbibliotheken nicht fehlen.
Es wäre vielleicht vortheilhaft, wenn die
gesammte für Volksbibliotheken geeignete Litteratur
alljährlich von einem leitenden Ausschuß
zusammengestellt und das Verzeichniß, bei dem die
wichtigsten und empfehlenswerthesten Werke in erster
Linie stehen, den Verwaltungen besonders der
kleineren Städte eingesendet würde, denn der
Sinn für das wahrhaft Volksthümliche, für das,
was sowohl gemeinnützig ist wie auch Geist und Geschmack bildet,
ferner eine ausgebreitete Litteraturkenntniß ist nicht überall zu finden.
Möchten diese Zeilen da und dort einen günstigen Boden finden: auch
mit bescheidenen Mitteln läßt sich in dieser Sache Gutes erreichen. †
Kleiner Briefkasten.
Anfrage. Gibt es einen Verein, der für die hinterbliebenen Söhne oder Töchter seiner verstorbenen Mitglieder Stellen vermittelt?
Alte Abonnentin! Wie oft müssen wir noch wiederholen, daß wir in ärztlichen Dingen keinen Rath ertheilen können!
A. U. in Leipzig. ad 1) Haben zwei Mitspieler im Skate beim Ramschspiel gleichviel Augen, aber mehr als der dritte erhalten, so haben beide das Spiel verloren und hat jeder derselben den vollen Betrag (10 Points) an jeden der übrigen Theilnehmer zu zahlen; ad 2) Ihr Freund hat ganz recht. In den Zirkeln der meisten Studentenverbindungen sind die Buchstaben V. F. C. als Anfangsbuchstaben von „Vivat floreat crescat“, sowie noch der Anfangsbuchstabe des Namens der betreffenden Verbindung enthalten.
F. F. in F. und H. in Essen. Leider nicht verwendbar!
Georg ? Westerland, Sylt Geben Sie uns Ihre Adresse in leserlicher Handschrift an, damit wir Ihnen brieflich antworten können.
V. Z. in D. Ein sehr geeignetes Hilfsmittel, um Ihren kleinen Jungen in die Geheimnisse des Multiplizierens einzuführen, ist der „Kleine Rechenmeister“ (Hermann Hucke, Leipzig). Dieser sinnreiche, in Form eines Heftes hergestellte Apparat ist in drei Ausgaben zu haben, wovon die erste die Multiplikationen im Zahlenraum 1 bis 10, die dritte diejenigen im Zahlenraum 11 bis 20 umfasst; die zweite Ausgabe ist eine Vereinigung der beiden andern. Die deutliche Anschauung, welche die Kinder hier durch eine einfache mechanische Vorrichtung von der „verborgenen“ Weisheit des Einmaleins erhalten, wird wohl auch in diesem Fall bald zu einem befriedigenden Ergebniß führen.
Abonennt in Russisch-Polen. Wir warnen Sie entschieden vor diesem Buche. Wenden Sie sich an einen Arzt.
H. O. in Stralsund. Die Tantiemen, welche die Theater an die Verfasser von aufgeführten Dramen bezahlen, bewegen sich in weiten Grenzen. Es kommt eben auf die besondere Abmachung im einzelnen Falle an. Eine Kontrolle über die Aufführung eines bestimmten Stückes kann ein einzelner schwerlich ausüben; die deutsche Genossenschaft dramatischer Autoren zu Leipzig übernimmt diese Aufgabe für ihre Mitglieder, auch gibt es besondere Agenten für diesen Zweck.
K. in N. Kann zu unserm Bedauern nicht verwendet werden.
K. H. in Königsberg. Leider nicht für die „Gartenlaube“ geeignet.
M. B. in Washington. Das Zündnadelgewehr wurde 1841 in die preußische Armee eingeführt.
W. H. in Dresden. Ihre Begeisterung ist sehr erfreulich – Ihre Gedichte? Nun, bei der Abfassung war wohl die Muse mit Urlaub abwesend.
Tambour in St. Am sonderbarsten dürften wohl die Holzschuh-Rennen sein. Im Bergischen und Westfälischen bestehen Vereine, welche als eine Art Sport die Schnellläuferei mit Holzschuhen betreiben. Der Holzschuh in seiner in den Niederlanden und am Niederrhein üblichen botartigen Form unter dem Namen Klompen oder Klumpen bekannt, ist ein Hemmschuh für rasche Fortbewegung und das Laufen darin schwerfällig und unbeholfen. Ein Rennen in Holzschuhen, zumal mit den üblichen Hindernissen, erfordert daher große Uebung und außergewöhnliche Muskelanstrengung; nur kräftige junge Leute und starke Landjungfern – denn auch die „Damenwelt“ betheiligt sich an diesem Vergnügen – können den Wettlauf aufnehmen, der einen höchst komischen Eindruck macht. Eine verfeinerte Art des Rennens ist das „Zügelrennen“, wobei die Füße der Renner nur lose in den Holzschuhen stecken, die mit einer Art Zügel straff angezogen werden müssen.
[804]
Die Buchstaben dieser Figur sind so zu ordnen, daß die schrägen Reihen, welche fünf Felder zählen, von links oben nach rechts unten und von links unten nach rechts oben gelesen, Wörter von folgender Bedeutung ergeben: 1. ein deutscher Philosoph, 2. eine Rolle aus Goethes „Jphigenie auf Tauris“, 3. männlicher Vorname, 4. ein Strom in Asien, 5. ein Strom in Afrika, 6. ein Fluß in Frankreich, 7. eine Blume, 8. ein deutsches Land. – Ist Alles richtig gefunden, so nennt die mittelste wagerechte Reihe ein werthvolles Metall.
A, B, C und D nehmen je sieben Steine auf. C hat auf seinen Steinen 24 Augen mehr als B, aber 2 Augen weniger als D.
A setzt Drei-Sechs aus und gewinnt dadurch, daß er die Partie bei der fünften Runde mit Vier-Drei an Vier sperrt. Es paßt kein Spieler außer B, der keinen Stein ansetzen kann. Die Steine der ersten Runde haben 32, die der zweiten 18, die der dritten 23 und die der vierten 12 Augen. Doppelsteine setzt nur C und zwar in den drei ersten Runden. C behält auf seinen Steinen 18 und D auf seinen 25 Augen übrig.
Welche Steine behält A übrig? Welche Steine setzten C und D? Wie war der Gang der Partie?
Ein Citat aus Ernst v. Wildenbruchs Drama „Die Quitzows“ besteht aus zehn Wörtern, welche der Reihe nach in untenstehenden zehn Citaten enthalten sind:
1. Wer keine Neigung fühlt, dem mangelt
Es an einem Worte der Entschuldigung nie. IV. 2.
2. Die Göttin übergab dich meinen Händen. I. 3.
3. Kein kluger Streiter hält den Feind gering. V. 3.
4. Frei athmen macht das Leben nicht allein. I. 2.
5. Liebt oder haßt einander, wie ihr wollt. II. 3.
6. Kann uns zum Vaterland die Fremde werden? I. 2.
7. Was man Verruchten thut, wird nicht gesegnet. I. 3.
8. Ich habe dir mein tiefstes Herz entdeckt. I. 3.
9. Dich, armer Freund, muß ich bedauern. III. 3.
10. Das Leben lehrt uns, weniger mit uns
Und andern strenge sein. IV. 4.
Das fünfte dieser Citate ist Schillers „Wallensteins Tod“ entnommen, alle übrigen stammen aus Goethes „Jphigenie auf Tauris“. A. St.
Von den 49 Zahlen dieses Quadrats sind 24 zu streichen, so daß die Summe der 25 übrigbleibenden Zahlen 1892 beträgt. Jede der drei Zahlen 98, 61 und 51 ist wenigstens einmal zu streichen und muß mindestens einmal stehen bleiben. Wie oft ist jede der drei Zahlen 98, 61 und 51 zu streichen?
Bora, Kinn, Dorn, Reis, Ritter, Eid, Regel, Fugen, Haufe, Hebel, Wahl, Messe, Gericht, Kaste, Mitte, Ende, Dahn, Brigg, Urahn, Art, Wende, Hela, Erbe, Heil, Bart, Bogen, Nase.
Mit Ausnahme von vier Homonymen ist aus jedem der obigen Wörter durch Veränderung eines Buchstabens ein neues Wort zu bilden. Die bei der Verwandlung fortgelassenen und auch die bei derselben neu aufgenommenen Buchstaben (letztere rückwärts gelesen) ergeben nach richtiger Lösung je ein deutsches Sprüchwort.
Läßt Geistesgegenwart dich im Stich,
Land, Aula, Begas, Seher, Reich, Else, Eli, Magen, Teig, Nero, Kabel, Grad. – „Das Rheingold.“
Alte, Alt, Halt, Hals, Hans, Hand, Land, lind, Lied, Lieb, Liebe, lieben, leben, lesen, Wesen, weisen, Eisen, Essen, Hessen, hassen, hasten, Kasten, kosten, rosten, rostet, rosten, Rosen, Rose, Rost, Rast, Last, List, Licht, nicht.
In unserem Verlag erschien soeben im Anschluß an die in den Jahren 1890 und 1891 herausgegebenen beiden ersten Jahrgänge als dritter in der Reihe der
Mit sechs Kunstbeilagen. In rosa Seide mit reicher Goldpressung und Goldschnitt gebunden. Preis 6 Mark.
Eine große Anzahl der gefeiertsten Dichternamen ist in dem Musen-Almanach für 1893 vertreten. Derselbe enthält u. a. eine humoristische Erzählung von M. v. Ebner-Eschenbach: „Fräulein Susannens Weihnachtsabend“, eine Novelle von Max Haushofer: „Der Floßmeister“, eine Erzählung in Versen von Otto Roquette: „Gulnare“, und bringt poetische Beiträge von Fr. Bodenstedt, Felix Dahn, Ernst Eckstein, J. G. Fischer, A. Fitger, Ludwig Fulda, Rudolf von Gottschall, Martin Greif, R. Graf Hoyos, W. Jensen, H. Lingg, E. Rittershaus, A. F. Graf von Schack. G. Scherer, Prinz Emil zu Schönaich-Carolath, Carl Weitbrecht, J. V. Widmann, Adolf Wilbrandt u. a.
Bilder von A. Achenbach, R. Beyschlag. F. Bodenmüller, C. Hoff, G. v. Hößlin und W. Kray sind als Kunstbeilagen beigegeben.
Der „Cotta’sche Musen-Almanach“ bildet ein feinsinniges Festgeschenk für jeden Gebildeten und macht in seinem hocheleganten, eigenartigen Einband schon äußerlich einen festlichen Eindruck. Die Jahrgänge 1891 und 1892 sind zum Preise von je 6 Mark ebenfalls noch zu haben.
- ↑ Siehe Dr. Sendtner, „Bayer. Industrie- und Gewerbeblatt“ 1887.