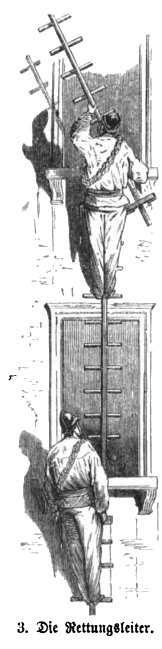Die Gartenlaube (1864)/Heft 46
Vor Kurzem las ich in der Zeitung, daß zu Freiburg im Uechtlande – in der Schweiz – die Gebeine des im Jahre 1597 dort gestorbenen Jesuitenpaters Canisius aus dem Grabe genommen seien,[1] um nach Rom gebracht zu werden, wo die Heiligsprechung des Paters erfolgen sollte.
Da fiel mir eine alte Geschichte wieder ein. Ich war von meinem Vater zum Juristen bestimmt. Seit fast zweihundert Jahren war der älteste Sohn der Familie immer ein Rechtsgelehrter gewesen; mein Vater war es so geworden, und so sollte auch ich als sein ältester Sohn es werden. Ich war unglücklich darüber, denn ich wollte Soldat werden, da wir in der Zeit der Befreiungskriege lebten. Mein Wunsch war ein thörichter; ich war kaum vierzehn Jahre alt und ein schmächtiger Knabe, der die Strapazen des Exercirens und Marschirens keine vierzehn Tage hätte aushalten können; ich war nicht von Adel – doch das war damals Nebensache. Ich wandte mich um Rath und Hülfe an meinen Onkel und fand bei ihm Rath, freilich keine Hülfe.
„Dein Schicksal ist nun einmal, Jurist zu werden,“ sagte er in seiner halb scherzenden und halb ernsten Weise, „und seinem Schicksale kann Niemand entgehen. Auch ich konnte es nicht, und meinst Du, ich wäre mit Freuden geworden, was ich werden sollte und was ich doch nun mit Liebe und mit Freude bin?“
Mein Oheim war Geistlicher, katholischer Geistlicher. Wie die ersten Söhne in unserer Familie hatten Juristen werden müssen, so mußten die dritten sich dem geistlichen Stande widmen. Er war der dritte Sohn gewesen.
„Ich war ein lebenslustiger junger Mann,“ fuhr er fort. „Ich ritt und focht und tanzte lieber, als ich die Kirchenväter studirte und später das Brevier. Aber der Wille meines Vaters war ein eiserner. Man hatte mir schon, als ich noch in der Wiege lag, bei dem Collegiatstifte eine Vicarie gekauft; sie mußte mich zum Canonicate führen, und als Canonicus war ich ein gemachter Mann. Ein zufriedener Mann wurde ich schon früher, und dazu trug sehr viel ein Abenteuer bei, das ich einst erlebte. Laß es Dir erzählen, auch zu Deinem Nutz und Frommen.“
Und mein Oheim erzählte nun Folgendes:
Ich hatte die Weihe empfangen und meine Vicarie übernommen. Tanten, Vettern und Basen wünschten mir Glück; meine Freunde bedauerten mich im Stillen; mein Vater gab mir ein paar hundert Thaler.
„Reise, sieh Dich in der Welt um; zerstreue Dich und komm zufriedener zurück,“ sprach er.
Ich reiste. Mein Vater hatte mir keinen Weg und kein Ziel vorgeschrieben. Ich konnte gehen, wie ich wollte; ich konnte ausbleiben, so lange mein Geld vorhielt. Ich reiste durch Westphalen, durch die Niederlande – viel weiter kam ich nicht. In Antwerpen hatte ich jenes Abenteuer, von dem ich Dir erzählen will. Ich hatte in Harlem das gewöhnliche Postschiff bestiegen, das nach Antwerpen fuhr. Es ging des Morgens sehr früh ab; es sollte, bei günstigem Winde, noch an demselben Tage bei Zeiten in Antwerpen ankommen. Der Wind stand ziemlich günstig. Ich war einer der Letzten auf dem Schiff, dessen wenige Passagiere sich bei dem schönen Maimorgen sämmtlich auf dem Verdecke befanden, alte, steife, holländische Kaufleute; junge Commis, die noch steifer waren als die Alten; eine hübsche junge Frau mit einem Kinde, die vom Lande zu sein schien. Der Capitain wollte die Anker lichten lassen. Er sah noch einmal nach dem Lande, da hielt er sein Commando zurück. Vom Ufer stieß ein kleines Boot ab und ruderte auf das Schiff zu. Auf der Bank in dem Boote saß eine schwarze Gestalt; es schien eine Frau zu sein. Das Boot kam näher, es war eine in schwarze Seide gekleidete Dame, die darin saß. Sie war allein und hatte am Ufer von Niemandem Abschied genommen; ich entdeckte auch kein Auge, das ihr nachgesehen hätte.
Das Boot erreichte das Schiff; die Frau stieg aus. Eine große, schöne, volle Gestalt trat auf das Verdeck mit edler, stolzer Haltung, mit jugendlichen, elastischen Bewegungen. Ihr Gesicht sah man nicht; ein dichter, schwarzer Schleier bedeckte es. Gepäck führte sie nicht bei sich; sie trug nur im Arm eine kleine Cassette von Ebenholz mit silbernem Beschlag und silbernem Schloß. Ihre Erscheinung hatte etwas Imponirendes, für mich zugleich etwas Geheimnißvolles; ich wußte selbst nicht, warum. Die steifen Holländer sahen sie kaum an; dann sprachen sie weiter von ihren Handelsgeschäften. Sie suchte einen Platz auf dem Verdeck, um sich niederzulassen. Nach den Holländern blickte auch sie kaum. Auch an mir schien ihr Blick unter dem schwarzen Schleier leicht vorüberzugleiten. Sie nahm in der Nähe der Frau mit dem Kinde Platz, die bisher allein gesessen hatte. Die fremde Dame mit der schönen Gestalt, der stolzen Haltung, den jugendlichen Bewegungen war mir interessant geworden. Langsam, auf Umwegen, wie zufällig, wußte ich mich in ihre Nähe zu bringen. Sie war unterdeß dichter zu der Frau mit dem Kinde heran gerückt und schien letzteres mit Theilnahme zu betrachten. Es war ein hübsches, frisches, wohlgenährtes Kind, weiß und roth, wie echt holländische Milch und echt holländisches Blut.
„Ist es Ihr Kind?“ fragte die Dame die Frau.
Das war eine wunderbare Stimme, mit der sie die paar Worte sprach; ein zitternder Ton, der eine innere Bewegung anzeigte, aber so rein, so voll, so weich, daß er mir tief in das Herz drang und ich meinte, er müsse jedes Herz, das ihn höre, erbeben machen.
[722] „Ja, mi Frou!“ erwiderte die Holländerin.
„Wie alt ist es?“
„Anderthalb Jahr, mi Frou!“
„Es ist ein Mädchen?“
„Ja, mi Frou!“
„Es ist ein hübsches Kind!“
„Ja, mi Frou!“
Die Dame fragte die Frau nicht mehr. Sie sah auch nach dem Kinde nicht mehr. Sollen wir uns für ein kleines Kind interessiren – ein wenig Interesse muß uns auch die Mutter einflößen; selbst die Frauen fühlen so. Sie wandte den Blick ganz von dem Verdeck weg, auf die See, nach dem Lande hin. Es ist eine langweilige Fahrt der holländischen Küste entlang; man sieht nichts, als die niedrigen, kahlen Sanddünen, hin und wider die grauen Flügel einer Windmühle. Man muß viel Sehnsucht im Herzen tragen, um nach solchen Gegenständen mit Sehnsucht blicken zu können. Die Dame hatte wohl nicht das Eine, und konnte daher nicht das Andere. Sie wandte sich um, nach der Seeseite, wo ich stand. Ihr Blick mußte mich streifen. Sie schien in dem nämlichen Augenblicke zu stutzen und sah über das Wasser hin; dann kehrten ihre Augen zu mir zurück. Ich konnte die Augen nicht sehen, der Schleier hing noch immer über ihrem Gesicht; aber die Haltung des Kopfes ließ mir keinen Zweifel, daß sie mich betrachte. Warum, zumal da sie mich schon vorher gesehen hatte, ohne daß ich ihr aufgefallen war? Ich konnte es nicht errathen. Sie sah darauf eine Weile vor sich hin; sie schien über etwas nachzudenken. Dann stand sie auf und trat rasch zu mir.
„Sie sind Geistlicher?“ fragte sie mich rasch in französischer Sprache.
Ich trug gewöhnliche weltliche Kleidung ohne irgend eine Ab- oder Auszeichnung. Aber jetzt, da ich hinter ihr stand, hatte ich einen Augenblick meinen Hut abgenommen, und sie hatte meine Tonsur wahrnehmen können.
„Ja, Madame,“ antwortete ich ihr.
„Und Sie reisen nach –?“ fragte sie weiter.
„Nach Antwerpen.“
„Mein Herr, eine Bitte.“
„Befehlen Sie, Madame.“
„Folgen Sie mir in die Cajüte. Aber nicht sogleich. Nach einer Viertelstunde etwa. Und – wenn wir dort allein sind, nahen Sie sich mir. Ist ein Dritter anwesend, so bin ich nicht für Sie da.“
„Ich werde Ihnen folgen, Madame, und auch Ihrer Anweisung.“
Sie kehrte zu dem Platze zurück, auf dem sie gesessen hatte, und sah noch eine Zeit lang über das Wasser hinüber; dann erhob sie sich wieder und ging mit ihrem leichten und doch so stolzen Schritt zu der Cajüte. Sie entschwand meinen Augen, wie sie die Treppe hinunterstieg. Sie hatte leise, rasch, kurz abgebrochen mit mir geredet. Sie hatte sich umgesehen, ob einer der Anwesenden auf uns achte; Niemand aber hatte nach uns hingeblickt; auch die holländische Frau nicht, die gerade mit ihrem Kinde beschäftigt war. Was sie von mir, dem Geistlichen, wollte? Was sie war? Diese Fragen kehrten mir immer und immer wieder. Und auch, ich leugne es nicht, ich war ein junger Mensch, meine fünfundzwanzig Jahre alt – war sie jung? war sie schön? – Aber ich mußte es ja erfahren, das Eine wie das Andere, noch mehr von ihr. Sie hatte mir sogar etwas anzuvertrauen. Die Viertelstunde war verflossen. Ich ging in die Cajüte. Sie war allein darin und saß hinten an der Wand auf einer Bank in tiefem Nachsinnen; sie war noch verschleiert und hatte den Kopf in die Hand gestützt. Bei meinem Eintreten sah sie leicht auf, dann wieder vor sich nieder, dann winkte sie mit der Hand nach einem Feldstuhle, der zur Seite stand.
„Setzen Sie sich mir gegenüber.“
Ihre Stimme klang so besonders weich. Ich nahm den Stuhl und setzte mich ihr gegenüber.
„Sie sind ein Deutscher?“ fragte sie mich.
„Ja, Madame.“
„So sprechen wir deutsch.“
Wir hatten bisher französisch miteinander gesprochen. Das Letzte sagte sie in deutscher Sprache, und in dieser redeten wir weiter. Aber ehe sie wieder begann, schlug sie den Schleier zurück. Nie hatte ich bis dahin, nie habe ich seitdem ein schöneres Gesicht gesehen. Das waren die vollendetsten Formen, die edelsten Züge, Alles in der Frische, in dem Glanz und in dem Schmelz der Jugend. Aber es lag kein Friede auf diesem schönen Gesichte. Sie hatte den Schleier aufgeschlagen, um ihre Augen zu trocknen, sie hatte geweint. Schwere Thränen hingen noch an den langen, dunklen, seidenen Wimpern. Sie trocknete sie, die Augen blieben feucht; ihr Glanz war desto bezaubernder.
Sie sah mich ein paar Momente nachdenkend an, um, wie es schien in meinem Gesichte, in meinen Augen lesen zu wollen, nochmals, klarer, deutlicher, als durch den dichten, schwarzen Schleier, ob sie mir das sagen dürfe, was sie mir zu sagen habe.
„Haben Sie gern diese Tonsur genommen?“ fragte sie dann.
Es war eine sonderbare Frage. Ich antwortete ausweichend: „Ich war von früher Jugend an mit dem Gedanken vertraut, Geistlicher zu werden.“
„Ah, also mußten Sie es werden!“
Ich schwieg. Sie verließ den Gegenstand.
„Waren Sie schon früher in Antwerpen?“ fragte sie.
„Nein.“
„Werden Sie längere Zeit dableiben?“
„Ein paar Tage, denke ich.“
„Im Gasthofe?“
„Ich werde in einem Gasthof einkehren.“
„Mein Herr, darf ich Sie dahin begleiten?“
Ich mußte sie doch darauf ansehen. Sie konnte eine Abenteurerin sein, trotz alledem, und ich war ein Geistlicher, hielt sonst auf meine Ehre und auf meinen Namen. Sie sah meine Zweifel. Eine Aeußerung tiefer Betrübniß zeigte sich in ihrem Gesichte, in den schönen edlen Zügen, in den feuchten, glänzenden, bezaubernden Augen.
„O, mein Herr,“ sagte sie mit ihrer weichen, in das Herz dringenden Stimme, „das ist die schwerste Last des Unglücks, daß man ihm mißtraut. Aber Sie haben Recht. Ich bin Ihnen eine Fremde –“
Sie wollte noch etwas hinzusetzen, doch sie brach ab. Ich hatte schon keinen Zweifel, keinen Argwohn, kein Mißtrauen mehr. Ich hätte nicht jung sein müssen, sie hätte nicht – Genug!
„Madame,“ sagte ich, „Sie sind eine Unglückliche, die um meinen Schutz bittet –“
„Nur um eine Gefälligkeit, mein Herr.“
„Sie werden auch unter meinem Schutze stehen.“
„Ich danke Ihnen,“ sagte sie.
Dann sann sie ein paar Secunden nach und setzte hinzu: „Vielleicht werde ich Sie auch um Ihren Schutz bitten müssen, es ist möglich. Aber ihn dürfen Sie keiner Fremden geben; Sie werden dann vorher mein Schicksal erfahren. Für jetzt darf ich Sie nicht zum Vertrauten machen. Und nun noch eine Bitte. Verlassen Sie mich, und begegnen und kennen wir uns vor Antwerpen nicht wieder.“
Sie reichte mir ihre feine Hand. Ich glaubte einen leisen Druck zu fühlen, wie ich sie in die meinige legte. Sie zog den Schleier wieder über das Gesicht. Ich verließ die Cajüte, allein der Druck der Hand durchschauerte noch lange meinen ganzen Körper.
Ich sah sie nicht wieder, bis wir in Antwerpen landeten und ausstiegen, da ich oben auf dem Verdeck gewesen, sie aber unten in der Cajüte geblieben war. Als sie heraus kam, sah ich sie zittern. Die hohe, stolze Gestalt ging gebeugt; sie schien sich kaum aufrecht halten zu können. Einen Augenblick schlug sie den Schleier auf; sie war sehr blaß; ihre Augen waren verweint. Sie hatte den Schleier gelüftet, um mir einen Blick zuzuwerfen. Es war ein bittender, als wenn sie gefürchtet hätte, ich könne sie vergessen haben, verlassen wollen. Meine Augen antworteten ihr beruhigend. Sie ließ mit einem dankenden Blicke den Schleier wieder fallen. Dann bemerkte ich, wie sie sich die Stadt ansah, den Hafen, das Bollwerk. Sie sah nach Allem lange und immer wieder von Neuem, als wenn sie es sich recht tief in das Gedächtniß einprägen wolle. Ein paar Mal schienen ihre Augen über die Stadt hinüber zu schweifen, nach den Häusern, die draußen unter Bäumen lagen; sie schienen dort etwas zu suchen. Dann senkten sie sich angelegentlich auf die Menge von Menschen, die am Kai standen, unser Schiff, andere Schiffe erwarteten; sie schien jeden der einzelnen Haufen durchdringen zu wollen. Sie fand wohl nirgends, was sie suchte. Ich war näher an sie herangetreten und hörte sie schwer seufzen. Wir stiegen aus. Sie hatte mir einen Wink gegeben. Ich verließ vor ihr das Schiff, bestellte einen der Wagen, die am Ufer hielten, ließ ihn hinter eine Reihe von Buden fahren, hinter denen er dem großen Haufen der Leute verborgen war, und kehrte zum Schiffe zurück. Sie kam mir entgegen.
„Ich habe einen Wagen,“ sagte ich ihr.
[723] „Wo?“
„Hinter jenen Buden.“
„Folgen Sie mir von Weitem.“
Sie ging nach den Buden, und ich folgte ihr von Weitem. Im Gehen wandte sie ein paar Mal den Kopf zurück, ängstlich, wie es schien, nicht nach mir. Zwei Geistliche standen dort, wohin sie sich wandte, katholische Geistliche, in den langen schwarzen Priesterröcken, mit den niedrigen, breitgekrämpten schwarzen Hüten. Sie sahen nicht nach ihr. Hatte sie sich davon überzeugen wollen? Und warum fürchtete sie diese Geistlichen, während sie mich ausgesucht hatte, weil ich Geistlicher war? Hinter den Buden wartete sie auf mich.
„Ich logire im Gasthofe zur Stadt Amsterdam,“ sagte ich zu ihr. „Er ist mir empfohlen. Wünschen Sie einen anderen?“
„Fahren wir hin. Ich kenne hier keinen Gasthof.“
Schweigend saß sie auf unserer Fahrt neben mir im Wagen. Nur manchmal hörte ich sie schwer und bang aufseufzen. Als wir vor dem Gasthofe hielten, ergriff sie auf einmal meine Hand; sie drückte sie fast krampfhaft.
„Ich gehe einem schweren Schicksale entgegen,“ sagte sie mit gepreßter, zitternder Stimme. „Verlassen Sie mich nicht,“ setzte sie, wie in höchster Angst, hinzu.
Wir waren ausgestiegen.
„Befehlen Sie ein oder zwei Zimmer?“ fragte der Kellner.
„Zwei!“ sagte sie.
Der Kellner führte uns ein paar Treppen hinauf und wies uns dort zwei nebeneinander gelegene Zimmer an.
„Werden Sie heute noch ausgehen?“ fragte sie mich, während wir die Treppen hinaufstiegen.
„Nur zu einer Promenade durch die Stadt, falls Sie meiner nicht bedürfen sollten.“
„Vor der Hand danke ich Ihnen.“
Sie ging in ihr Zimmer, ich in das meinige. Ich kleidete mich um zu der Promenade durch die Stadt. Meine Gedanken waren nur mit der Dame beschäftigt, mit ihrer Trauer, mit dem schweren Geschick, dem sie entgegenging, mit dem Geheimnisse, das über dem Allen lag. Ich hörte sie in ihrem Zimmer nebenan auf- und abgehen; ihr Schritt war bald rasch, bald langsam; sie mußte in großer Unruhe, in schwerem Kampfe mit sich sein. Manchmal, wenn sie stand, seufzte sie wieder so tief und bang auf, als wenn die Angst ihr das Herz zuschnüre. Einmal sprach sie laut mit sich, nur wenige, abgerissene Worte:
„Es war schon vier Uhr vorbei – unter allen den Menschen nicht – auch er, auch er – was sind Schwüre?“
Dann eilte sie zu der Klingel in ihrem Zimmer; sie zog sie hastig. Jemand trat bei ihr ein.
„Wann kommt das nächste Schiff von Brügge?“ fragte sie.
„Es kommen jede Stunde Schiffe an,“ wurde ihr geantwortet.
„Gut.“
Sie war wieder allein. Sie öffnete einen Secretair, der in ihrem Zimmer stand, und setzte sich davor. Ich hörte, wie sie ein Blatt Papier nahm und faltete. Sie wollte schreiben, sprang aber wieder auf.
„Nein, nein!“ rief sie.
Sie durcheilte mit hastigen Schritten das Zimmer.
„Nein, nein!“ rief sie noch einmal. „Und was dann?“ fragte sie sich. „Nimmer!“ schrie sie fast auf, wie unter einem furchtbaren Schauder des ganzen Körpers.
Sie flog wieder an den Secretair und schrieb hastig, nur wenige Worte. Sie faltete das Papier zusammen und siegelte es zu.
„Es muß sein! Gott sei mir gnädig. Gott? –“
Sie stand auf. Ich hörte, wie sie an ihrer Kleidung ordnete. Sie verließ das Zimmer, schloß die Thür ab, ging den Gang, die Treppe hinunter. Ich sah durch das Fenster, das auf die Straße führte. Sie erschien auf der Straße, tief verschleiert und ging sie hinunter, in der Richtung, in der wir angekommen waren, die zum Kai führte. Ich glaubte die Worte zu verstehen, die ich sie hatte mit sich sprechen hören. Bald nach vier Uhr waren wir im Hafen angelangt; sie hatte dort Jemanden erwartet; darum ihre angelegentlich suchenden Blicke unter den Menschen am Ufer. Sie hatte ihn nicht gefunden. Er war nicht dagewesen, trotz seiner Schwüre nicht. Sie wollte jetzt zum Kai zurück, ihn noch einmal zu suchen. Er konnte unterdeß angekommen sein, von Brügge. Aber was hatte sie geschrieben? So combinirte ich. Ich mußte Gewißheit haben und ging ihr nach. Es war ein eigenmächtiges Eindringen in ihre Geheimnisse. Aber sie hatte sich ja unter meinen Schutz begeben.
Ich verfolgte die Straßen, durch die wir vorhin gefahren waren, und ich sah sie bald vor mir gehen. Sie ging rasch, eilig. Ich hielt mich zurück, um nicht von ihr bemerkt zu werden. Wir erreichten den Kai, wo es, wie immer, von Menschen wimmelte. Sie drängte sich durch die Menschen, durch die dichtesten Haufen, spähend, suchend. Sie ging zu der Stelle, an der vor etwa drei Stunden unser Schiff gelandet hatte; auch dort suchte sie vergebens. Sie fragte einen Matrosen etwas. Er zeigte mit der Hand nach einer anderen Gegend des Landungsplatzes der Schiffe. Hatte sie nach der Stelle gefragt, wo die Schiffe von Brügge landeten? Es war so. Sie ging dorthin, wohin der Matrose gezeigt hatte. Sie sprach dort wieder mit einem Schiffer. Ich hatte unter den vielen Leuten nahe zu ihr treten können. Ich hörte die Antwort des Menschen.
„Heute kommt kein Schiff von Brügge mehr, Madame.“
Sie zuckte heftig zusammen. Dann durcheilte sie noch einmal den ganzen Kai und sah sich alle Leute an. Sie mußte in fieberhafter Aufregung sein, ihre Schritte flogen. Ich konnte ihr kaum folgen. Daß man nach ihr sah, daß sie auffiel, beachtete sie jetzt nicht. Es hatte angefangen zu dunkeln. Die Sonne war untergegangen und an einzelnen Stellen des weiten Landungsplatzes wurden bereits Laternen angezündet. Auf den Thürmen der Stadt schlug es acht Uhr. Das Gewühl der Menschen ließ noch nicht nach. Sie verließ es und ging links, die Schelde hinauf, wo es leerer und stiller war. Ich konnte ihr in der eingetretenen mehr als halben Dunkelheit auch in die menschenleere Gegend folgen. Sie ging, ohne anzuhalten, immer am Wasser hinauf. An einem einzeln stehenden kleinen Hause hielt sie an. Ein Knabe von etwa zwölf Jahren saß vor der Thür. Sie blieb vor ihm stehen, redete ihn an und gab ihm dann Geld und ein Papier.
Der Knabe kam eilig stromabwärts an mir vorüber. Er trug einen kleinen Brief in der Hand. Ich konnte ihn nicht anhalten. Sie sah ihm nach. Ich durfte hinter einem Baume, an dem ich mich verborgen hatte, nicht hervortreten. Sie ging weiter und ich folgte ihr weiter. Wir kamen in eine völlig menschenleere Gegend. Sie setzte sich auf einen Stein, der am Ufer der Schelde stand. Ich blieb zwanzig Schritte von ihr stehen, wieder hinter einem Baume. Sie saß lange. Sehen konnte ich in der stärker gewordenen Dunkelheit nur wenig von ihr. Sie saß unbeweglich, aber ihr schweres, banges Seufzen hörte ich deutlich durch die Stille des Abends und der einsamen Gegend. Mir war selbst so bange geworden. Was wollte sie in dieser menschenleeren Gegend! Den Tod suchen? In der Schelde? Ich schwankte, ob ich an sie herantreten sollte.
Auf einmal erhob sie sich. Sie war rasch aufgesprungen. Sie stand hoch aufrecht, stolz, erhaben. Dann beugte sie sich, tief, tiefer – sie war verschwunden. Wie ich ihr nachsehen wollte, hörte ich einen Fall in das Wasser. Sie hatte den Tod gesucht. Ich flog zu der Stelle, zu dem Steine, an dem sie verschwunden war. Ich sah in den Strom; ich sah nur die kreisförmigen Wellen. Aber mitten in dem Kreise tauchte ein schwarzer Gegenstand auf. Sie war es. Ich stürzte in das Wasser, und da ich immer ein tüchtiger Schwimmer war, so erreichte ich sie und brachte sie an das Ufer. Sie war leblos, aber ihr Körper war noch warm; sie mußte in das Leben zurückzurufen sein. Ich legte sie auf den Rasen des Ufers und rief um Hülfe. Ich öffnete ihre Kleider, rieb ihre Füße, sie kam nicht in das Leben zurück. Weitere Mittel kannte ich nicht, auf mein Rufen kam Niemand. Ich ließ sie im Grase und eilte fort, zu den benachbarten Häusern, an denen ich vorbeigekommen war, um dort Hülfe und Beistand zu suchen, um einen Arzt herbeiholen zu lassen. Ich wußte mir nicht anders zu helfen.
Das nächste Haus war ein paar hundert Schritte entfernt. Nahe vor demselben begegnete mir ein Wagen mit zwei Pferden. Es schien eine vornehme Equipage zu sein. Sie war verschlossen; ich konnte nicht sehen, ob Jemand darin saß. Ich wollte sie anhalten, doch die Pferde jagten im Galopp an mir vorüber und der Kutscher auf dem Bocke achtete nicht auf mein Rufen. Ich erreichte das Haus; es war das nämliche, an welchem die Dame dem Knaben das Papier, einen Brief, übergeben hatte. Eine Frau stand in der Thür, welche dem Wagen nachzusehen schien, der vorbeigejagt war. Ich theilte ihr mit, daß eine Dame in’s Wasser gefallen sei, daß ich sie herausgeholt; ich bat sie, mit mir zu kommen, um Rettungsversuche [724] an der Leblosen zu machen und einen ihrer Hausgenossen zu einem Arzte zu schicken. Sie war eine mitleidige Frau. Sie rief ihrem Manne zu, zu dem nächsten Arzte zu laufen. Sie selbst eilte mit mir zurück.
Aber die Stelle war leer, auf die ich den Körper der Dame gelegt hatte. Keine Spur der Ertrunkenen war zu finden. Die Frau, die mich begleitet hatte, sah mich an, ob ich ein Wahnsinniger sei, oder ob ich sie habe zum Besten halten wollen. Ich schwor ihr, daß ich ihr die Wahrheit gesagt hatte. Sie glaubte mir. Aber wo war die Ertrunkene geblieben? Daß sie während der wenigen Minuten meiner Entfernung wieder zu sich gekommen und sich noch einmal in’s Wasser geworfen habe, war gar nicht anzunehmen. So mußte sie durch einen Dritten fortgeschafft sein, und – der Frau ging ein Licht auf. „Der Herr in dem Wagen!“ rief sie. Und dann erzählte sie.
Der Wagen, der mir begegnet war, hatte, vom Kai her kommend, an ihrem Hause angehalten. Ein junger Herr, ein schöner, vornehmer, junger Herr, wie die Frau sagte, war herausgesprungen, hatte sie gefragt, ob nicht vor etwa einer Viertelstunde eine einzelne Dame in schwarzer Kleidung vorbeigekommen; auf dem Kai habe er erfahren, daß sie den Weg hierher eingeschlagen. Die Frau hatte die Dame gesehen, wie sie ihrem Knaben den Brief gegeben. Sie sagte es dem Herrn, der rasch in den Wagen zurücksprang und den Kutscher im Galopp weiterfahren ließ.
Der Herr hatte die Ertrunkene in seinem Wagen mitgenommen. Es war die Vermuthung der Frau; es erschien mir unzweifelhaft. Für mich war nichts weiter zu machen. Der Wagen war längst fort; man sah und hörte nichts von ihm. Ich kehrte in meinen Gasthof zurück – meine nassen Kleider zu wechseln. Sie waren das Einzige, was mir von meinem Abenteuer übrig geblieben war, nebst der Erinnerung an dieses und an ein ungelöstes Räthsel, das nun für immer ein Räthsel für mich bleiben sollte. So meinte ich. Ich kam verstimmt in dem Gasthofe an, „Ein Knabe wartet auf Sie, mein Herr,“ kam mir der Kellner entgegen.
„Auf mich?“
Ich kannte keinen Menschen in ganz Antwerpen; ich wußte nicht, wer mich dort hätte kennen, wer von mir hätte wissen sollen.
„Was will er?“ fragte ich den Kellner.
„Er hat ein Billet, das er nur an Sie selbst abgeben will.“
„Lassen Sie ihn kommen.“
Eine Ahnung war plötzlich in mir aufgetaucht. Sie hatte mich nicht betrogen. Der Knabe kam. Es war derselbe Bursch, den ich mit der verschwundenen Dame gesehen, dem sie Geld und ein Papier gegeben, der mit dem Papier an mir vorbeigekommen war. Er trug es noch in der Hand.
„Sind Sie der Herr, der hier heute mit einer fremden Dame angekommen ist?“ fragte er mich.
„Ja, mein Sohn.“
„Sind Sie zu Wagen oder zu Schiff gekommen?“
„Zu Schiffe, von Harlem.“
„Sie sind es. Die Dame hat Sie mir auch so beschrieben, wie ich Sie sehe. Ich soll Ihnen dieses Billet übergeben.“
Er übergab es mir. Es war ohne Aufschrift, mit einer Oblate verschlossen, ohne Wappen oder Petschaft. Ich erbrach und las es. Ich fragte dann den Knaben noch nach der Dame.
Sie hatte ihm einen Kronthaler gegeben, wenn er pünktlich ihrem Befehle nachkommen wolle. Er hatte es versprochen. Ihr Befehl war, mit dem Billet zum Gasthof zur Stadt Amsterdam zu gehen, sich dort zu dem Herrn führen zu lassen, der heute mit ihr zu Schiff von Harlem gekommen sei, auf ihn, wenn er nicht da sei, bis zu seiner Rückkehr zu warten und ihm dann das Billet zu übergeben, nur ihm, den sie zugleich dem Knaben genau beschrieben hatte. Der gewandte Knabe hatte ihren Befehl pünktlich ausgeführt.
Der Inhalt des Billets war kurz:
„Mein Herr, ich bitte Sie, sogleich nach Empfang dieser Zeilen, jedenfalls noch am heutigen Abende, sich zu dem Pater Canisius zu begeben und ihm die verschlossene Cassette zu überbringen, die Sie in meinem Zimmer finden werden. Die Wohnung des Pater Canisius kann Ihnen Jedermann in Antwerpen zeigen.“
Eine Unterschrift fehlte. Die Schrift war fein und zeigte eine gebildete Dame. Mein Abenteuer war also noch nicht zu Ende. Jedenfalls sollte das Räthsel kein ungelöstes bleiben. Ich wechselte schnell meine Kleider. Dann fragte ich den Kellner, wo der Pater Canisius wohne. Der Mann sah mich verwundert an.
„Der Pater Canisius spricht keinen Menschen.“
„Und warum nicht?“
„Es geht auch kein Mensch zu ihm.“
„Wer ist der Pater Canisius?“
„Das kann ich Ihnen nicht sagen, mein Herr. Ich bin erst seit einigen Monaten in Antwerpen und habe nur im Allgemeinen gehört, wie Jedermann von dem alten Pater Canisius als einem unheimlichen Menschen spricht, der Niemanden zu sich lasse, mit dem aber auch Niemand etwas zu thun haben möge. Einzelnes kann ich Ihnen nicht mittheilen; Sie werden aber von dem Herrn Wirth Näheres erfahren können.“
Er führte mich zu dem Wirth.
„Sie wünschen Nachricht über den Pater Canisius?“ fragte der Wirth.
„Ich bitte darum. Ich habe ihm einen Besuch zu machen.“
„Und kennen ihn nicht?“
Der Wirth sah mich halb verwundert, halb mißtrauisch an.
„Ich habe einen sehr dringenden und wichtigen Auftrag an den Pater,“ sagte ich.
Er schüttelte den Kopf, aber er gab mir die Auskunft, die ich wünschte.
„Der Pater Canisius ist ein Mann, dessen Alter man auf mindestens fünfundachtzig Jahre schätzt. Wie er aussieht, das weiß man schon seit vielen Jahren nicht mehr; es sieht ihn nur sein alter Diener, und dieser spricht nie von ihm. Er ist Jesuitenpater. Er nahm in dem Orden schon eine bedeutende Stellung ein, als dessen Aufhebung vor etwa dreißig Jahren erfolgte. Er soll jetzt – der Orden besteht noch, Sie werden es selbst wissen, mein Herr, Sie sind ja Geistlicher, denn Sie tragen die Tonsur, wie ich sehe – der Orden besteht, trotz jenes Verbots; er besteht durch die ganze katholische Welt, im Geheimen, Verborgenen, desto fester zusammenhaltend. Und der Pater Canisius soll seitdem in der Gesellschaft Jesu von Stufe zu Stufe höher gestiegen sein und gegenwärtig, wie man sagt, an seiner Spitze stehen, Ordensgeneral sein. Es wäre erklärlich. Er hatte immer den Ruf eines der gelehrtesten, strengsten und frömmsten Mitglieder des Ordens. Er hat sich seit Aufhebung des Ordens von jedem Umgange zurückgezogen; nach Manchem zu urtheilen, muß er aber ein fürstliches Vermögen haben. Zu bestimmten Zeiten kommen des Jahres Personen zu ihm, von denen Niemand weiß, wer sie sind und was sie bei ihm wollen. Sie gehen in der Nacht zu ihm, kehren in der Nacht von ihm zurück; man sieht sie nur in weite, dunkle Mäntel gehüllt; man weiß nicht, woher sie kamen, man weiß nicht, wohin sie wieder gehen. In den Gasthöfen der Stadt logiren zu derselben Zeit unbekannte Fremde, deren Wesen man ansieht oder anzusehen glaubt, daß sie hohe Würdenträger der Kirche seien. Ermessen Sie selbst, ehrwürdiger Herr, in wiefern das Gerücht von jener hohen Stellung des Pater Canisius entstehen konnte, aber auch begründet sein kann. Das Volk hat aus jenen Erscheinungen indessen andere Folgerungen gezogen. Wie es leicht alles Verborgene und Geheimnißvolle mit Zauberei und mit bösen oder guten Geistern, am liebsten mit den bösen Geistern der Hölle, in Verbindung setzt, wie besonders der Orden der Jesuiten schon vor und später noch mehr seit seiner Aufhebung in solche Verbindung gebracht wurde, so sind auch die schwarzen Männer, die um Mitternacht zum Pater Canisius schleichen, der Masse nur böse Geister, mit denen er seinen Pact gemacht hat, die ihm dienen, ihm das hohe Alter gewährleisten, ihm seine großen Reichthümer bringen müssen. Darum scheut ihn das Volk und Niemand mag unmittelbar mit ihm verkehren. Unmittelbar, sage ich. Denn der Pater Canisius ist der Vater der Armen, der Helfer der Hülfsbedürftigen, der Retter in der Noth. Dazu verwendet er sein großes Vermögen, und er macht keinen Unterschied zwischen Christen und Juden, zwischen Katholiken und Protestanten, und Alle wenden sie sich durch seinen Diener an ihn, und die Bedürftigen und Würdigen werden herausgefunden, mit sicherem Blick, Gott weiß wie, und Alle nehmen von dem Manne, von dem sie überzeugt sind, daß er seine Seele dem Teufel verkauft habe, und Alle segnen den Mann und beten für seine arme Seele. Da haben Sie den Widerspruch der Menschen; da haben Sie den Mann, zu dem Sie wollen.“
Gode Nacht
Oever de stillen Straten
Geit klar de Klokkenslag:
God’ Nacht! Din Hart will slapen
Un morgen is ok en Dag.
Un ik bün ok bi di;
Din Sorgen un din Leven
Is allens um un bi.
Noch eenmal lat uns spräken:
De Maand schient op de Däken,
Uns’ Herrgott hölt de Wacht.
Theodor Storm.[2]
Die Aufeinanderfolge der Epochen, welche wir aus der Veränderung der umgebenden Thierwelt, aus der Bearbeitung der Instrumente und der Zähmung der Hausthiere nachzuweisen suchen, hat uns also von Belgien und Nordfrankreich nach Südfrankreich und Nordspanien und von dort wieder nach Dänemark und Norddeutschland geführt. Dabei hat sich aber das merkwürdige Resultat herausgestellt, daß jede dieser Epochen wenigstens eine ihr zukommende Menschenrace besitzt, deren physische Charaktere ebensoweit von einander abstehen, wie nur die jetzigen, über die ganze Erde verbreiteten Menschenracen abweichen können. Mit der Ansicht, daß alle Menschenarten von einem einzigen Paare abstammen und ihre Verschiedenheiten sich nur allmählich herausgebildet haben, wie jeder konsequente Einheitler des Menschengeschlechtes doch annehmen muß, stimmt doch wohl diese nackte Thatsache am wenigsten. Die Verschiedenheit der Menschenracen ist schon in den ältesten Resten derselben vorhanden, die wir nur irgend kennen.
Aber unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Innerhalb der engen Grenzen, welche die Unkenntniß der Metalle und die Beschränkung auf Stein, Horn und Holz dem menschlichen Erfindungsgeiste zieht, innerhalb der Steinzeit, wie man diese lange Urzeit genannt hat, ist noch mancher Fortschritt möglich. Wir treten in die Epoche der Pfahlbauer.
Warum sie gerade in Lagunen, in Seen, in Torfmoore und Flußbuchten bauten? Man hat uns neulich gerathen, nach Venedig zu gehen, dessen Paläste ebenfalls auf Pfähle und Roste gegründet sind, und dort nach dem Grunde der Erscheinung zu suchen. Aber ich zweifle, daß Venedig, wo sich Civilisation auf Civilisation gethürmt hat und die alten Culturschichten unter der Last der Marmorpaläste vergraben liegen, daß diese Lagunenstadt uns nur so viel bieten könnte, als die alten Pfahlbauten, über die sich nur schützender Torf oder Schlamm gelegt hat. Der fromme Troyon hat die Frage für alle Frommen genügend beantwortet – die Pfahlbauten sind die bibelgemäße Entwicklung der Flöße, auf welchen die Nachkommen Sem’s, Ham’s und Japhet’s das Mittelmeer umschifften und in die Flußmündungen eindrangen, um dem Laufe der Flüsse folgend bis in das Innere des Continents zu gelangen. Mußten doch capitale Kerle sein, diese Flößer! Heut zu Tage flößt man flußabwärts, genau in derselben Richtung, in welcher das Wasser strömt – damals floß wahrscheinlich das Wasser bergauf! Welche Antwort man wohl von einem Schwarzwälder Floßmeister bekommen würde, dem man zumuthen wollte, sein Floß von Basel aus nach dem Bodensee, statt nach der Nordsee schwimmen zu lassen?
Mögen es nun Wohnungen zum Schutze gegen Angriffe und wilde Thiere oder Magazine sein, welche auf den damals fast nur allein möglichen Handelswegen der Wasserverbindungen errichtet wurden – genug, die Pfahlbauten existiren und der Kreis ihrer Verbreitung erweitert sich mit jedem Tage. Die Schweiz ging voran mit der Entdeckung und allseitigen Ausforschung, Italien folgte, Irland und England blieben nicht zurück, und neuerdings nimmt Deutschland auch seinen Antheil daran, indem Desor mit seinem treuen Benz im Stahrenberger See und Jeitteles in Olmütz sie nachwies. „Was sie im Auslande nicht Alles erfinden!“ sagte ein Custode in München zu einem meiner Freunde. „Da ist neulich ein Professor aus der Schweiz gekommen mit einem kleinen Kerl mit katzgrauen Augen, und der Professor sagte: Da im See, da an der Roseninsel, da müssens’s sein. Ja, sagte der Andere, ich seh’s auch. Und da fischten sie hinein und zogen die Sachen heraus. Unsere Herren, die mit waren, konnten nix sehen, bis es heraus war. Dann sind sie wieder fort – aber den Orden werden’s dem Professor wohl nachschicken, wenn er auch in der Schweiz wohnt, wo sie darauf nicht viel geben.“
Die Pfahlbauten sind also wohl über ganz Europa zerstreut und dienen sogar häufig als Grundlagen späterer Ansiedlungen, die sie verdecken. In Italien kömmt es nicht selten vor, daß man über der Pfahlbauschicht alle die Culturschichten findet, welche auf diesem classischen Boden sich ausgebreitet haben, etruskische, römische, mittelalterliche Reste, die einen die andern deckend und bergend. Anderswo sind diese Reste unter dem Schlamm der Seen, unter dem Torf der Moore begraben.
Es waren längliche Hütten, die theils auf Rosten, theils auch auf Packwerk standen, das aus Holzstücken zusammengehäuft, mit Lehm verbunden und durch Pfähle festgehalten wurde. Offenbar liefen um die Hütten Rostböden, die über dem Wasserspiegel standen und die Communication vermittelten. Die Pfähle selbst staken tief im Seegrunde, häufig mit angekohlten Spitzen. Die meisten Ansiedlungen sind durch Feuer zerstört worden, und aus der Richtung der Kohlenstückchen und der Asche konnte Messikomer, einer der verdientesten Forscher in der Nähe von Zürich, nachweisen, daß die Ansiedlung von Robenhausen am Pfäffikon-See bei einem heftigen Föhnsturme abgebrannt sei.
In der Schweiz läßt sich der Fortschritt in der Civilisation des Urmenschen während der Pfahlzeit deutlich verfolgen. In der Ostschweiz am Bodensee, an den Seen von Pfäffikon und Zürich sind die Geräthschaften noch roh, klotzig, unbeholfen, bäurisch in der Form, in der Westschweiz, bei Concise am Neuenburger See, in einer sehr reichen Station, welche der waadtländische Cantönligeist, gestützt auf die sprüchwörtlich gewordene Selbstsucht eines frommen Privilegienhaschers, während längerer Zeit der freien Forschung unzugänglich gemacht hatte, in Concise finden sich feinere Formen, gefälligere Werkzeuge, besser ausgearbeitete Verzierungen.
Offenbar ist es der Besitz fester Wohnungen, welcher die erste Bedingung der Civilisation bildet. Sobald das Jäger- und Nomadenvolk sich an den Boden gefesselt hat, strengt es auch seinen Scharfsinn an, denselben urbar und nutzbar zu machen, seine Production zu erhöhen und mehr Nahrungsstoff aus der Umgegend zu ziehen, als diese freiwillig bieten würde. Mit dem Zusammenwohnen muß auch eine gewisse Ordnung, ein gesellschaftlicher Verband entstehen, der vielleicht im Anfange sich nur auf die Familie beschränkt, bald aber sich ausdehnt. Wenn man bedenkt, daß in den Seen und Torfmooren der Schweiz allein jetzt über dreihundert Pfahlbauten nachgewiesen worden sein mögen, daß der Bieler- und Neuenburger-See überall den Ufern entlang mit solchen Bauten, deren Flächenraum oft großen Dörfern entspricht, förmlich bespickt erscheinen; daß außerdem noch ganz gewiß auf dem Lande Ansiedlungen waren, da man einerseits bei Zürich am Ebersberge eine solche gefunden hat, anderseits menschliche Gebeine in der Umgebung der Wasserbauten fast gänzlich fehlen: so kommt man unwillkürlich zu dem Schlusse, daß diese Bevölkerung eine ziemlich zahlreiche gewesen sein muß, in gesellschaftlichen Beziehungen lebte und Ackerbau und Viehzucht zu treiben genöthigt war, um auf so beschränktem Raume sich nähren zu können.
Der Fortschritt der Cultur läßt sich besonders an den Hausthieren, an der Landwirthschaft und den Gewerben nachweisen. Der Hund, der auch in den ältesten Zeiten der dänischen „Küchenabfälle“ vorhanden war, findet sich überall in der Schweiz; eine eigene Schweinsart, das Torfschwein, dessen Nachkommen jetzt kaum noch in den Thälern um den Gotthardt gezüchtet werden, findet sich anfangs nur wild, später aber in gezähmtem Zustande vor; das Wildschwein bleibt lange noch wild, erst in Concise gegen das Ende der Periode, die wir als die Epoche der Steinpfähler bezeichnen können, kommt es[WS 1] gezähmt vor und scheint dort als zahme Hausthierrace eingeführt worden zu sein. Der Wisent oder Auerochs, der jetzt noch in den polnischen Wäldern lebt, ist niemals gezähmt worden; der nicht minder große Ur hat sich zur friesischen Rindviehrace einigermaßen umbilden lassen, zeigt sich aber in der Steinzeit nur selten gezähmt. Dagegen giebt es eine kleine Rindviehrace, am ähnlichsten vielleicht dem noch jetzt in Algier gezüchteten Kleinvieh, die Torfkuh, welche allgemeines Hausthier wurde und die bekannte Schwyzer Race oder das Braunvieh der Schweiz gebildet hat. So haben also die Steinpfähler das Schwein und das Rind – aber auch das Schaf und die Ziege fehlen nicht. Letztere unterscheidet sich nicht von der gegenwärtigen, das Schaf aber hatte ziegenähnliche Hörner und scheint sich noch [727] jetzt in einer Race fortzupflanzen, die schlechten Ertrag an Wolle und Fleisch liefert und nur noch in der Nähe des Gotthardts, sowie in den Hochgebirgen von Schottland und Wales gezüchtet wird. Die wilden Jagdthiere haben sich in so fern verändert seit jener Zeit, als Ur und Wisent, Hirsch und Elen, die erst von den Steinpfählern gejagt wurden, ganz aus der Schweiz geschwunden sind, Damhirsch und Reh, Wildschwein und Wolf und Steinbock dagegen nur noch selten und ausnahmsweise sich antreffen lassen· Rütimeyer, der an dem lockeren Gewebe und fettigen Aussehen die Hausthierknochen leicht von den Knochen der entsprechenden wilden Racen unterscheidet, macht übrigens die sehr triftige Anmerkung, daß in den ältesten Ansiedlungen die Knochen der Jagdthiere überwiegen, in den jüngeren diejenigen der Hausthiere, woraus eben wieder mit Sicherheit geschlossen werden kann, daß erst die Steinpfähler in der Schweiz überhaupt festere Wohnsitze gründeten und die Thiere, welche ihnen das angrenzende Land bot, zu züchten versuchten, was ihnen auch bei einzelnen Arten allerdings gelang. Erst in der spätesten Zeit dieser Ansiedlungen finden sich Spuren von Einführungen neuer Hausthierracen, wie eine besondere Rindviehrace, Pferd und Esel, die alle auf den Mittelmeergürtel hindeuten – echt asiatische Thiere, wie das Huhn z. B., fehlen überall gänzlich, und keine Spur führt, wenigstens von den Thieren, nach Hochasien oder Indien hinüber.
Der Ackerbau stand auf verhältnißmäßig hoher Stufe. Der Weizen wurde allgemein gebaut, seltener der Emmer und die Gerste; die Brodfrucht wurde auf großen Steinen mit Läufern gequetscht und gebacken; das Brod sieht verkohltem Pumpernickel nicht unähnlich. Aepfel und Birnen wurden gezogen und mit der äußeren Haut, meist in Hälften gespalten, zu Schnitzen gedörrt. Faserpflanze war allein der Flachs; der Hanf war ebenso unbekannt, als die Weinrebe. Bewundernswürdig sind die Gewebe, welche auf offenbar höchst einfachen Webstühlen zu verschiedenen Zwecken angefertigt wurden.
Das Rennthier, dessen härtere Geweihe zu Instrumenten vorgezogen worden wären, existirte offenbar in der Schweiz nicht mehr – die Geräthe, oft sehr kunstvoll und fein (Nadeln, Strickstöcke, Speerspitzen, Feldhacken etc.) sind aus Hirsch- und Rehgeweihen verfertigt, und an einzelnen Stellen, wie in Concise, hat man solche Massen von Geweihen, halb und ganz bearbeiteten Stücken gefunden, daß man Haufen davon aufklaftern konnte und der Gedanke einer Fabrik und eines Magazins nahegelegt werden mußte. Die Art und Weise, wie die Steinäxte und Hämmer mit Horn- und Holzstielen befestigt wurden, indem bald die Axt in den Stiel geklemmt und gebunden, bald wieder ein Loch in den Stein gebohrt und der Stiel darin befestigt wurde, zeugt sowohl von der Festigkeit der benutzten Bänder, als von der Geschicklichkeit der Verfertiger. Ebenso bieten die Töpfergeräthschaften merkwürdige Zeichen allmählicher Vervollkommnung sowohl durch bessere Zubereitung des Materials, als durch Verfeinerung der Formen und künstlerische Anordnung der einfachen Verzierungen. Bogen und Pfeile, Schlägel und Speere, Schüsseln und Quirle aus Holz fehlen ebensowenig, als Kämme und Körbe – ja selbst Räder zeigen, daß man sich schon wenigstens der Schubkarren bediente, wenn nicht ein jochähnliches Holz sogar auf Einspannung der Rinder und also auf Gebrauch wirklicher Wagen hindeutet.
Das Einzige, was auf einen Cultus bezogen werden könnte, wären mondsichelähnliche Gegenstände aus Stein, Thon und Holz – die Hörner des Mondes sind nach oben gerichtet – mir haben indessen diese Geräthe von ansehnlicher Größe eher den Eindruck von Kopfträgern zum Schlafen gemacht. Bekanntlich legen die Chinesen und Japanesen ebenfalls das Genick beim Schlafe auf einen Holzblock, dessen etwas ausgehöhlter Rand nicht gerade allzu abgerundet ist, und der rohe Holzsattel, den der ungarische Pferdehirt als Kopfkissen benutzt, mag an Weichheit der Mondsichel der Pfahlbauern nicht weit voranstehen.
Es war also mit Holz, Horn und Stein von diesen Steinpfählern erreicht, was nur irgend erreicht werden konnte. Die Landwirthschaft blühte – von fast rein thierischer Nahrung war der Urmensch zu vorwiegend pflanzlicher übergegangen; er wob sich seine Kleiderstoffe, statt den Thieren ihr Fell zu rauben; statt von dem Zufalle der Jagd zu leben, strengte er seine Intelligenz an, um seine eigene Vorsehung zu werden und sich den zum Unterhalte des Lebens nöthigen Nahrungsstoff selbst zu schaffen. Aber es fehlt noch jede Spur von höherer Entwickelung – namentlich jede Spur von einer Zeichen- oder Buchstabenschrift, durch welche der Mensch seine Gedanken befestigen und Solchen, die außer dem Bereich seiner Stimme waren, hätte mittheilen können.
Sogar in der nächsten Epoche, welche man die Periode der Bronzepfähler nennen könnte, fehlt eine jede solche Andeutung gänzlich. Das Metall wird offenbar allmählich eingeführt; das Erz wird, chemischen Analysen zufolge, aus den Alpen selbst gewonnen. Die Bearbeitung der Mischung geschieht nur durch Gießen in Formen; aber diese Formen selbst erreichen einen hohen Grad von Vollkommenheit und selbst künstlicher Schönheit. Die Schwerter und Aexte, die Messer und Dolche, die Speer- und Pfeilspitzen, die Sicheln und Sensen haben alle höchst eigenthümliche, aber auch sehr passende Formen, und der Schmuck? – mein Freund Desor hat Haarnadeln mit verzierten Köpfen, Arm- und Fußringe, Gehänge für Ohren, vielleicht auch für Nasen und Lippen, Agraffen und Brochen aus Bronze, die Jahrtausende lang im See gelegen hatten, durch geschickte Hände aufpoliren lassen, und ich kann versichern, daß viele dieser Gegenstände geschmackvoller und reicher gearbeitet sind, als viele Schmuckgegenstände aus Gold, die jetzt an den Schaufenstern der Genfer Juweliere den neuesten Modegeschmack repräsentiren.
Ich will mich über die Zeit der Bronzepfähler nicht weiter verbreiten. Mit dem Ende der Steinzeit, mit der Kenntniß des Metalls hört eigentlich die Urzeit der Menschheit auf. Aber das Ringen mit dem Material hört auch in der folgenden Periode nicht auf. Nach langen Jahren erst tritt das Eisen wahrscheinlich ebenso allmählich an die Stelle der Bronze, wie diese an die Stelle des Steins und des Hornes getreten war. Jedenfalls geschah letztere Einführung nicht plötzlich durch Invasion eines anderen Stammes, einer anderen Race, sondern nur nach und nach; jedenfalls waren die Bronzeinstrumente anfangs nur Seltenheiten, reichen Leuten angehörig, bis endlich die zunehmende Civilisation dem Metall mehr und mehr seine Rechte auch in den niederen Schichten der Gesellschaft eroberte. Ich will zum Schluß nur noch zwei Fragen berühren, welche mit dieser ganzen Darstellung enge verknüpft sind – das Racenverhältniß der Pfahlbauern der Schweiz zu den übrigen Urmenschen und das Alter der Ablagerungen, aus welchen wir die hier besprochenen Reste hervorgeholt haben.
In Beziehung auf den ersteren Punkt läßt sich sagen, daß die bis jetzt gefundenen Schädel der Pfahlbauern in Helvetien einem eigenen Typus angehören, der mit den bis jetzt besprochenen Schädeln gar nichts gemein hat; daß dieser Schädeltypus, den man den helvetischen oder Sion-Typus genannt hat und der sich durch große Länge und Breite auszeichnet, auch in den älteren Gräbern überwiegt und ununterbrochen von den ältesten Pfahlbauten bis in die neueste Zeit verfolgt werden kann, wenn auch in stets abnehmender Proportion, indem er von einer kurzköpfigen Race, den Alemannen und Rhätiern, nach und nach verdrängt wird, während zugleich später noch in historischer Zeit zwei Schädeltypen sich in die Schweiz einschieben, die aber niemals eine große Bedeutung erlangen. Die Fortpflanzung des ursprünglichen Schädeltypus beweist also die Autochthonie, die Urwüchsigkeit eines Theiles der heutigen schweizerischen Bevölkerung, und die Verschiedenheit von den Schädeln der übrigen Urmenschen ist zugleich so groß, daß an eine Ableitung des Typus von diesen nicht gedacht werden kann.
Das Alter aber – du lieber Himmel! Wie sollen wir mit unseren Genealogien da hinauf reichen? Tubalkain, der Vetter Noah’s, der vor der Sündfluth lebte, war schon Meister in Erz und Eisen, und ein Deuteln dieser Worte ist nicht erlaubt, denn das hebräische Wort für Eisen, das im ersten Buche Mosis vorkommt, hat nie eine andere oder eine Nebenbedeutung gehabt. Keine Tradition irgend eines Volkes führt uns in eine Zeit zurück, wo dasselbe noch kein Metall, ja noch kein Eisen kannte.
Die Berechnungen aber, die man auf geologische Gründe, auf das Anwachsen des Torfes, auf das Anschwemmen der Sand- und Kieslager, stützen könnte, sind trügerisch. Die Anschwemmungen sind kein regelmäßiger Faktor, welcher von Jahr zu Jahr sich wiederholte – auch das Anwachsen des Torfes findet nicht überall in demselben Maße statt, sondern richtet sich nach der Feuchtigkeit des Bodens, der Jahre, nach einer Menge von Bedingungen, die beträchtlichem Schwanken unterworfen sind. Man hat römische Geschirre in einer Tiefe von zweiundvierzig Centimetern im Torfe [728] gefunden. Der Torf ist also, wenn man das Alter dieser Geschirre auf mindestens 1400 Jahre zurück datirt, etwa einen Fuß (genau dreißig Centimeter) im Jahrtausend gewachsen. Wenn nun in einzelnen Torfmooren nicht nur ein Fuß Dammerde, sondern auch sieben bis zehn und noch mehr Fuß Torf über den Pfahlbauten liegen, so müssen wir diese, die jüngsten und neuesten Producte der Urmenschen, wenigstens auf ebensoviel Jahrtausende zurücksetzen, und gehörten die Scherben, statt dem vierten Jahrhundert nach Christo, der Invasion Cäsar’s an, so wüchse unsere Berechnung sogleich um einige Jahrtausende. Welche ungeheure Anzahl von Jahren muß aber von dem ersten Auftreten der Urmenschen, von der Periode der Höhlenbären an bis zu der Epoche der Pfahlbauern verflossen sein, damit so ungemeine Fortschritte in der Cultur bewirkt und so große Aenderungen in der umgebenden Thierwelt durchgeführt werden konnten, wie wir sie im Verlaufe dieser Zeiten schilderten? Annähernd läßt sich dies nur aus dem Umstande erschließen, daß die Feuersteinmesser aus der Höhlenbären-Periode unter Anschwemmungsschichten liegen, die bis zu zehn Meter, also dreißig Fuß Mächtigkeit erreichen und daß erst über diesen Anschwemmungen der Seegrund folgt, in welchen die Pfähle eingetrieben wurden, und der Torf, der sie bedeckte.
Wenn wir aber auf eine solche Altersbestimmung nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden insofern verzichten, als wir nur das über alle Berechnung hohe Alter behaupten, so können wir nicht umhin, noch einmal auf die Resultate kurz hinzuweisen, die aus den Forschungen bis jetzt hervorgehen. Diese sind aber wesentlich die ursprüngliche Verschiedenheit der Menschenracen, die Europa’s Boden bewohnen, und ihre selbstständige Entwickelung auf diesem Boden durch harten Kampf hindurch und durch stete Bethätigung ihrer intelligenten Arbeit. Hinab also mit jener Annahme von ursprünglicher Einheit des Menschengeschlechtes und Abstammung desselben von einem einzigen Menschenpaare – hinab mit jenen Träumen von einem früheren glücklicheren Zustande, von einem Paradiese und ursprünglicher Unschuld und Leichtlebigkeit ohne Kampf um das Dasein – hinab damit in die Ideenstampfe und aufgeschaut zu diesem Entwickelungsgange und diesem Entwickelungsgesetze, das den Menschen auf seine eigenen Füße stellt und die Verbesserung seiner Zustände in seine eigene Hand legt!
Durch den Canal grande der Lagunenstadt Venedig, auf die sich seit der bekannten September-Convention Napoleon’s mit Victor Emanuel Aller Augen von Neuem lenken, fliegt die Gondel! Sie trägt den neugierigen Reisenden vorüber an jenen Palästen, die ein gewaltiges Geschlecht zum Tummelplatz seiner Intriguen, seiner Fröhlichkeit, zum Sesam für zahllose Schätze des Handels, der Kunst und Industrie ausersehen hatte. Verschwunden, versunken, vergessen, das müßte die Inschrift sein für alle Häuser jener alten, dahingegangenen Familien Venedigs. Wo sind sie, die Zianis, Moncenigos, Dandolos u. s. w.? Noch prahlen ihre Zeichen an den öden Gebäuden, welche der Marmor bedeckt, aber von den Balconen herab, aus den Fenstern, den Orten, von denen die üppigen Besitzer einst stolz auf das Getreibe der Stadt sahen, hängt das Lederzeug der österreichischen Soldaten. Die Pfähle in der trüben Fluth des Canals, die das Anstoßen der Gondeln verhindern sollen, waren sie nicht geziert mit den prunkenden Wappen, den bunten Farben der Hausbesitzer und Familien? Kein Wappen, keine Farbe Derer sichtbar, die hinter kolossalen Denkmälern in den Kirchen Venedigs längst zu Asche zerfielen. Und doch tauchen dort Pfähle auf geschmückt mit heraldischen Zeichen. Aber es ist kein Schild des italischen Adels: in Blau eine goldene Lilie – das Wappen der Bourbonen. Die Gondel legt an. Aus den Wellen der Lagune steigt der Palast Vendramin, ein Bau im herrlichen Renaissancestyl des Meisters Lombardo, dem nach erhaltenem Lohne noch ein Ring von ungeheuerem Werthe zum Andenken verehrt ward.
Wiederum fragen wir: „Wo sind die Vendramins?“ Die Antwort lautet wieder: „Verschollen oder vergessen.“ Wer aber besitzt heutzutage den Palast? Maria Caroline, Herzogin von Berri, geborene Prinzessin von Sicilien. Der Besitz eines versunkenen Geschlechtes gelangte in die Hände der Familie, welche seit einem Menschenalter bestimmt scheint, ruhe- und heimathlos umhergeworfen zu werden; die kaum auf Thronen, dereinst den Ruhestühlen ihrer Vorfahren, von Neuem Platz genommen hatte, als das Schicksal sie wieder hinunterstieß; die, immer unglücklich in ihren Versuchen die verlorene Krone Frankreichs wieder zu gewinnen, dennoch nie die stolze Hoffnung verlor.
Die hervorragendste Persönlichkeit der gegenwärtigen Sprossen des Geschlechtes, die muthige Herzogin von Berri, ist also Besitzerin des Palastes Vendramin und sie hat die Mauern und Gemächer desselben umgewandelt zu einem Epitaphium, es ist eine Galerie des Mißgeschickes königlicher, erlauchter Häupter. Fast scheint es, als wollte in allen Zusammenstellungen die Herzogin zeigen, wie nichtig die irdische Größe, wie ohne Wahl die Hand des Geschickes eingreift auch in den Lebenslauf des Mächtigsten; als wollte sie die Bilder und Statuen reden lassen für das Recht ihrer selbst und das ihrer Kinder.
Ueber die breite Treppe, deren Geländerstäbe qualvoll sich ringelnde, von fletschenden Löwenzähnen gepackte Schlangen umwinden, stieg ich in das Innere dieses Palastes, der, angefüllt mit ernsten Reliquien, nicht nur zum Beschauen, sondern weit mehr zum Nachdenken stimmt.
Durch den mit Bildwerken von Palma gezierten Vorsaal gelangt man in den Speisesaal, woselbst schon die Geschichte des Unglücks beginnt, eine Geschichte in Bildern. Ich betrachtete mit Empfindungen, wie sie der Geschichtsfreund in solchen Augenblicken hegen muß, die schmerzausdrückenden Züge Henriette’s von Frankreich, die stolzen ihrer herzlosen Mutter Maria von Medicis. Ich gedachte des Hauses zu Köln am Rhein, des Hauses, in welchem Rubens geboren, gelebt, und in welchem Maria verlassen und arm gestorben. Zwischen beiden Portraits leuchtet das der Katharina Cornaro hervor, umgeben von Bildern der Mitglieder des Geschlechtes Vendramin, des Geschlechts, von dessen einstiger Existenz nur noch seine Leichensteine zeugen.
Daneben – ein Sprung von mehrern hundert Jahren – erblickte ich die Bilder der Tanten Ludwig’s XVI., jener armen, alten Damen aus bourbonischem Blute, die, hinausgetrieben aus Frankreich, umherirrten und in der Fremde starben· Wie viel Unglück auf dieser kleinen Stelle vereinigt ist! Nur wenige Schritte weiter, und wir finden Heinrich IV., den größten der Bourbonen; Bosio’s Meisterhand hat ihn als Knaben dargestellt. Er lächelt, ein Zug reizender Unbefangenheit umspielt den schönen Mund, heiter, sorglos. Die Zeit ist noch fern, wo Ravaillac’s Mörderstoß die Hoffnung Europa’s vernichten soll.
Ludwig XIII., der kalte, gefühllose Sohn des großen Königs, Franz I. mit seinem mephistophelischen Antlitz erweitert das Gefühl des Unheimlichen. Wesentlich trägt hierzu das Düster des Zimmers bei, in welchem die Gemälde hängen. Alte Ledertapeten bedecken die Wände, seltsame Holzschnitzereien springen aus den Ecken und Winkeln hervor; wohin ich mich wende – eine trübe Erinnerung, eine Reliquie, welche von einem durch das Schicksal, sei es selbstverschuldetes oder unverdientes, schwer heimgesuchten Wesen stammt. Dort in der Ecke legen wir die Hand auf ein Schreibepult, vor dem dereinst die unglückliche Maria Antoinette gesessen, wir betasten die Schubladenknöpfe, die ihre zarten, zitternden Finger umklammerten – wenige Schritte weiter trägt ein alter, schwerfällig, aber kostbar verzierter Tisch ein Schreibzeug Katharina Cornaro’s, jener Königin, die nur schreiben gelernt hatte, um Abdankungen, Urtheile über Leben und Tod und zuletzt die Einwilligung in ihre eigene ewige Kerkerhaft unterzeichnen zu können. Nachdem ich mich ein wenig an den herrlichen Gemälden, welche das Zimmer links von dem Speisesaale füllen, erheitert hatte (obwohl die Vorwürfe auch gerade nicht erfreulich auf das Gemüth wirken, denn man findet Martern und Büßungen genugsam dargestellt, [729] aber Pordenone, Bassano, Tintorett und Veronese helfen darüber hinweg), folgte ich dem Führer in den großen Salon.
Die Herzogin hat hier eine Anzahl schöner Büsten aus der französischen Schule aufgestellt. Es sind Bronze- und Marmorbilder von Heinrich IV., dem Minister Sully, Ludwig XIV., dem Herzoge von Angoulême und dem durch Louvel’s Mörderhand gefallenen Herzoge von Berri. Ueber jenem kostbar verzierten Eckschranke ein Bild Ludwig’s XV. Wir haben hier drei Bourbonen vor uns, die theils unter Mörderhänden ihr Leben aushauchten, oder doch das Eisen des Vernichters an ihrem Herzen fühlten: Heinrich IV. und Ravaillac, Ludwig XV. und Damiens, den Herzog von Berri und Louvel. Drei Jahrhunderte hintereinander sah die Familie den Dolch über den Scheiteln ihrer vornehmsten Häupter schweben oder den Weg zu deren Herzen finden.
Wiederum durchschreiten wir einen Corridor, der zu dem Arbeitszimmer der Herzogin führt. Wiederum spricht das Unglück, die Einsamkeit, die Verlassenheit auf Thronen oder die Stimme des Verbannten von den Wänden herab in Bildern zu uns. Ludwig XIV., XV., dann das große, in einem Menschen verkörperte königliche Märtyrerthum Ludwig XVI., endlich Ludwig XVIII., Carl X. und neben diesen Bildern das der Zerstörerin Frankreichs, das Bildniß des schönen, bösen Wurmes, der sich zuerst hineinfraß in das Mark des mächtigen Baumes, das Bild der Marquise von Maintenon.
Ich konnte mich nicht enthalten, meine Bemerkung darüber zu machen, daß diesen Herrscherbildern gegenüber das Portrait des deutschen Kaisers Joseph II. aufgehangen worden sei, dessen Charakter und Ansichten so unendlich verschieden von denen der Originale aller neben ihm befindlichen Portraits gewesen.
„Ja,“ sagte der Führer, ein Diener im herzoglichen Palaste, „sehen Sie, er ist doch einmal ein Verwandter des Hauses, weil seine Schwester einen Bourbon geheirathet hat. Er war auch, glaube ich, einmal in Paris, aber er hat sich da sehr gefreut, daß es so viele unruhige Köpfe dort gebe. Denn mit denen verkehrte er gern.“ Wir schritten in das Arbeitscabinet der Herzogin – wenn der Leser jemals die Räume des Palastes Vendramin zu Venedig betreten sollte, so verweile er in diesem Gemache und versenke sich, gleich mir, in die Betrachtung der zahlreichen kleinen Miniaturportraits, welche die Wände schmücken, sie fast bedeckend.
Ich ging sie der Reihe nach durch. Sie sind reizend gefertigt, sie tragen den Stempel des vergangenen Jahrhunderts in Auffassung, Ausführung, Form und Tracht. Fast alle stellen Genossen dar jenes großen Unglücks eines hochgestellten Hauses, jener Leidenszeit des sechzehnten Ludwig und seiner mitleidenswerthen Gattin, die so viel erduldet, so viel ertragen und so viel fremde Schuld auf sich genommen haben. Ich kannte sie bald wieder: die schöne Lamballe, die Polignac, Madame Elisabeth, diesen Engel an Tugend, die schuldlose Dauphine, den armen Dauphin. Wer nennt sie Alle, die von jenes Zimmers Wänden herabschauen? Denn so Mancher ist dem Beschauer unbekannt, aber tief eingeschrieben vielleicht in die Herzen der Familie Bourbon. Heiter und lachend, noch nicht am Rande des Verderbens stehend, zeigt sich Maria Antoinette hier im Bilde. Ihr schönes Haar ist ohne Puder und fällt in herrlichen Locken blond und üppig auf den Nacken. Es war noch nicht die Zeit gekommen, in der sie eine Locke ihres weiß gewordenen, greisenhaften Haares für Frau von Campan abschnitt und auf das die Locke umhüllende Papier die Worte schrieb: „Gebleicht durch Unglück.“
Eilen wir jedoch nun in den Saal, welcher die Erinnerungen an die jüngsten Sprossen der Familie Bourbon einschließt. Wir sind der Herzogin, der muthigen Frau, der heroischen Mutter, Caroline Maria von Berri, eine längere Betrachtung ihres Wirkens schuldig. Hinunter in das Meer der Vergangenheit tauchen die Gestalten Derer aus dem Geschlechte der Bourbonen, welche geziert waren mit Purpur und der Krone Ludwig’s des Heiligen, die in ihren Händen das Scepter und die goldne Hand Carl’s des Großen hielten. Vor uns auf steigt das Geschlecht wieder, aber nur Die aus seiner Mitte, die da ringen mit dem Geschicke und die bis jetzt unterlagen.
Bevor wir die sprechendsten bekannten Bilder und Reliquien betrachten, müssen wir ein Portrait besichtigen, das, fast in den Winkel des Saales gehängt, doch gleichsam hervorleuchtet aus seinem Versteck. Es stellt einen jungen Mann in einer beinahe mittelalterlichen Tracht dar, aber man sieht dem Bilde an, daß diese Tracht nur beigegeben wurde, daß sie nicht zu dem modernen Kopfe paßt, ja – es hat fast den Anschein, als sollte eine Art von Verwirrung, eine Ungewißheit absichtlich erzeugt werden, denn dieses Bild ist ohne Zweifel mit einem Familiengeheimniß, möglicherweise der zartesten Art, verknüpft. Der Ausdruck des Gesichts ist ein wenig theatralisch. Im ersten Augenblicke glaubt man das Bild irgend eines Schauspielers von Bedeutung vor sich zu sehen. Schaut man es aber länger an, so findet man leicht, daß ein tiefer Schmerz sich um den Mund lagert, daß die Augen fast übergehen wollen von andrängenden Thränen. Dabei ist das Bild nur in zwei Farben ausgeführt und die Lichter sind alle recht grell aufgesetzt; dadurch tritt es besonders hervor und macht eine eigenthümliche Wirkung. „Wen stellt dieses Bild vor?“ fragte ich den Führer.
„Ich weiß es nicht. Ueberhaupt weiß es Niemand. Nur so viel ist uns bekannt, daß es von den Angehörigen sehr hoch gehalten wird, und es beweist dies schon der Umstand, daß ihm sein Platz unter den Bildern der Familie angewiesen wurde. Die Herzogin wird es wohl wissen.“
Das Geheimnißvolle reizt. Mit doppeltem Interesse schauen wir auf diese edlen Züge, diese wehmüthig blickenden Augen. Wen mag das Bild vorstellen? Das Haus Bourbon ist stets reich an mystischen Vorgängen und Persönlichkeiten gewesen. – Hoch zu Pferde zeigt sich im Bilde der Herzog von Bordeaux. Er ist es, der Frankreichs Krone als Heinrich V. sich auf das Haupt setzen sollte. Er ist es, um dessenwillen seine Mutter das Ungeheuerste wagte, was eine zarte Frau wagen kann; er ist es, um den sie zur Heldin, zur Gefangenen, zur Verbannten wurde; indem wir bis zu ihm gelangt sind, kommen wir auf das bewegte Leben Maria Carolina’s, die von seiner Geburt an mit Beaumarchais ausrufen kann: „Ma vie est un combat.“
Die Betrachtung der merkwürdigen Frau soll uns länger beschäftigen. Im Februar des Jahres 1820 hatte Louvel’s Mörderhand dem Leben des Herzogs von Berri durch den Stoß seines Messers ein Ende gemacht. Damals trug Maria Caroline den Herzog von Bordeaux unter ihrem Herzen. Am 15. Sept. 1820 ward die Herzogin von einem Sohne entbunden. Die Geburtsstunde des Herzogs von Bordeaux ist thatsächlich einer der merkwürdigsten Eintritte in das Leben. Bekanntlich findet bei den Geburten hoher Persönlichkeiten, welche bestimmt sind, eine Krone zu tragen, eine Art von Zeugenversammlung statt, um die Echtheit der Geburt zu constatiren. Da im entscheidenden Augenblicke nur Personen aus der nächsten Umgebung zugegen waren, so rief man eine Wache des Dauphins herbei, damit Zeugen unverdächtiger Art in der Nähe seien. Maria Caroline aber dachte in dieser schweren Stunde, während dieses Schwebens zwischen Leben und Tod, an die Zukunft des Kindes, welches erst das Licht der Welt erblicken sollte. „Die Wache des Dauphins,“ rief sie mitten in den Wehen, „gehört zum Hause, sie ist nicht unverdächtig. Nationalgarden herbei, sie sollen zeugen.“
Zehn Minuten später traten die Nationalgardisten Lainé, Dauphinot und Ladong ein. „Sehen Sie, meine Herren,“ sagte die Herzogin, „da ist ein Prinz von Frankreich.“
Englische Blätter brachten bald darauf einen Protest gegen die Echtheit der Geburt, ein Manoeuvre, welches das Herz der Mutter tief verwundete. Die Erziehung des jungen Herzogs sollte nach dem Willen der Mutter in einem dem Volke zusagenden Sinne stattfinden. Allein eine höhere Macht hatte es anders beschlossen. Die Kugeln der Julirevolution zerrissen das Band, welches die Bourbonen mit Frankreich verknüpfte. Maria Caroline war bald die Begleiterin des flüchtenden Königs. Carl X. saß in der Kutsche, welche ihn aus den erregten Umgebungen der Hauptstadt hinwegtrug, neben der Herzogin von Angoulême, der Tochter Ludwig’s XVI. Zum zweiten Male flüchtete die unglückliche Prinzessin vor den heranwogenden Fluthen der Empörung. Man erzählt, der Zug der Flüchtlinge sei wieder über Varennes gegangen und wieder sei vor der verhängnißvollen Brücke, bei welcher einst Ludwig’s XVI. Wagen angehalten wurde, ein Rad an der königlichen Kutsche gebrochen. Carl X. habe halten wollen, allein die Herzogin von Angoulême habe es nicht zugegeben, sondern darauf gedrungen, daß die ganze Familie zu Fuß den Weg fortsetze, bis man Varennes im Rücken hatte.
In Schottland angekommen, wo das Schloß Holy Rood die Entthronten aufnahm, hatte die Herzogin Maria Caroline von Berri nur einen Plan: die Krone Frankreichs für ihren Sohn [730] den Herzog von Bordeaux, als Heinrich V. wieder zu erringen. Vielleicht kam zu diesen politischen Plänen noch eine gewisse der Herzogin innewohnende Romantik. Wie alle Bourbonen, hatte sie ihre Blicke auf die Vendée geworfen. Die Vendée ist Frankreichs königliches Wappenfeld. Dort schlagen die Herzen höher bei dem Rufe: „Vive le roi!“
Die Vendée war auch ein Hauptziel der Herzogin, von dort sollte, so hoffte sie, die Bewegung ausgehen, in deren Verlauf ihr Kind, geschmückt mit der Krone von Frankreich, wieder in die königlichen Hallen der Tuilerien einziehen würde. Trotz aller Hindernisse und Gegenreden verließ darum Maria Caroline England und ging nach Italien. Eine Reise in das südliche Frankreich, um die Stimmung zu sondiren, ward durch die Agenten der Regierung unterbrochen; doch hatte die Herzogin sich genugsam überzeugt, daß in gewissen Kreisen der Aufruf zur Erhebung für das Haus Bourbon Anklang finden werde.
Wie die Herzogin ihre Reise, ihre Ankunft in Marseille bewerkstelligte, ohne von den Spähern entdeckt zu werden, ist ein Geheimniß geblieben. Am 30. April 1832 fand in Marseille die erste Schilderhebung der Bourbonisten statt. Wie sie verunglückte, das zu erzählen, bedarf einer für diesen Zweck zu langen Auseinandersetzung. Flüchtend, von Ort zu Ort im Schutze der Nacht, im Dunkel des Waldes, belauschen wir Maria Caroline. Sie schläft, in ihren Reisemantel gehüllt, auf der Erde, unter freiem Himmel. Sie ruht, zitternd vor Frost, nach langer Wanderung in der Hürde eines Schäfers aus. Der zarten Frau versagen die Füße, die nur gewöhnt sind, den Parquetboden königlicher Zimmer zu betreten, den Dienst. Sie schläft ermattet ein. Sie träumt von Kronen, von dem Jubel des Einzuges in Paris. Endlich wird sie von ihren Getreuen geweckt. Man hatte einen Wagen gefunden, und die Herzogin konnte die mühevolle Reise wenigstens fahrend vollenden. Ihr Ziel war die Vendée, dorthin ging der Zug ihres Herzens. „Auf Wiedersehen in der Vendée!“ das war der Ruf, als sie sich von ihren Begleitern trennte.
Nur von einem Getreuen beschützt, jede belebte Straße vermeidend, ist die Herzogin auf dem Wege nach der Vendée jeder Gefahr ausgesetzt. Verdächtige Patrouillen von Gensdarmen gewahrte man zu verschiedenen Tageszeiten, und endlich, es unterlag keinem Zweifel – ward die Kutsche verfolgt. Was beginnen? Die Reiter mußten die Papiere der Reisenden sehen und – wenn sie die Herzogin erkannten? In der Nähe ist kein schützendes Haus. Der treue Führer kannte alle Bourbonisten auf der ganzen, langen Reiseroute. Immer näher kamen die Gensdarmen. „Ist keine Behausung zu erreichen, die uns verbergen könnte?“ flüsterte die Herzogin.
„Ich kenne keine, deren Wirth ein Bourbonist wäre. Wollen Sie das Aeußerste wagen, Madame? Das nächste Gut ist Eigenthum eines Republikaners.“
„Hin zu ihm, schnell!“
Der Besitzer des Hauses eilte herbei. „Mein Herr,“ sagte Maria Caroline, „ich kenne Ihre Gesinnungen, aber für eine Proscribirte, wie ich es bin, giebt es keine Meinung: ich bin die Herzogin von Berri.“
Der Republikaner reichte der Flüchtigen seine Hand. Die Herzogin schlief unter dem Dache seines Hauses sicher vor den Nachstellungen ihrer Feinde. Hier suchte Niemand die Mutter des Herzogs von Bordeaux, Niemand dachte daran, daß der Republikaner dem Haupte der Bourbonenfamilie ein Obdach gewähren, daß er am folgenden Morgen, beim Grauen des Tages, neue Pferde herbeischaffen würde, mit denen Maria Caroline nach vielen Gefahren in das Haus eines ergebenen Freundes gelangte. Endlich in der Vendée – endlich in der Mitte jener alten, ländlichen Barone, jener Pächter und Waldläufer, die bereit waren, auf das Zeichen der Sturmglocke die Waffen zu ergreifen, die Fahne der Bourbonen zu erheben und sich mit dem Rufe: „Es lebe Heinrich der Fünfte!“ in den Tod zu stürzen!
Die Herzogin war an allen Orten zugleich. Sie entwickelte eine ungeheuere Thätigkeit. Sämmtliche Correspondenz, die Geldangelegenheiten, die Pläne, Alles ging von ihr aus, war das Werk ihrer Hände, der Entwurf ihrer glühenden, rastlos arbeitenden Phantasie. Nicht genug, daß diese gewaltige Last einer Frau oblag. Sie mußte es Alles heimlich, verborgen unter dem Schutze des Gastrechtes ausführen. Die Landleute hüteten die Wohnung der Herzogin, und die Gemeinde von Legé, woselbst Maria Caroline verborgen wohnte, gab ihr in der That rührende Beweise von Anhänglichkeit. Von hier aus erließ sie die Proklamationen, aber den Streifcolonnen gelang es nicht, ihrer habhaft zu werden. Hier empfing sie unter anderen Berryer, den bekannten legitimistischcn Advocaten. Als er an die Wohnung der Herzogin kam, mußte er das Losungswort geben. Man antwortete aus dem Innern des Hauses in verabredeter Weise. Dann öffnete eine alte Frau, in Begleitung eines stämmigen Burschen, dessen Hand mit dem eisenbeschlagenen Knittel der Vendéer bewaffnet war, die Thür.
Berryer ward in ein ärmliches Zimmer geführt. Hier sah er sich einer Frau gegenüber. Es war die Herzogin. Sie trug einen leinenen Kopfputz, die Tracht der Bäuerinnen jener Gegend. Berryer war ein Gegner der Erhebung. Er beurtheilte die Sachlage mit seinem kalten, ruhigen Verstande. Allein die Herzogin hörte auf keine Rathschläge. Sie wollte handeln für die Sache ihres Kindes, und an demselben Abende, wo Berryer sie verließ, richtete sie an die Häuptlinge der bourbonischen Verschwörung ein Schreiben, in welchem sie die Nacht vom 3. zum 4. Juni als den Zeitpunkt des Ausbruchs bezeichnete. In Manneskleidern ging Maria Caroline von Ort zu Ort. Sie bereitete, unterstützt von einigen phantastischen Köpfen, die Schilderhebung der Vendée vor. Sie hieß bei ihren Gefährten Petit Pierre und entging, in der Verkleidung eines Bauern der Vendée, den Forschungen der Behörden.
Die Juliregierung, unterrichtet von dem sich vorbereitenden Aufstande, ließ kein Mittel unbenutzt dem drohenden Ereignisse gerüstet entgegentreten zu können. Mobile Colonnen unter Commando des General Dermoncourt durchstreiften das Land, untersuchten die Schlösser, und eine derselben war so glücklich, höchst wichtige Papiere aufzufinden, welche der Regierung alle Pläne und Namen der in die Verschwörung verflochtenen Persönlichkeiten verriethen. Mit einem Schlage wechselten jetzt die Rollen. Statt angegriffen zu werden durch die Vendéer, griff die Regierung diese an, und als am 4. Juni 1832 die Sturmglocke in der Vendée die Kämpfer für Heinrich V. zu den Waffen rief, fanden diese überall einen schlagfertigen Feind, der nicht wartete, bis sie sich in Reih und Glied gestellt, sondern der über jeden, oft ganz ohne alle Absicht sich zusammenfindenden Trupp Vendéer herfiel und ihn zerstreute. Vereinzelt brach überall der Aufstand aus, und so ward er einzeln niedergeworfen.
Die Herzogin war auf die erste Nachricht der Erhebung in den Kampf geeilt. Durch eine fliegende Colonne erkannt und verfolgt, mußte sie in einem Dickicht die Nacht verbringen; während dieser Zeit hatte das blutige Drama geendet. Am folgenden Tage entkam die Herzogin nur durch schnelle Wechselung der Kleider mit einer Bauerfrau der Verhaftung. Heute nahm ein Schloß die Flüchtende auf, morgen war eine Windmühle ihr Obdach, am nächsten Tage ein Pachthof. Hierher kamen, flüchtig, verfolgt, durch das Dickicht sich schlagend, Verwundete aus den Gefechten. Noch ein Mal wollte Maria Caroline zu den Kämpfenden eilen, aber wieder zeigten sich die Colonnen Dermoncourt’s von allen Seiten, und der General hatte die Versicherung gegeben: „Er werde Madame und deren Begleitung ohne Gnade niederschießen lassen.“
Trotz der wüthendsten Tapferkeit unterlagen die Vendéer. Während dieser Kämpfe waren Unruhen in Paris, bei Gelegenheit des Leichenbegängnisses des Generals Lamarque, ausgebrochen. Mit doppeltem Eifer bekämpfte daher die Regierung die Bewegungen. Immer enger zog sich das Netz um die Vendée und die Anhänger des Hauses Bourbon, die Kämpfer alle und zuletzt Maria Caroline verzweifelten an dem Ausgange. Die Sache Heinrich’s V. war verloren.
Wieder ist die Herzogin eine Geächtete, eine Umherirrende; wieder eilt sie von Dorf zu Dorf, von Gehöft zu Gehöft. Aber dieses Mal ist sie nicht erfüllt mit stolzer Hoffnung auf kommende Siege oder Erfolge, welche dem Ermattenden neue Kraft geben. Sie ist eine Geschlagene, die nur noch den sicheren Zufluchtsort zu erreichen suchen muß, eine trostlose Mutter, deren schönste Aussichten in die Zukunft vernichtet sind. Aber der Geist Maria Carolina’s blieb ungebeugt. Als Bäuerin verkleidet und von einer getreuen Gefährtin begleitet, gelangte sie glücklich in die alte Stadt Nantes. Als sie durch das Thor getreten waren, fielen die Blicke der Flüchtlinge auf ein Placat der Regierung, welches die Ueberschrift trug:„Etat de Siège“. Nantes befand sich in Belagerungszustand. Die Herzogin eilte weiter durch die Straßen und half [731] einer alten Frau die Körbe packen, weil die Alte die beiden Verkleideten für wirkliche Bäuerinnen hielt und sie um Hülfe bat. Endlich nahm das Haus der Familie Duguigny in der Straße Haute du Château die Flüchtenden auf. Hier blieb Caroline fünf bis sechs Monate lang verborgen. Wie dies möglich war, ist fast nicht zu begreifen, wenn man nicht den Ansichten der Tageblätter beipflichten will, die behaupteten, daß die Regierung sehr Wohl um den Aufenthalt der Herzogin wisse, sie aber nicht fangen wolle. Maria Caroline führte immer noch eine Correspondenz mit ihren Anhängern von diesem Schlupfwinkel aus, sie empfing Besuche, sie ward lebensgefährlich krank. Alles dies konnte geschehen, ohne – zur Ehre der Nation muß es gesagt sein – ohne daß sich ein Verräther fand, denn wenn auch vielleicht die Regierung ein Auge zudrücken wollte, so machte sie doch gewaltige militärische und polizeiliche Anstrengungen, und leicht konnte irgend ein Mensch sich vorfinden, der den Preis des Verrathes erringen mochte.
Er fand sich auch, aber es war kein Franzose, sondern ein gewisser Simon Deutz aus Köln, der sich in das Vertrauen der Herzogin einzuschleichen gewußt hatte, das er bald so besaß, daß er in den wichtigsten Angelegenheiten ihr Agent wurde. Er war es, der am 6. November die zur Gefangennahme der Herzogin beorderten Militär-Colonnen um das Haus aufstellen ließ, wo Maria Caroline verborgen.
„Retten Sie sich, Madame,“ rief plötzlich einer ihrer Getreuen, „ich sehe rund herum um das Haus Bayonnete blitzen.“ Der Mond war aufgegangen, und man konnte deutlich das Funkeln der Waffen sehen. Volk lief zusammen, von allen Seiten rückte Militär gegen das Haus.
„Eilen Sie in Ihr Versteck, Madame,“ riefen die Freunde.
In diesem kritischen Augenblicke zeigte die Herzogin eine seltene Ruhe und Beherrschung. Sie warf einen Blick durch das Fenster auf die herannahenden Soldaten und begab sich langsam in ihr Versteck. In einer Mansarde des dritten Stockes im Duguigny’schen Hause war hinter dem Kamin ein kleines Kämmerchen, dessen Eingang durch die Kaminplatte gebildet und verschlossen wurde. Den Hintergrund des Zimmers gab die äußere Mauer des Hauses, auf welcher die Dachsparren ruhten, welche wiederum das Versteck von oben schützten und bedeckten. Vorn am Eingang hatte dieser Raum achtzehn Zoll Breite, gegen das Ende zu nur acht bis zehn Zoll, dabei eine Länge von drei bis vierthalb Fuß.
Als die von den Commissären eingeführten Soldaten in das Haus drangen, waren die Compromittirten bereits in ihrem Verstecke. Man denke sich vier Personen in dem beschriebenen engen Raume. Auf den ersten Blick konnte man wahrnehmen, daß Deutz die Behörde von Allem genau unterrichtet hatte. Die Commissäre gingen in dem Hause umher, als wären sie alte Bekannte. Nichts war zu entdecken. Bald aber befanden sich die Verborgenen in höchst peinlicher Lage. Dumpfe Schläge gegen die Mauer des Nachbarhauses, welche den Schlupfwinkel begrenzte, zeigten ihnen an, wie eifrig gesucht ward. Schon fielen größere und kleinere Stücke Mauerwerk auf die Geängstigten herab, der Kalkstaub zog in dichten Wolken durch das enge Gemach. Fest aneinandergepreßt standen die Herzogin und Fräulein von Kersabiec, die Herren Mesnard und Guibourg hatten sich auf dem Boden zusammengekauert. Nährend dessen ward das ganze Haus durchwühlt, aber nach einer siebenstündigen Untersuchung gab der Präfect die Hoffnung auf.
Die Gefangenen des Mansard-Zimmers athmeten ein wenig freier. Sie konnten nicht wissen, was vorging, aber sie hörten die Tritte abmarschirender Soldaten. Die Nacht brach herein. Sie flüstern schon untereinander von Rettung, von Flucht – da – horch! In das Zimmer vor dem Schlupfwinkel treten Leute. Das Klirren ihrer Säbel, die Reden welche sie führen, zeigen deutlich, daß es Gensdarmen sind. Die Flüchtlinge halten den Athem an. Eine schneidende Kälte dringt durch die Ziegel des Daches, die Zähne klappern, die Hände und Füße sterben ab. Da knistert es in dem Kamine, dessen eiserne Platte die einzige Scheidewand zwischen den Verfolgten und ihren Häschern bildet, die Soldaten haben Feuer gemacht; das thut den fröstelnden Gefangenen wohl, aber was ihnen anfangs ein Glück schien, wird ihr Verderben. Immer glühender wird die Eisenplatte, immer furchtbarer die Hitze in dem engen Raume, zwei Mal faßt das Feuer die Kleider der Damen, man löscht es mit den Händen, welche sofort die Brandmale zeigen. Will man die Lage ändern, muß man über den Andern hinwegsteigen; so gelangt die Herzogin dicht an die glühende Platte. Sie hält mit furchtbarer Resignation aus. Das Feuer erlischt, die Soldaten schnarchen. Die Nacht vergeht. Fast ohnmächtig vor Hunger, Erschöpfung und Erregung sehen die Gefangenen das Tageslicht durch die Ritzen des Daches schimmern. Kaum graut der Tag, so beginnen die Arbeiten gegen die Mauern des Hauses von Neuem, Stöße, Schläge mit Eichenbohlen machen das ganze Hotel Duguigny erzittern. Dann tiefe Stille.
Darauf wieder neue Arbeit. Dicht an der Kaminplatte wühlt und hämmert es, die Steine bröckeln ab; schon glauben die Gefangenen, der Augenblick der Entdeckung sei gekommen, da lassen die Arbeiter in ihren Forschungen nach. „Wir sind gerettet,“ flüstert die Herzogin. Alle drücken sich die Hände. Umsonst – die Wachen erscheinen wieder, und das verderbenbringende Feuer knistert im Kamine. Einer der Soldaten hat unglücklicher Weise ein Paket Acten aufgestöbert, mit denen er das Feuer unterhält. Zu der Qual der Hitze gesellt sich die des Rauches. Schon müssen die Eingesperrten den Mund an die Oeffnungen der Dachsteine legen, um athmen zu können, während ihre Kleider neue Brandflecken zeigen. Die Stunde der Entdeckung war gekommen. Nicht fähig mehr dem Rauch und der Gluth zu widerstehen, öffneten die Herren auf Befehl der Herzogin die Platte durch Fußtritte.
Ein „Wer da?“ der Gensdarmen beantwortete den mit fester Stimme ausgestoßenen Ruf: „Ich bin die Herzogin von Berri, öffnet die Platte.“ – Das Erstaunen war maßlos. Es theilte sich dem auf der Straße versammelten Volke gleichfalls mit. General Dermoncourt eilte herbei, Erfrischungen aller Art wurden den Erschöpften gereicht. Groß war die Theilnahme, welche die heroische Frau und deren treue Begleiter erweckten. Der Gegner der Herzogin, Dermoncourt, rief aus: „Diese Frau ist eine Heldin!“
Maria Caroline ward mit allen Ehren und den einer Fürstin gebührenden Auszeichnung behandelt. Aber ihre Sache war verloren. Um sie den Augen der erregten Menge so schnell wie möglich zu entziehen, brachte man sie auf die Brigg La Capricieuse, welche sie am 11. November von den Küsten Frankreichs hinwegführte. Sie wird das Land ihrer Wünsche, ihrer Hoffnungen wohl nicht mehr betreten dürfen, und gleich vielen Andern, findet auch ihr Bildniß im Palaste Vendramin eine passende Stelle unter den Gegenständen, welche die Erinnerung an herbe Schicksale wach rufen. – Daß die Herzogin den Besucher des Palastes lebhaft interessirt, ist begreiflich. Ihr Leben, ihr Dulden, ihr Handeln sind nicht minder interessant, als die jener Personen, welche im Schimmer der Romantik, verklärt durch entschwundene Jahrhunderte, vor uns stehen. Ein Faden des großen Geschichtsnetzes verbindet außerdem Venedig immer mit Frankreich, und gerade in diesem Augenblicke erzittern die Fäden des Gewebes mehr als je. Wo die Convention Italien-Frankreich neue, große Ereignisse, deren Mittelpunkt Venedig sein dürfte, vorbereitet, war es vielleicht nicht ohne Interesse, das Tusculum einer französischen Fürstin in der Stadt zu betrachten, nach welcher sich unsere Blicke jetzt erwartungsvoll richten.
Maria Caroline theilt in Allem die Schicksale so mancher im Palaste Vendramin durch sie verherrlichter Persönlichkeiten, und das Gemäuer des alten, mächtigen Gebäudes scheint sich nicht hergeben zu wollen zur Ruhestätte seiner Insassen. Wie seine Erbauer, so ist auch seine jetzige Besitzerin fern von ihm auf einsamem Schlosse in den schönen, stillen Bergen Steiermarks.
Besteigen wir wieder die Gondel, die uns hinwegführt von dem Palaste Vendramin! Werfen wir noch einen Blick auf das stolze Haus! Da, auf dem Gemäuer, steht in schwarzer Schrift – tief in den Stein gehauen – gleich einer Entschuldigung dem Geschicke gegenüber, ein kurzer Spruch der Vendramins: „Non nobis“ „Nicht für uns.“ Der Spruch ist zum traurigen Symbole für Alle die geworden, welche sich Besitzer des Palastes nannten. „Non nobis“ sollte aber auf allen Palästen Venedigs stehen, besonders auf den Mauern derer, die den Canal grande zieren, durch dessen gewaltiges Thor, Ponte di Rialto, wir so eben, in ernste Stimmung versenkt, mit der pfeilschnellen Gondel gleiten.
[732]
„Haben Sie von dem gräßlichen Brandunglück in – stadt gelesen? Hundertfünfzig Häuser, worunter sämmtliche öffentliche Gebäude, liegen in Asche! Mehr als achthundert Menschen jedes Alters und Geschlechtes sind nicht nur obdachlos geworren, sondern haben Alles, was sie besessen, verloren! Versichert sind die Wenigsten, und welch’ trauriger Zukunft sehen diese entgegen! Das Schrecklichste ist aber, daß eine ganze aus acht Gliedern bestehende Familie, bis auf ein Mädchen von zehn Jahren, den schauderhaften Tod in den Flammen gefunden hat!
Schnell muß hier geholfen werden, und jeder Menschenfreund wird sein Scherflein beitragen, um die Noth zu lindern.“ Mit diesen Worten tritt uns ein Freund entgegen, der so eben die Unglücksbotschaft vernommen, indem er hinzufügt, daß freilich zum guten Theil die große Ausdehnung des anfangs unbedeutenden Schadenfeuers den höchst unzureichenden Löschanstalten, wie dem Mangel an jeder Organisation der „Feuerwehrmannschaften“ zu danken sei; ebenso falle diesem Umstande der Tod der in den Flammen Umgekommenen zur Last.Leider ist man an gar vielen Orten noch sorglos genug, der Organisation des Feuerwehrwesens nicht die nöthige Aufmerksamkeit zu schenken. Um aber würdigen zu können, wie viel von einer wohlorganisirten und disciplinirten Feuerwehr abhängt, braucht man sich nur einmal die Thätigkeit sogenannter „wilder“ Mannschaften bei einem Schadenfeuer etwas näher anzusehen. Es ist mitten in der Nacht, als die Sturmglocke ertönt und die Ortsbewohner aus dem Schlummer aufgeschreckt werden. Das Horn des Nachtwächters läßt seine schauerlichen Töne vernehmen, und mitten in den Lärm mischt sich der vielstimmige Ruf: Feuer! Der Dachstuhl eines mehrstöckigen Hauses steht bereits in vollen Flammen, und es wird Sorge der Feuerwehr sein, das Feuer nicht allein direct anzugreifen, sondern auch, was hauptsächlich in’s Auge zu fassen ist, eine ungefähr zwanzig Schritt davon entfernt stehende Scheune, welche die Verbindung mit einem besonders feuergefährlichen Hausercomplex herstellt, zu decken, denn schon erhebt sich der Wind nach dieser Richtung hin. An diesen bedrohten Punkt muß so schnell wie möglich eine Spritze, die ununterbrochen in Thätigkeit zu halten ist, postirt werden.
Drei Spritzen aus dem Orte kommen herangefahren. Die Besetzung ist aber nur spärlich, und die Spritzenmeister greifen zu dem üblichen Mittel, die nöthigen Mannschaften aus den zahlreichen müßigen Zuschauern, die sich eingefunden haben, zu pressen. Der Bürgermeister, der gleichzeitig als Feuerwehrcommandant fungirt, giebt dem Führer einer Spritze den Befehl, die Scheune zu halten. Aber seine Worte verhallen vor dem Schreien und Toben der Mannschaften, die sich mit einer wahren Wuth auf die Spritzen stürzen, um sie in Stand zu setzen, und durch dieses planlose Draufgehen die schönste Unordnung, namentlich hinsichtlich des Legens der Schläuche, hervorbringen. Der Bürgermeister erneuert seinen Befehl. Umsonst; man sagt ihm geradezu in’s Gesicht, daß er gar nichts zu befehlen habe. „Was sollen wir da hinten, wo es gar nicht brennt? Der Herr Commandant versteht nichts, das haben wir immer schon gesagt.“ Diese und andere ähnliche Redensarten, die der beklagenswerthe Mann, ohne etwas dagegen thun zu können, schweigend anhören muß, erschallen wie aus einem Munde. Eine fernere Anstrengung seinerseits, eine Wasserreihe aus dem gaffenden Publicum zu bilden, schlägt ebenfalls fehl, und als er selbst zwei Eimer ergreift, um aus dem höchstens dreißig Schritt entfernten Flusse Wasser zur nächsten Spritze zu tragen, wird dies keineswegs als eine Aufforderung betrachtet, seinem Beispiele zu folgen. Die Leute sehen ihn vielmehr gleichgültig an und glauben, daß diese Verrichtung gewissermaßen mit zu seinen Amtsverrichtungen gehöre. Mit vieler Mühe sind endlich die Spritzen mit Wasser, das durch die gebräuchlichen unpraktischen Sturmfässer herbeigeschafft worden ist, gefüllt; die Mannschaften setzen die Druckbäume in Bewegung, aber, ganz abgesehen davon, daß das Wasserquantum bald consumirt ist und nur mit großen Unterbrechungen erneuert wird, haben sich die Rohrführer so postirt, daß der Wasserstrahl mit seinem äußersten Ende gleich einem sanften Sprühregen die Gluth erreicht und diese dadurch nur vermehrt. Jetzt rasseln noch drei Spritzen aus benachbarten Ortschaften herbei; allein die Mannschaften derselben fügen sich ebenso wenig den Anordnungen des Bürgermeisters, der ihnen befohlen hat, die immer mehr und mehr bedrohte Scheune zu halten. Sie gehen vielmehr ganz auf eigene Faust vor und steigern dadurch nur die bereits im höchsten Grade herrschende Unordnung.
Unterdessen wird in dem brennenden Hause arg gewirthschaftet. Ganz unberufene Leute haben sich in dasselbe gedrängt, zerschlagen Thüren und Fenster, schleppen Möbel und Gegenstände aller Art, ohne auf deren Schonung Rücksicht zu nehmen, aus den Zimmern, oder werfen diese aus den oberen Stockwerken auf die Straße. Diese destructive Gesellschaft nennt das ironisch genug „retten“, und wie die Besitzer ihr Eigenthum gegen solche Behandlung schützen wollen, wird ihnen in der unglimpflichsten Weise entgegengetreten.
Da bricht plötzlich das längst gefürchtete Ereigniß ein: die Scheune hat Feuer gefangen und im Nu steht das Dach in Flammen, die sich in Folge des heftiger gewordenen Windes den daranstoßenden Gebäuden mittheilen. Ein allgemeines sauve qui peut entsteht und ein großer Theil der Mannschaften verläßt die Spritzen, unter ihnen diejenigen, welche in dem bedrohten Stadttheile wohnen, während die Uebrigen gar nicht daran denken, den Standort der Spritzen zu verändern. Sie sind überhaupt weit entfernt davon, ihre Pflicht zu erfüllen, und besitzen auch, bis auf Wenige, gar nicht mehr die Fähigkeit dazu, denn sie befinden sich in Folge von im Uebermaße genossenen geistigen Getränken, die ihnen nach althergebrachter Unsitte geliefert worden sind, in einem sehr bedenklichen Zustande der Aufregung und Schlaffheit zugleich. Während die Einen toll und ausgelassen sind, als feierten sie ein frohes Fest, schwanken Andere in seliger Stimmung hin und her, oder suchen allerlei Händel, oder blicken endlich, mit dem Rücken an die Spritze gelehnt, mit starren Augen regungslos in den gräulichen Wirrwarr.
Schon liegen vier Gebäude in Asche, und da das Löschen aufgehört [733] hat, so sucht man dem Feuer durch Einreißen des anstoßenden Daches Einhalt zu thun. Nichts hilft, denn die Gluth ist viel zu intensiv und überspringt die Lücken. Es brennt weiter, und hört auch nicht eher auf, als bis der zwanzig Häuser zählende Gebäudecomplex den Flammen zum Opfer gefallen ist. Auf dem Platze, wo die Spritzen stehen, mit denen eben gar nichts geleistet worden ist, herrscht fast vollkommene Ruhe. Sie sind von der Mannschaft verlassen; nur hinter einem umgestürzten Sturmfasse liegen einige Männer, nicht etwa um von ihren Anstrengungen auszuruhen, sondern vielmehr – um ihren Rausch auszuschlafen.
Dies eine kurze, aber bestimmt nicht übertriebene Schilderung der Thätigkeit nicht organisirter und ungeübter Mannschaften bei Gelegenheit eines Schadenfeuers.
Betrachten wir nun einmal das Gegenbild. Als Muster steht in dieser Beziehung die Berliner Feuerwehr da. Freilich ist dieselbe fest besoldet und militärisch organisirt, sowie vermöge der in den verschiedenen Stadttheilen vertheilten, unter einander und mit dem Polizeigebäude in telegraphischer Verbindung stehenden Feuerwachen in den Stand gesetzt, schnell bei einem Schadenfeuer zur Hand zu sein. Derartige Einrichtungen sind natürlich nur in größeren Städten möglich. Auf diese Vorzüge kommt es aber vor der Hand gar nicht an, betrachten wir vielmehr die Thätigkeit der alarmirten Mannschaften bei einer Feuersbrunst.
Sobald das Commando zum Instandsetzen der Geräthe erfolgt, begiebt sich Jeder, ohne ein Wort zu sprechen, an seinen Posten, und in wenigen Minuten ist Alles fix und fertig. Das nöthige Wasser liefert entweder die Wasserleitung, oder es wird durch große, mit zwei Pferden bespannte Wasserfässer, und nebenbei auch durch von der Mannschaft transportirte Rädertienen in der nöthigen Menge herbeigeschafft. Die Spritzenmannschaften beginnen ihre Thätigkeit, und in das brennende Haus werden, dafern dies nöthig, Feuermänner beordert, welche die Möbel von den Wänden in die Mitte jedes Zimmers rücken und mit einer wasserdichten Decke überdecken, um sie auf diese Weise vor dem aus den oberen Etagen gewöhnlich zuerst an den Wänden herablaufenden Wasser zu schützen. Befinden sich in der Nähe des Feuers leicht brennbare Gegenstände, so werden diese schleunigst durch die Mannschaften, denen die dazu nöthigen Geräthe zu Gebote stehen, entfernt. Um die Verbindung mit den oberen Etagen an der Außenseite des Hauses herzustellen, oder um Menschenleben, die sich in Gefahr befinden, von dort zu retten, werden die Rettungsleitern geschlagen. Hiervon wird jedoch nur in den allernöthigsten Fällen Gebrauch gemacht, denn es wird eben nichts ausgeführt, wozu kein triftiger Grund vorhanden ist. Bei einer größeren Feuersbrunst werden sofort die nöthigen Maßregeln getroffen, um die Ausbreitung zu verhindern. Das Feuer wird von allen Seiten energisch in Angriff genommen, und es ist bisher immer gelungen, derartige größere Brände, die nur dann entstehen, wenn die Feuerwehr zu spät alarmirt wird, in verhältnißmäßig kurzer Zeit zu löschen. Mit derselben Ruhe, wie die Mannschaft gekommen ist und gearbeitet hat, geht sie auf gegebenen Befehl zurück, macht die verschiedenen Geräthe zum Abmarsch fertig und fährt nach ihren Wachen ab.
Dieses System muß von jeder freiwilligen Feuerwehr befolgt werden, wenn sie den Anspruch auf Organisation und Disciplin machen will. Das wird übrigens allenthalben begriffen. Gar zu peinlich braucht man dabei in Bezug auf gewisse Einzelheiten nicht zu sein; die Hauptsache bleibt, daß die Mannschaften das gegebene Commando befolgen und schnell ausführen, und dazu gehören natürlich Unterordnung und Uebung.
Auch die Leipziger Turnerfeuerwehr genießt eines wohlverdienten Rufes. Wir geben im Nachstehenden die Abbildungen einiger von ihr benutzten Geräthschaften, die sich durch ihre Zweckmäßigkeit zu allgemeiner Annahme empfehlen. Die von der Turnerfeuerwehr bedienten Spritzen sind sogenannte zweirädrige Pariser Karrenspritzen, welche ab- und aufgeladen werden müssen. Die Zweckmäßigkeit dieser Spritzen, namentlich in Städten, steht außer allem Zweifel, denn erstens lassen sie sich sehr leicht transportiren, und zweitens können sie ohne besondere Schwierigkeiten selbst in enge Räume gebracht werden. Die Druckbäume werden durch Unterdruck in Bewegung gesetzt, und es sind zur unausgesetzten Bedienung einer Spritze, einschließlich Ablösung, etwa zwanzig Mann erforderlich. Die Spritze kann indessen schon von drei Mann ab- und aufgeladen werden. Das Abladen zeigt Figur 1, während das Aufladen durch Abbildung 2 veranschaulicht wird. Die gebräuchlichen Rettungsleitern (Figur 3 und 4) sind einholmig; um dieselben von der Leiter aus in höhere Stockwerke zu schlagen, befestigen sich die Steiger mittelst entsprechend großer, am Leibgurt festgenähter Carabinerhaken um den Holm (s. Figur 3), wie dies in ähnlicher Weise auch bei der Berliner Feuerwehr geschieht. Zur Rettung von Menschen dienen Rettungsschlauch und Fangtuch, welche beide in solchen Nothfällen vor so vielen anderen meistens complicirten Geräthen unbedingt den Vorzug verdienen.
Wie nöthig aber energische Verbesserungen im Feuerwehrwesen geboten sind, dies stellen die vielen Brände der neueren Zeit zur Genüge heraus. Nach einer für das Jahr 1863 veröffentlichten Uebersicht der Landes-Immobiliar-Brandversicherungs-Anstalt des Königreichs Sachsen betrug die Zahl der Brände, nach welchen Entschädigungen (d. h. nur für zerstörte Baulichkeiten) gezahlt wurden, 865, und die verausgabte Summe belief sich auf anderthalb Million Thaler. Wie groß der Schaden an Mobilien etc. etc. gewesen sein mag, haben wir nicht in Erfahrung bringen können. Zu hoch dürften wir aber bestimmt nicht greifen, wenn wir den Gesammtschaden auf nahe an zwei Millionen Thaler veranschlagen. Von Menschenleben, die hierbei etwa zu Grunde gegangen oder doch auf dem Spiele standen, ist noch gar nicht einmal die Rede.
Einer Notiz aus Baiern zufolge, die uns zur Verfügung steht, betrug in diesem Lande der Schaden an durch Feuer zerstörten Baulichkeiten bei 615 Bränden anderthalb Million Gulden.
Sollte man Angesichts solcher Verluste nicht zur Vorsicht gemahnt werden? Gewiß. Lege man deshalb nicht die Hände ruhig in den Schooß, fange man vielmehr mit den nöthigen Verbesserungen bei Zeiten an, damit, wenn die Gefahr hereinbricht, man ihr mit Entschiedenheit entgegentreten könne und das Sprüchwott: Durch Schaden wird man klug, sich nicht bewahrheite.
Trotzdem sich überall eine recht löbliche Agitation zu Gunsten von Verbesserungen im Feuerwehrwesen kundgiebt, hat es in den meisten Fällen seine guten Wege, ehe es bis zu einer durchgreifenden That kommt. Es ist geradezu merkwürdig mit anzusehen, wie schwer es sich gewöhnlich die Menschen machen, das Ueberlebte zu beseitigen und dafür etwas Zweckmäßiges zu schaffen. Die leidigen Rücksichten und die Sucht nach Vielregiererei sind fast immer der Hemmschuh der freieren Entwicklung einer gemeinnützigen Sache, besonders einer freiwilligen Feuerwehr. Es fehlen dem Volke noch viel zu sehr die nöthige Hingebung, Opferfreudigkeit und Selbstverleugnung – Alles Eigenschaften, auf denen jegliche Selbstregierung basirt. Wäre es anders, so würden wir uns, wie es so häufig geschieht, besonders in gemeinnützigen Bestrebungen nicht gegenseitig das Leben verbittern und dadurch die Lacher auf jene Seite treiben, wo ohnedem jede Einrichtung, die aus dem Volke hervorgeht, von Haus aus bespöttelt wird.
[734] Eine freiwillige Feuerwehr muß ganz besonders die oben genannten Eigenschaften an die Spitze stellen, wenn sie mit Ehren bestehen und ihre Schuldigkeit erfüllen will. Von ihr fordert man strenge Beobachtung der selbstgeschaffenen Gesetze, und jemehr sie die schwere Tugend übt, sich den unbedingt nöthigen, in gleicher Weise entstandenen Disciplinarbestimmungen zu unterwerfen, desto tüchtiger wird sie sein, desto geachteter wird sie dastehen.
Wird aber durch so organisirte Genossenschaften nicht ein gut Stück Selbstregierung gewonnen und das freie Bürgerthum damit zugleich gekräftigt? Dies kann sicher nicht geleugnet werden. Deshalb ist sie auch die Schule des Gemeinsinns zu nennen. Schaffe man nur recht viele solcher Genossenschaften, sie sind die Bausteine eines kräftigen und freien Gemeinde- wie Staatslebens.
Die Feuerwehrbewegung hat namentlich in den Turnvereinen Grund und Boden gefunden, und wir können wohl die Zahl der Turnerfeuerwehrmänner in ganz Deutschland auf mindestens zwanzig Tausend veranschlagen. Dies ist sicherlich ein erfreulicher Beweis von der Thatkraft, welche das Turnen in dem Einzelnen erzeugt, und es ist sehr wünschenswerth, daß diese Bewegung sich nicht nur mehr und mehr ausbreite, sondern auch von allen Seiten die nöthige Unterstützung finde.
Jetzt, verehrte Leser, prüfen Sie das Gesagte, und wenn Sie von der Wahrheit desselben überzeugt sind, wie wir es hoffen, so treten Sie, falls es überhaupt noch nicht geschehen sein sollte, schleunigst in die edle Zunft der Feuerlöscher. Schaffen Sie sich Helm und Blouse an und werden Sie tüchtige Leute „bei der Spritze“! Durch dieses Vorgehen werden Sie nicht nur die dringliche Feuerwehrfrage erledigen, sondern auch die Lösung der deutschen Frage wird dann, und wir meinen dies ganz im Ernste, wesentlich gefördert werden.
Der Zufall wollte es, daß ich am 10. November mit eintretender Dunkelheit zu Coblenz den Eisenbahnzug bestieg, um nach Köln zurückzufahren. Als wir die Brücke über die Mosel passirt hatten, gewahrte ich an der Ecke der Landzunge, von welcher der lotharingische Fluß sich in den Rhein ergießt, ein mächtiges Feuer, um das sich eine Menge von kleinen Flammen springend und hüpfend bewegte, so daß das Ganze einen wunderlichen gespensterhaften Eindruck gewährte. Ich wußte mir die seltsame Erscheinung nicht zu erklären und hatte sie auch schon fast wieder vergessen, als sich auf dem weitern Verlauf der Fahrt durch die breitgestreckten Gefilde des sogenannten Neuwieder Beckens, wie man diese Ausbuchtung zu beiden Ufern des Stromes zwischen dem rechtsseitigen Westerwald und dem linksseitigen Maifeld, einer Partie der Eifel, nennt, an verschiedenen Orten dieselbe Scene wiederholte. Sowohl an den fernen Bergen wie in der Ebene erschienen nämlich ganz ähnliche größere Feuer, die von kleinen zuckenden Flammen umtanzt wurden.
Was hatten denn diese Freudenzeichen zu bedeuten? Ich dachte nach und fand die Lösung auf der Stelle. Am 11. November feiert die katholische Kirche das Fest des heiligen Martin. Heute war der Vorabend des Festes. Mit einem Male kamen mir die alten Angedenken der Jugend zurück. Ich erinnerte mich der Zeit, wo ich noch ein kleiner Knabe war und mit andern Knaben in den niederrheinischen Flächen zu Bergheim am Erft in die Schule ging und spielte und mich ganz besonders auf diesen Tag freute. Die Jugend wurde dann überaus lebendig in dem kleinen Städtchen. Irgend ein munterer kleiner Bursche, der zugleich ein keckes Mundwerk haben mußte, erschien mit Strohbüscheln umwunden und von seinen Genossen umgeben in der Straße. Diese Gestalt hieß das Martinsmännchen. Lärmend und schreiend begab sich darauf die lustige Schaar von einem Haus zum andern, klopfte an jede Thür und heischte Holz- und Strohbündel, die man auch nirgend zu weigern pflegte. Die hierbei übliche Ansprache hieß: „Gebt doch dem armen Martinsmännchen, Schuck, wie kalt!“ Die gesammelten Brennmaterialien wurden nun mitgeschleppt und waren zuletzt so reichlich, daß keiner mehr etwas tragen konnte. So ging es zum Thor hinaus auf einen hochgelegenen Platz im Felde. Das Holz wurde auf einen hohen Haufen geschichtet, das Stroh wurde an Stangen gebunden und zu Fackeln bearbeitet. Sobald aber die Nacht eintrat, zündete man ein Feuer an, dessen Flammen hoch in die Luft flatterten, und um dieses Feuer tanzte die Jugend mit ihren angesteckten Fackeln einen wilden phantastischen Tanz, indem sie zugleich wilde Lieder durch das weite Dunkel erschallen ließ. Diese Scene dauerte so lange, wie das Feuer hielt. Dann ging die junge Schaar nach Hause und hatte einen überaus vergnügten Tag gehabt, dessen Erinnerung sie in den stillen Betten ausschlief.
Als ich später das Gymnasium in Düsseldorf besuchte, fand ich noch das Fest wieder, aber es hatte hier eine ganz andere Gestalt angenommen. Die ländliche Feier war offenbar in eine städtische umgeschaffen worden. Wenn man nämlich am Martinsabend hinaus auf die Straße geht, so findet man in derselben fast die ganze Jugend in fröhlichem Auf- und Abwandern. In jeder Hand aber befindet sich ein ausgehöhlter Kürbis, der in einigen Bindfäden hängt und in dessen Innern eine kleine brennende Kerze steht, welche die Wände, aus denen allerlei Figuren ausgeschnitten sind, erhellt und, je nach der Farbe der Frucht, ein grünes, gelbes oder rothes Licht ausstrahlt. Die Kinder singen dabei in eintöniger Melodie folgendes Lied:
Sanct Märten, Sanct Märten,
Die Kalver (Kälber) han lang’ Sterten (Schwänze),
Die Jonge kriege Rabaue (Aepfel),
Die Weiter (Wichter, Mädchen) welln mer haue,
Die Jonge kriege gebackene Fesch,
Die Weiter werfe mer onger den Desch.
Darauf gehen die Kleinen nach Hause und beschließen den Tag, indem sie „über das Kerzchen (d. h. den Kürbis) springen“ und Aefel und Nüsse verzehren. Es muß noch dabei bemerkt werden, daß die Mädchen den ebenerwähnten Vers anders singen und ihn gegen die Knaben wenden, denen sie Prügel androhen und die sie unter den Tisch werfen wollen. Jedenfalls ist aber dieses Fest in seiner äußern Erscheinung allerliebst. So hat es denn auch manche der besten Düsseldorfer Maler zu Darstellungen aller Art angeregt. Vielleicht sind dem einen oder andern Leser davon die Bilder zu Gesicht gekommen, die Adolf Schrödter, Alfred Rethel, Eduard Geselschap und Ludwig Knaus dem Düsseldorfer Sanct Martinsabend gewidmet haben.
In Bonn fand ich während meiner Studienjahre die Feier wieder. Sie hatte indeß in der Gegend des Siebengebirges jene Form, unter welcher ich sie in meiner frühesten Jugend kannte. Wir versäumten es damals nicht, am Martinsabend auf den alten Zoll hinauszugehen und die hellen Freudenfeuer der Jugend aller jener Dörfer aus der Ferne anzuschauen, welche sich längs des Siebengebirges und der Vorhügel der rheinischen Höhen erstrecken. Da zuckten denn überall die Flammen empor, um dieselben übersprangen die dunkeln Gestalten mit ihren Strohfackeln, und es erklangen jene Lieder, die mein Freund und Meister, der treffliche Karl Simrock, besonders gesammelt hat.
Und woher stammt nun diese Feier? Wollte man ihren Ursprung in der katholischen Kirche suchen, so würde man sich sehr irren. Es ist bekannt, daß der christliche Cultus seine Feste den Festen aller Naturvölker angepaßt und sie so zu sagen in dieselben hineingeschmiegt hat. Alle alten Feste sind Producte der Natur, es sind Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterfeste. Die Kirche hat sehr wohl gethan, sie mit Heiligenfesten zu identificiren. Darüber ist ihr Ursprung aber nie verloren gegangen. Ostern entspricht dem Frühling, Pfingsten dem Sommer, Sanct Michael und Martin dem Herbste, Weihnachten dem Winter. Diese Vergleiche könnten noch weiter ausgeführt werden. Ich muß indeß hier auf die Forschungen unserer deutschen Mythologen verweisen. Jedenfalls ist auf die christlichen Feste viel von der alten heidnischen Feierlichkeit übergegangen. Und so ist auch das Martinsfest ohne Zweifel aus dem deutschen Heidenthum auf uns gekommen.
Mit dem Martinstage begann wahrscheinlich bei unsern altdeutschen Ahnen der Winter. Der Kreislauf des Jahres war vollendet. Die letzten Früchte lagen in der Scheune, der Wein, wenn sie nämlich schon Reben bauten, lag im Keller. Da war es schon der Mühe werth, den Abschluß der Feldarbeiten und den Beginn [735] der Winterruhe zu feiern. Dies geschah denn auch wahrscheinlich in reichlicher Weise. Vielleicht ist das Verzehren der Martinsgans ein Brauch aus uralter Zeit. Dieselbe mußte in neuem Weine schwimmen. Daher schreiben sich die Gastmahle um diese Tage, zu deren Ehren die Mönche allerlei schnurrige Lieder gedichtet haben:
Herbei, herbei zur Martinsgans,
Herr Burkart mit den Bretzeln – jubilemus –
Bruder Urban mit den Flaschen – cantemus –
Sanct Bartel mit den Würsten – gaudeamus –
Sind alle starke Patronen
Zur feisten Martinsgans.
oder:
Bruder Urban, gieb uns Wein,
So trinken wir und schenken ein,
Die Gans, die will begossen sein,
Sie will noch schwimmen und baden,
So wird uns wohl gerathen
Haec anseris memoria
Dann ist aber der Tag auch deshalb merkwürdig, weil an demselben der Pächter seinem Gutsherrn den Zins zu entrichten verpflichtet war. Dieser Gebrauch besteht am Niederrhein noch allerwärts. Außerdem ist Sanct Martin von mystischer Bedeutung in Beziehung auf das Wetter. An seinem Vorabende gehen die Winzer hinaus und betrachten den Himmel. Soviel Sterne dann am Himmel stehen, soviel Ohm Wein bringt die nächste Weinlese. Der in altdeutschen Gedichten vorkommende Martinsvogel ist von besonderer Vorbedeutung: glücklich, wenn er von der linken zur rechten Seite vor dem Wanderer hinfliegt; unglücklich, wenn er sich links vom Wege niedersetzt. Stellen dieser Art finden sich in Reinhardt Fuchs (s. Ausg. von Jakob Grimm, S. 151). Ob die Legendengestalt des heil. Martin, der bekanntlich seinen Mantel mit einem armen Manne theilt, in Zusammenhang mit dem altdeutschen Gotte Wodan steht, wage ich als Laie nicht zu unterscheiden. Der verdienstvolle Forscher der rheinischen Vorzeit, Montanus, stellt diese Hypothese auf.
Leider verschwinden die schönen alten Volksbräuche mehr und mehr vor denen einer sich verallgemeinernden Welt- und Lebensanschauung, welche alle Völker und deren Gesellschaftsschichten durchdringt. Damit soll aber diese Zeit und ihre Bestrebungen nicht getadelt sein, zumal da sie in staatlichen und politischen Beziehungen ungleich bessere und glücklichere Grundlagen gewonnen hat. Es ist nur eine falsche Richtung der Bildung, wenn man die alten Sitten und Bräuche verspottet und verlacht und auf diese Weise zu ihrem Verschwinden beiträgt. Solche Leute haben sich nie die Mühe gegeben, den eigentlichen Sinn dieser Herkömmlichkeiten zu erforschen, sonst würden sie die schönen Feste pflegen und hegen, statt daß sie dieselben beseitigen. Es ist ein Glück, daß man noch in der letzten Stunde auf diese uralten Heiligthümer aufmerksam gemacht und daß ernste Forscher sie wenigstens durch Aufzeichnungen erhalten haben, wie dies namentlich durch die Gebrüder Grimm und ihre Schule geschehen ist.
Auch die deutsche Kunst erleidet durch das Verschwinden der alten Volksfeste keine geringe Einbuße. In einer Zeit, wo der künstlerische Geist sich mit besonderer Vorliebe der Darstellung des Volkslebens zuwendet, hätten manche Vorgänge dieser Art willkommene Vorwürfe zur bildnerischen Darstellung geboten. Als Beweis mögen die oben erwähnten Martinsabendbilder aus der Düsseldorfer Schule gelten. Als Rheinländer, der von früher Jugend her mit den alten Bräuchen der Heimath bekannt ist und dem sie an das Herz gewachsen sind, habe ich gleichfalls versucht, die schönsten und anmuthigsten derselben in poetischer Weise zu schildern. „Die Maikönigin, eine Dorfgeschichte in Versen (Stuttgart, b. Cotta)“, ist ganz besonders in der Absicht entstanden, die verschwindenden Bräuche unseres Landvolks durch den ganzen Kreislauf des Jahres in einer poetischen Erzählung zu fixiren. In derselben heißt es vom Sanct Martinsabend (S. 61):
Drum klingt es rings, ob die Natur
Auch siechend stirbt, ob Berg und Flur
In Nacht schon liegt, noch einmal auf
In Strahlenlust, im Jubellauf.
Schau hin, das ist ein freudig Blitzen,
Denn hoch aus hundert Bergesspitzen
Erlodern hundert Feuer helle;
Im Lichte sprudelt auf die Welle
Des angeschwollnen wilden Rheines;
Es blinkt in’s Land des glühen Scheines
Lichtrothe Loh. In ihrem Glanze
Da springen keck zum Fackeltanze
Die lustberauschten Knaben hin.
Der Schein gestaltet sich dem Sinn
Seltsam wie ein Gespensterreigen.
Geworfne Flammenbündel steigen
Hoch in die Luft; ein zuckend Schrein
Phantastisch klingt in’s Thal hinein;
Es sieht so wirr und bunt und kraus
Gleich einer Hexenküche aus. –
Seltsame Erscheinung! So hatte ich es in meiner Kindheit gesehen und so sah ich es jetzt wieder. Ja, die Jugend läßt sich ihre Spiele nicht nehmen, das thun nur die erwachsenen Leute. Das reizende Maifest, die lustigen Schwingtage, die wilde Thyrjagd, die dem bairischen Haberfeldtreiben gleicht, sind in unseren Gegenden gänzlich verschwunden. Aber der Martinsabend unserer Kinder ist derselbe geblieben. So wird auch das Niklas- und Weihnachtsfest in zäher Lebenslust fortdauern. Ich muß indeß gestehen, daß ich über meinen heurigen Martinsabend im höchsten Maße erstaunt war. So glänzend und herrlich hatte ich ihn in meinen Leben nicht gesehen, wie auf dieser nächtlichen Fahrt. Besonders herrlich wurden die Feuer- und Fackeltänze, als wir unter Andernach in das engere Rheinthal gelangten. Dort erhoben sich über den Dörfern auf allen vorspringenden Kuppen hochauflodernde Feuersäulen, um welche sich die Knaben mit ihren brennenden Strohwischen tummelten. Es war das doppelt schön, weil sich diese Scenen in den Fluthen des breiten majestätischen Rheines spiegelten. Mitunter sah man auch jenseits der Bergränder rothe Gluthen gegen die Wolken steigen. Es waren die Feuer der landeinwärts gelegenen Orte. Wenn der Zug hin und wieder an den Stationen hielt, so vernahm man das alte Lied:
Der hellige Sint Märten
Dat es ’ne brave Mann.
Handeln die Thiere nur nach Instinkt, oder auch mit Ueberlegung, Vorbedacht und Berechnung? Die interessanten Beobachtungen, welche mein alter Universitätsfreund Wilhelm von Waldbroel (von Z.) für letztere Ansicht mitgetheilt hat, veranlassen mich, zur Bestätigung der selben einige Thatsachen aus meiner eigenen Erfahrung anzuführen.
In früheren Jahren besaß ich einen Fuchs, welchen ich aufgezogen und auf dem Hofe an einer Kette liegen hatte. Von meinem Wohnzimmer aus konnte ich ihn den ganzen Tag beobachten und hatte dadurch Gelegenheit, während vier Jahren fast täglich folgenden Schelmenstreich zu constatiren. Sobald Meister Reinecke sein Mittagsmahl verzehrt hatte, fanden sich viele Vögel, besonders Rothschwänzchen, ein, welche die Reste seines Mahles verzehren wollten. Anfangs setzte sich der Fuchs in die Nähe seiner Schüssel und suchte, jedoch stets vergeblich, einen Vogel zu erhaschen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen legte sich der Erzschelm auf den Rücken, schloß halb und halb die Augen und stellte sich schlafend, um die Vögel zutraulich zu machen, was ihm auch so gut glückte, daß er fast täglich einige, welche über ihn hin- und herflogen, erschnappte. Ebenso charakteristisch ist eine andere Thatsache. Im Jahre 1859 jagte ich in den Rheinbergen in der Nähe der vielbesungenen Lorelei. Während zwei Jagdfreunde mit mir die Rückkehr unserer Hunde abwarteten, sahen wir in einer uns gegenüberliegenden Bergwand, welche nur mit einzelnen kleinen Büschen bewachsen war, einen Fuchs herumschleichcn und beobachteten ihn fast eine Stunde lang. Der Fuchs ging den ganzen Berg ab von einem Busche zum andern, stellte sich der Länge nach quer gegen den Busch und schlug mit seiner Ruthe durch die dem Kopfe entgegengesetzte Seite, wodurch der darin sitzende Vogel veranlaßt wurde, auf der Seite hinauszufliegen, wo der Kopf des Fuchsen sich befand, so daß er oft von demselben gefangen wurde. Eine halbe Stunde später hatte ich die Freude, den Räuber zu erlegen. Die sofort vorgenommene Section des Magens ergab, daß er bei seiner originellen Treibjagd, welche meines Wissens noch nirgend erwähnt worden ist, sieben Vögel erbeutet hatte.
Der Oberforstmeister von Wildungen theilt in seinem Taschenbuch vom Jahre 1796 mehrere andere interessante Fälle mit.
Ein Jäger, Abends auf dem Anstande nach einem Hirsche, sieht einen [736] alten Fuchs mit kräftigen Anläufen auf einen nahen und hohen alten Stock mehrmals hinauf und wieder herabspringen und endlich davonschleichen. Bald darauf erscheint er wieder mit einem dicken Eichenast im Maule und wiederholt nun so den vorigen Versuch, der anfänglich einige Mal mißlingt, so lange, bis er, auch mit dieser Bürde beladen, ohne Anstoß hinauf kommen kann. Nun läßt er seinen Ast herabfallen, drückt sich oben auf der ersprungenen Warte platt nieder und bleibt in dieser Stellung unbeweglich liegen. Der aufmerksame Waidmann kann trotz alles Nachsinnens den eigentlichen Beweggrund zu diesen wunderbaren Operationen nicht errathen. Aber was geschieht? Bei einbrechender Dämmerung tritt eine starke Bache mit fünf noch ganz kleinen Frischlingen aus der nächsten Dickung hervor. Sorglos zieht sie dicht an jenem alten Stocke vorbei, indeß zwei ihrer Kleinen ein wenig zurückbleiben. Kaum haben aber auch diese die gefährliche Stelle erreicht, als Meister Reinecke wie ein Pfeil auf eines derselben herabstürzt und auch im Augenblicke mit ihm sich recht glücklich wieder hinaufschwingt. Bestürzt über das Angstgeschrei des armen Schlachtopfers kehrt die Bache wüthend zurück, versucht es vergebens, zu seiner Rettung den hohen Sitz des verwegenen Räubern zu erklimmen, und muß endlich, nachdem sie ihn bis tief in die Nacht bestürmt hatte, voll Verzweiflung davongehen.
„Was dünkt meine Leser von dieser Geschichte,“ setzt Wildungen hinzu, „die ich gewiß selbst bis an mein Ende bezweifelt haben würde, wenn sie nicht deren Augenzeuge, einer der glaubwürdigsten Dianenpriester, die ich je gekannt habe, selbst noch in seinen letzten Stunden feierlichst bekräftigt hätte? Wenn die Thiere bloße Maschinen sind, wäre da nicht dieser Fuchs eine gar unbegreiflich kluge Maschine gewesen? Welche Speculationen, welche Erfahrungen, welche Vernunftschlüsse setzt dieser originelle Frischlingsfang nicht voraus! Hätte der scharfsinnige Mensch sich einen zweckmäßigern Plan ersinnen können, des leckern Bratens ohne Gefahr habhaft zu werden?“
Daß der Fuchs, wenn er sich mit einem Laufe in einem Eisen gefangen hat, sich den Lauf abbeißt, um sich zu retten, läßt sich ebensowenig durch den Instinct allein erklären, wie die Arbeiten der Ameisen, der Bienen, die ebenso künstlichen wie großartigen Wasserbauten der Biber, das Ausstellen der Schildwachen der wilden Gänse, Gemsen, Kraniche und Seekühe und viele ähnliche Erscheinungen bei anderen Thieren, welche alle auf Ueberlegung, Speculation und Berechnung hindeuten.
Am meisten zeichnet sich in dieser Beziehung der Hund, der treue Gefährte des Menschen in allen Welttheilen, aus, wie dieses schon durch die häufig vorkommenden Redensarten: „der Hund hat Menschenverstand“, „dem Hunde fehlt blos die Sprache“ etc., sowie durch das Epigramm:
„Hier liegt ein Hund, der fürwahr
Viel klüger als sein Jäger war –“
angedeutet wird. Es muß daher in der That Wunder nehmen, wie der Feder des Altmeisters Goethe das bittere Epigramm auf die Hunde entschlüpfen konnte:
„Wundern kann es mich nicht, daß Menschen die Hunde so lieben; Denn ein erbärmlicher Schuft ist, wie der Mensch, so der Hund.“
Wislicenus’ Bibel. Ueber dieses nunmehr complet erschienene Werk ging dem Verleger vor einigen Tagen folgendes treffende Urtheil eines bekannten Schriftstellers zu: „– – Kaum beschreiben kann ich die Ueberraschung, die es mir bereitete, als ich so Vieles, was mir schon vor langen Jahren in der biblischen Geschichte auffällig gewesen, in diesem Werke offen besprochen und in eben so klarer wie würdiger Weise zu einer Lösung gebracht sah, die sich bald augenscheinlich als Wahrheit herausstellt, bald mindestens das Gepräge der höchsten Wahrscheinlichkeit trägt. Wen es befremdet hat, daß verschiedene bisher erschienene Lebensbeschreibungen Jesu noch keinen gründlicheren Umschwung in der Meinung der Gebildeten über diesen Gegenstand hervorgebracht haben, der erkennt aus diesem Werke, wie viel an den herkömmlichen Vorstellungen über die ganze übrige biblische Geschichte, namentlich des Alten Testaments, und über die Entstehung der biblischen Bücher berichtigt werden mußte, ehe man an den Inhalt der neutestamentlichen Geschichte überhaupt mit dem rechten Verständnisse herantritt und für eine andere Anschauung empfänglich wird. Nach Lesung eines so scharfsinnig und ohne alle Befangenheit geschriebenen Buchs, dessen Verfasser nirgends die Folgerungen aus dem einmal für wahr Erkannten scheut oder sich vor der Tragweite seiner eigenen Erkenntniß fürchtet, ist es mir aber auch begreiflich geworden, warum jener im Anfang unseres Jahrhunderts beliebte Vernunftglaube keinen nachhaltigen Sieg erringen konnte. Wohl bekämpfte er viel Hergebrachtes, ließ aber dabei so viel mit seinem eigenen Geiste Unverträgliches stehen, daß hieraus Bollwerke für die Gegner wurden, von denen aus sie die neue Lehre bald mit den Waffen des Spotts, bald selbst in ernster Weise anzugreifen vermochten. Wislicenus kennt solche Halbheit nicht; er tritt den früher beliebten natürlichen Erklärungen der Wunder und den Versuchen, Widersprüche zu vereinigen, die sich nun einmal nicht vereinigen lassen, eben so entschieden entgegen, wie dem Glauben an die Wunder selbst und an übernatürliche Eingebung des Bibelworts; darum ist aber auch sein Werk eine feste Schlachtlinie, die sich nicht mit einigen hergebrachten Redensarten durchbrechen läßt. Sein Hauptverdienst scheint mir darin zu bestehen, daß er, obwohl ursprünglich durch Philosophie und Erfahrungswissenschaften auf seinen Standpunkt gelangt, doch die Beweise für seine Behauptungen fast durchgängig aus der Bibel selbst und aus der Vergleichung ihrer einzelnen Bücher schöpft und hier Entdeckungen macht, die jeden Unbefangenen zwingen, die Augen aufzuthun, und daß er, nachdem er viel umgestoßen, viel berichtigt, viel aufgehellt, schließlich doch von der bergehohen Spreu den Weizen zu sondern versteht und sich – was manche Gegner ungern lesen werden – der Bibel im innersten Herzensgrunde verwandt fühlt.“
Das Lied eines Dankbaren. Vor Kurzem sind die Leser der Gartenlaube an den am 23. Juni verstorbenen großen Freund und Kenner der Vögel, Ludwig Brehm, durch ein Bild von meisterhafter Künstlerhand und durch die Schilderung von kundiger und dankbarer Sohneshand erinnert worden. Ludwig Brehm war als Pfarrer, wie als Mann der Wissenschaft gleich ehrwürdig, dabei als Mensch so liebenswürdig und als Gesellschafter so heiter und unterhaltend, daß sich jeder glücklich preisen konnte, dem es auf längere oder kürzere Zeit vergönnt war, in seiner Nähe, ihn beobachtend und genießend, zu verweilen. Man schaute da einen außerordentlichen Mann, und doch in seiner Erscheinung einen so schlichten und in seiner Umgangsweise so kindlich harmlosen Menschen, daß man ihm nicht fern stehen blieb, sondern sich ihm auf das Innigste anschloß.
Als daher der Tag und die Stunde seiner Beerdigung gekommen war – es war Sonntag den 26. Juni, Nachmittag vier Uhr – da eilten nicht nur die Mitglieder der ihm anvertrauten Gemeinden, sowie die Bewohner der Nachbardörfer in der Runde, sondern auch mancher Freund und Verwandter aus der Ferne herbei, um dem theuern Dahingeschiedenen ein letztes Ruhe sanft! in die Gruft nachzurufen, und viele Thränen flossen dem liebevollen Gatten und Vater, dem treuen Seelenhirten und Freunde. Das Wetter war nicht eben freundlich, es war stürmisch und regnerisch; aber sowohl vor der Pfarrwohnung, wie auf dem Gottesacker fand die Trauerversammlung günstige ruhige Augenblicke, ja selbst die Sonne sandte freundliche Strahlen in das geöffnete Grab, in welches der Entschlafene eben gesenkt werden sollte. Der Sarg ward in das Grab hinabgelassen, und alle Anwesenden beteten still. Eine lautlose, heilige, wehmüthige Ruhe waltete über und um den menschenvollen Gottesacker. Da – als Glocken, Gesang und Rede schwiegen – da erhob ein Vöglein aus einem Gesträuch am Rande des Gottesackers seine Stimme – es war eine Grasmücke – und sang sein süßes Lied, das über die ganze Versammlung schallte; mitten in dieser Stille das Danklied eines Vogels, es war ein Moment ergreifendster Andacht.
Wie hätten auch die Vögel beim Begräbniß Ludwig Brehm’s schweigen können? Im Namen sämmtlicher Vögel der Erde, die Brehm alle nach ihren Arten und Unterarten kannte, sang die Grasmücke das Lob ihres großen Freundes und rief ihm mit ihren lieblichen Klängen Dank und Segen in die Gruft nach, ihm, der sie so oft und so freundschaftlich belauscht, der sie so viel bewundert und geliebt und sie bewundern und lieben gelehrt, der noch am Tage vor seinem Tode durch’s offne Fenster ihrem Gesange zugehört hatte. Wer das Lied dieses dankbaren Vogels am Grabe Ludwig Brehm’s vernommen, dem ist es gewiß tief zu Herzen gedrungen und wird ihm unvergeßlich bleiben. Dieses Lied des dankbaren Vogels bildete den schönsten, würdigsten und erhebendsten Schluß der Begräbnißfeierlichkeit, wie denn in der That die Töne dieses Vogels die letzten Klänge waren, welche bei der Beerdigung vernommen wurden.
Die Menge zerstreute sich hierauf still, und die Todtengräber verrichteten ihr Amt. Wer aber von den Lesern der Gartenlaube einmal nach dem Neustädter Kreise des Großherzogthums Sachsen-Weimar kommt, wenn der Sommer wieder zum Genuß der Natur hinaus in’s Freie und in’s Weite ruft, der versäume nicht, das malerisch gelegene Renthendorf in seinem tiefen Thale zu besuchen. Dann steige er hinauf auf den Hügel, auf dem die Kirche steht, und weihe da dem Andenken eines seltenen und edlen Mannes, eines wahren geistlichen Vaters und eines großen Naturforschers seine dankbare Verehrung. Und wenn etwa ein Vöglein dabei auch seine Stimme erhebt – dann denke er der Grasmücke, welche zuletzt bei der Beerdigung Ludwig Brehm’s ihre Stimme tönen ließ und dadurch der Feierlichkeit die letzte Weihe gab!Bei Ernst Keil in Leipzig ist erschienen:
Von Carl Vogt in Genf.
Mit 64 in den Text gedruckten Abbildungen.
Elegant broschirt Preis 1 Thaler.
Die in den Jahren 1861–1864 in der „Gartenlaube“ veröffentlichten und gern gelesenen Arbeiten des berühmten Naturforschers erscheinen hier vielfach ergänzt und erweitert, mit 64 Holzschnitten versehen, als besonderes Werkchen. Carl Vogt hat darin das für die Allgemeinheit nothwendigste und unmittelbaren Nutzen bringende Wissen aus dem Bereich der Thierkunde in seiner bekannten, anziehenden Schreibweise zusammengefaßt und ist bemüht gewesen, auf diesem, vielen noch ganz unbekannten Felde der Naturwissenschaft die nöthigen Kenntnisse und damit Aufklärung über manchen Aberglauben zu verbreiten. Sein Buch ist ein Buch für Jedermann, besonders für Landwirthe, Forstleute, Gärtner und Gartenfreunde. Einer besonderen Empfehlung bedarf dasselbe nicht.
Anmerkungen (Wikisource)
- ↑ Vorlage mit Doppelung "in Concise"