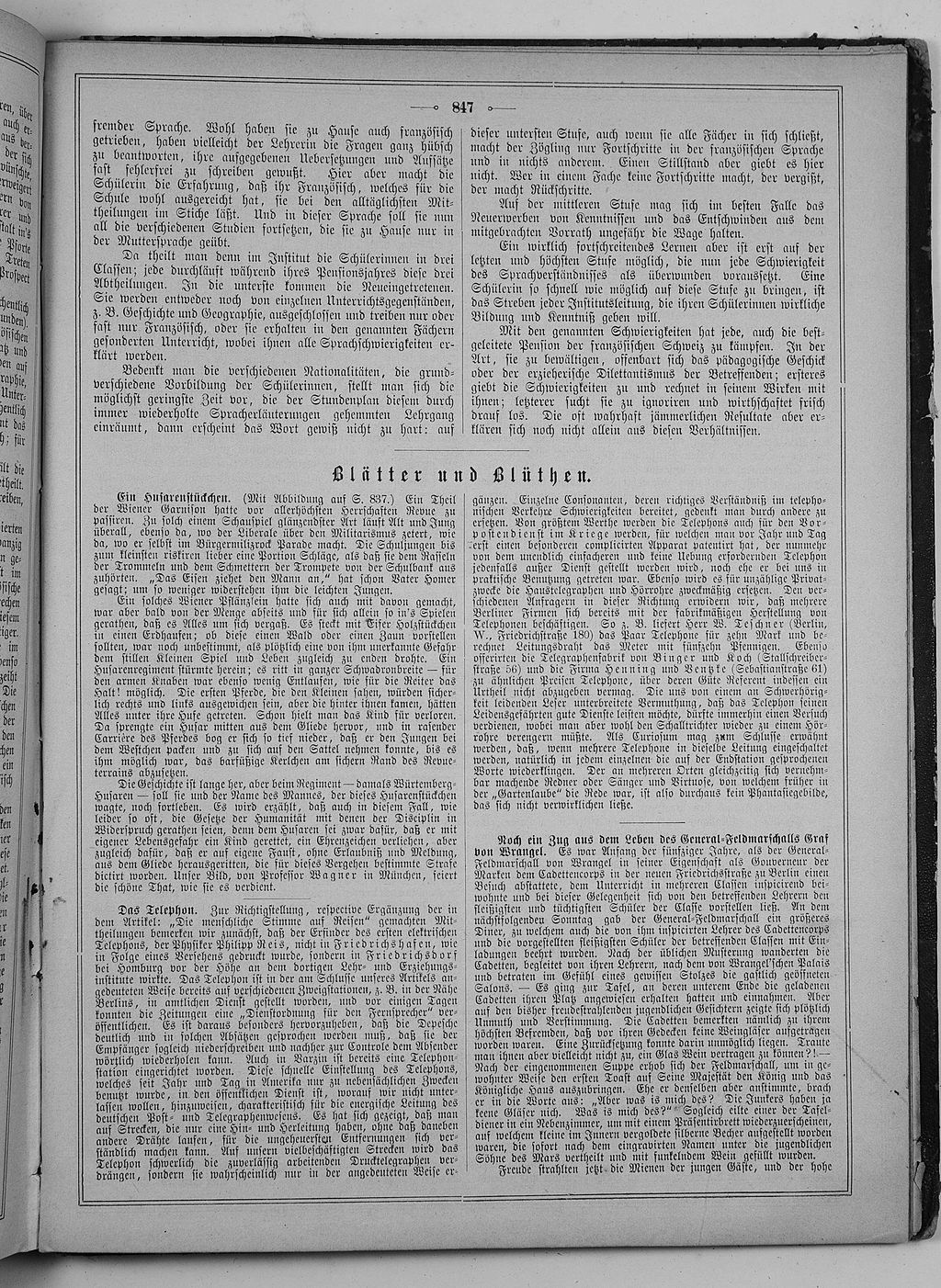| Verschiedene: Die Gartenlaube (1877) | |
|
|
fremder Sprache. Wohl haben sie zu Hause auch französisch getrieben, haben vielleicht der Lehrerin die Fragen ganz hübsch zu beantworten, ihre aufgegebenen Uebersetzungen und Aufsätze fast fehlerfrei zu schreiben gewußt. Hier aber macht die Schülerin die Erfahrung, daß ihr Französisch, welches für die Schule wohl ausgereicht hat, sie bei den alltäglichsten Mittheilungen im Stiche läßt. Und in dieser Sprache soll sie nun all die verschiedenen Studien fortsetzen, die sie zu Hause nur in der Muttersprache geübt.
Da theilt man denn im Institut die Schülerinnen in drei Classen; jede durchläuft während ihres Pensionsjahres diese drei Abtheilungen. In die unterste kommen die Neueingetretenen. Sie werden entweder noch von einzelnen Unterrichtsgegenständen, z. B. Geschichte und Geographie, ausgeschlossen und treiben nur oder fast nur Französisch, oder sie erhalten in den genannten Fächern gesonderten Unterricht, wobei ihnen alle Sprachschwierigkeiten erklärt werden.
Bedenkt man die verschiedenen Nationalitäten, die grundverschiedene Vorbildung der Schülerinnen, stellt man sich die möglichst geringste Zeit vor, die der Stundenplan diesem durch immer wiederholte Spracherläuterungen gehemmten Lehrgang einräumt, dann erscheint das Wort gewiß nicht zu hart: auf dieser untersten Stufe, auch wenn sie alle Fächer in sich schließt, macht der Zögling nur Fortschritte in der französischen Sprache und in nichts anderem. Einen Stillstand aber giebt es hier nicht. Wer in einem Fache keine Fortschritte macht, der vergißt, der macht Rückschritte.
Auf der mittleren Stufe mag sich im besten Falle das Neuerwerben von Kenntnissen und das Entschwinden aus dem mitgebrachten Vorrath ungefähr die Wage halten.
Ein wirklich fortschreitendes Lernen aber ist erst auf der letzten und höchsten Stufe möglich, die nun jede Schwierigkeit des Sprachverständnisses als überwunden voraussetzt. Eine Schülerin so schnell wie möglich auf diese Stufe zu bringen, ist das Streben jeder Institutsleitung, die ihren Schülerinnen wirkliche Bildung und Kenntniß geben will.
Mit den genannten Schwierigkeiten hat jede, auch die bestgeleitete Pension der französischen Schweiz zu kämpfen. In der Art, sie zu bewältigen, offenbart sich das pädagogische Geschick oder der erzieherische Dilettantismus der Betreffenden; ersteres giebt die Schwierigkeiten zu und rechnet in seinem Wirken mit ihnen; letzterer sucht sie zu ignoriren und wirthschaftet frisch drauf los. Die oft wahrhaft jämmerlichen Resultate aber erklären sich noch nicht allein aus diesen Verhältnissen.
Ein Husarenstückchen. (Mit Abbildung auf S. 837.) Ein Theil der Wiener Garnison hatte vor allerhöchsten Herrschaften Revue zu passiren. Zu solch einem Schauspiel glänzendster Art läuft Alt und Jung überall, ebenso da, wo der Liberale über den Militarismus zetert, wie da, wo er selbst im Bürgermilizrock Parade macht. Die Schuljungen bis zum kleinsten riskiren lieber eine Portion Schläge, als daß sie dem Rasseln der Trommeln und dem Schmettern der Trompete von der Schulbank aus zuhörten. „Das Eisen ziehet den Mann an,“ hat schon Vater Homer gesagt; um so weniger widerstehen ihm die leichten Jungen.
Ein solches Wiener Pflänzlein hatte sich auch mit davon gemacht, war aber bald von der Menge abseits und für sich allein so in’s Spielen gerathen, daß es Alles um sich vergaß. Es steckt mit Eifer Holzstückchen in einen Erdhaufen; ob diese einen Wald oder einen Zaun vorstellen sollten, war noch unbestimmt, als plötzlich eine von ihm unerkannte Gefahr dem stillen Kleinen Spiel und Leben zugleich zu enden drohte. Ein Husarenregiment stürmte herein; es ritt in ganzer Schwadronbreite – für den armen Knaben war ebenso wenig Entlaufen, wie für die Reiter das Halt! möglich. Die ersten Pferde, die den Kleinen sahen, würden sicherlich rechts und links ausgewichen sein, aber die hinter ihnen kamen, hätten Alles unter ihre Hufe getreten. Schon hielt man das Kind für verloren. Da sprengte ein Husar mitten aus dem Gliede hervor, und in rasender Carrière des Pferdes bog er sich so tief nieder, daß er den Jungen bei dem Westchen packen und zu sich auf den Sattel nehmen konnte, bis es ihm möglich war, das barfüßige Kerlchen am sichern Rand des Revueterrains abzusetzen.
Die Geschichte ist lange her, aber beim Regiment – damals Würtemberg-Husaren – soll sie und der Name des Mannes, der dieses Husarenstückchen wagte, noch fortleben. Es wird erzählt, daß auch in diesem Fall, wie leider so oft, die Gesetze der Humanität mit denen der Disciplin in Widerspruch gerathen seien, denn dem Husaren sei zwar dafür, daß er mit eigener Lebensgefahr ein Kind gerettet, ein Ehrenzeichen verliehen, aber zugleich dafür, daß er auf eigene Faust, ohne Erlaubniß und Meldung, aus dem Gliede herausgeritten, die für dieses Vergehen bestimmte Strafe dictirt worden. Unser Bild, von Professor Wagner in München, feiert die schöne That, wie sie es verdient.
Das Telephon. Zur Richtigstellung, respective Ergänzung der in dem Artikel: „Die menschliche Stimme auf Reisen“ gemachten Mittheilungen bemerken wir zunächst, daß der Erfinder des ersten elektrischen Telephons, der Physiker Philipp Reis, nicht in Friedrichshafen, wie in Folge eines Versehens gedruckt wurde, sondern in Friedrichsdorf bei Homburg vor der Höhe an dem dortigen Lehr- und Erziehungsinstitute wirkte. Das Telephon ist in der am Schlusse unseres Artikels angedeuteten Weise bereits auf verschiedenen Zweigstationen, z. B. in der Nähe Berlins, in amtlichen Dienst gestellt worden, und vor einigen Tagen konnten die Zeitungen eine „Dienstordnung für den Fernsprecher“ veröffentlichen. Es ist daraus besonders hervorzuheben, daß die Depesche deutlich und in solchen Absätzen gesprochen werden muß, daß sie der Empfänger sogleich niederschreiben und nachher zur Controle dem Absender wörtlich wiederholen kann. Auch in Varzin ist bereits eine Telephonstation eingerichtet worden. Diese schnelle Einstellung des Telephons, welches seit Jahr und Tag in Amerika nur zu nebensächlichen Zwecken benutzt wurde, in den öffentlichen Dienst ist, worauf wir nicht unterlassen wollen, hinzuweisen, charakteristisch für die energische Leitung des deutschen Post- und Telegraphenwesens. Es hat sich gezeigt, daß man auf Strecken, die nur eine Hin- und Herleitung haben, ohne daß daneben andere Drähte laufen, für die ungeheuersten Entfernungen sich verständlich machen kann. Auf unsern vielbeschäftigten Strecken wird das Telephon schwerlich die zuverlässig arbeitenden Drucktelegraphen verdrängen, sondern sie wahrscheinlich nur in der angedeuteten Weise ergänzen. Einzelne Consonanten, deren richtiges Verständniß im telephonischen Verkehre Schwierigkeiten bereitet, gedenkt man durch andere zu ersetzen. Von größtem Werthe werden die Telephons auch für den Vorpostendienst im Kriege werden, für welchen man vor Jahr und Tag erst einen besonderen complicirten Apparat patentirt hat, der nunmehr von dem unendlich einfacheren und keine Uebung erfordernden Telephon jedenfalls außer Dienst gestellt werden wird, noch ehe er bei uns in praktische Benutzung getreten war. Ebenso wird es für unzählige Privatzwecke die Haustelegraphen und Hörrohre zweckmäßig ersetzen. Den verschiedenen Anfragern in dieser Richtung erwidern wir, daß mehrere Berliner Firmen sich bereits mit der fabrikmäßigen Herstellung von Telephonen beschäftigen. So z. B. liefert Herr W. Teschner (Berlin, W., Friedrichstraße 180) das Paar Telephone für zehn Mark und berechnet Leitungsdraht das Meter mit fünfzehn Pfennigen. Ebenso offerirten die Telegraphenfabrik von Binger und Koch (Stallschreiberstraße 56) und die Firma Henning und Ventzke (Sebastianstraße 61) zu ähnlichen Preisen Telephone, über deren Güte Referent indessen ein Urtheil nicht abzugeben vermag. Die uns von einem an Schwerhörigkeit leidenden Leser unterbreitete Vermuthung, daß das Telephon seinen Leidensgefährten gute Dienste leisten möchte, dürfte immerhin einen Versuch verdienen, wobei man aber wohl den Schalltrichter wieder zu einem Hörrohre verengern müßte. Als Curiosum mag zum Schlusse erwähnt werden, daß, wenn mehrere Telephone in dieselbe Leitung eingeschaltet werden, natürlich in jedem einzelnen die auf der Endstation gesprochenen Worte wiederklingen. Der an mehreren Orten gleichzeitig sich vernehmbar machende Redner oder Sänger und Virtuose, von welchem früher in der „Gartenlaube“ die Rede war, ist also durchaus kein Phantasiegebilde, das sich nicht verwirklichen ließe.
Noch ein Zug aus dem Leben des General-Feldmarschalls Graf von Wrangel. Es war Anfang der fünfziger Jahre, als der General-Feldmarschall von Wrangel in seiner Eigenschaft als Gouverneur der Marken dem Cadettencorps in der neuen Friedrichsstraße zu Berlin einen Besuch abstattete, dem Unterricht in mehreren Classen inspicirend beiwohnte und bei dieser Gelegenheit sich von den betreffenden Lehrern den fleißigsten und tüchtigsten Schüler der Classe vorstellen ließ. An dem nächstfolgenden Sonntag gab der General-Feldmarschall ein größeres Diner, zu welchem auch die von ihm inspicirten Lehrer des Cadettencorps und die vorgestellten fleißigsten Schüler der betreffenden Classen mit Einladungen beehrt wurden. Nach der üblichen Musterung wanderten die Cadetten, begleitet von ihren Lehrern, nach dem von Wrangel’schen Palais und betraten im Gefühl eines gewissen Stolzes die gastlich geöffneten Salons. – Es ging zur Tafel, an deren unterem Ende die geladenen Cadetten ihren Platz angewiesen erhalten hatten und einnahmen. Aber auf den bisher freudestrahlenden jugendlichen Gesichtern zeigte sich plötzlich Unmuth und Verstimmung. Die Cadetten bemerkten nämlich zu ihrem höchsten Befremden, daß vor ihren Gedecken keine Weingläser aufgetragen worden waren. Eine Zurücksetzung konnte darin unmöglich liegen. Traute man ihnen aber vielleicht nicht zu, ein Glas Wein vertragen zu können?! – Nach der eingenommenen Suppe erhob sich der Feldmarschall, um in gewohnter Weise den ersten Toast auf Seine Majestät den König und das Königliche Haus auszubringen. Ehe er denselben aber anstimmte, brach er in die Worte aus: „Aber was is mich des? Die Junkers haben ja keene Gläser nich. Was is mich des?“ Sogleich eilte einer der Tafeldiener in ein Nebenzimmer, um mit einem Präsentirbrett wiederzuerscheinen, auf welchem kleine im Innern vergoldete silberne Becher aufgestellt worden waren, die sofort nach dem eingravirten Namen unter die jugendlichen Söhne des Mars vertheilt und mit funkelndem Wein gefüllt wurden.
Freude strahlten jetzt die Mienen der jungen Gäste, und der hohe
Verschiedene: Die Gartenlaube (1877). Leipzig: Ernst Keil, 1877, Seite 847. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1877)_847.jpg&oldid=- (Version vom 7.1.2022)