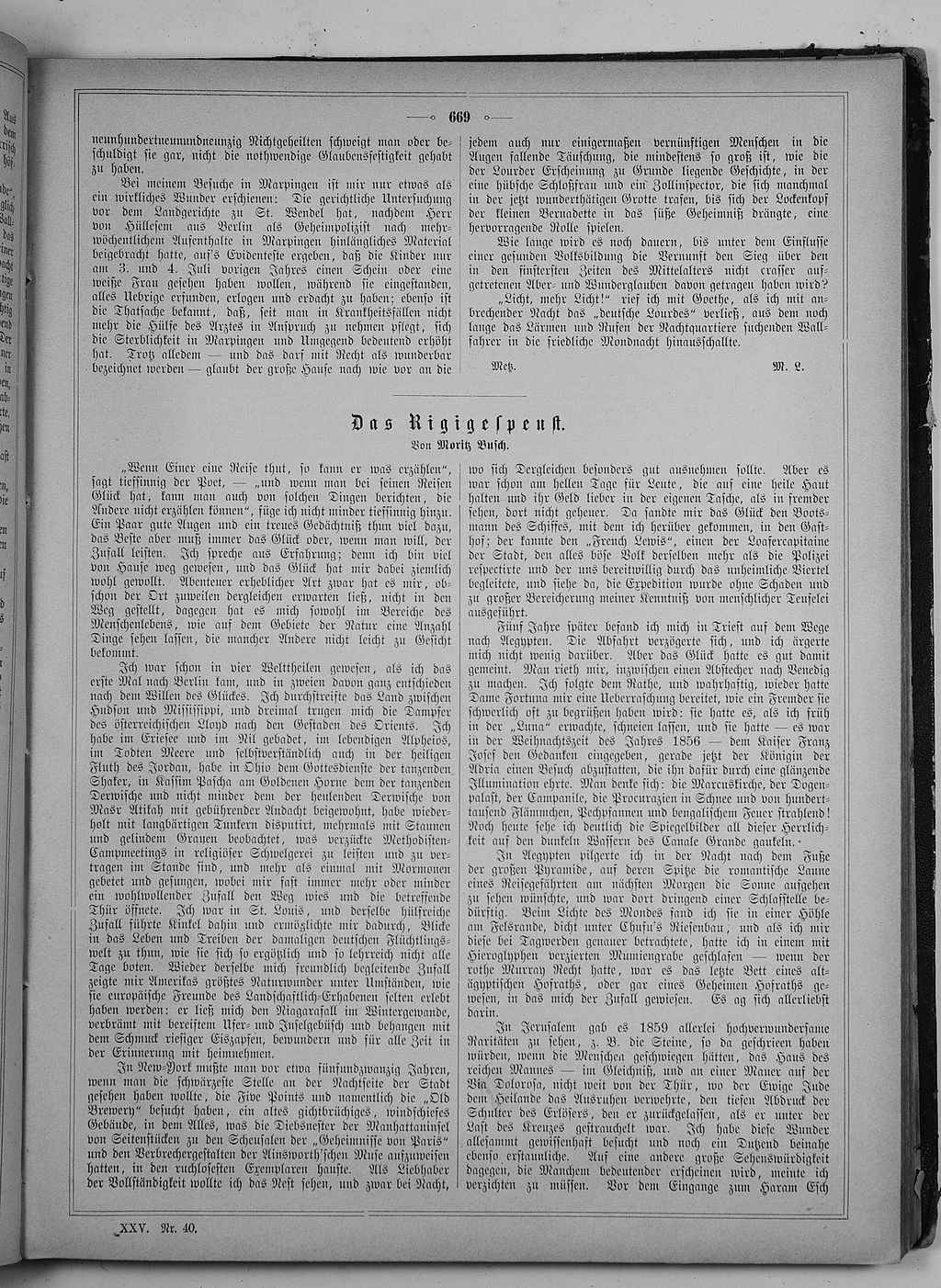| Verschiedene: Die Gartenlaube (1877) | |
|
|
neunhundertneunundneunzig Nichtgeheilten schweigt man oder beschuldigt sie gar, nicht die nothwendige Glaubensfestigkeit gehabt zu haben.
Bei meinem Besuche in Marpingen ist mir nur etwas als ein wirkliches Wunder erschienen: Die gerichtliche Untersuchung vor dem Landgerichte zu St. Wendel hat, nachdem Herr von Hüllesem aus Berlin als Geheimpolizist nach mehrwöchentlichem Aufenthalte in Marpingen hinlängliches Material beigebracht hatte, auf's Evidenteste ergeben, daß die Kinder nur am 3. und 4. Juli vorigen Jahres einen Schein oder eine weiße Frau gesehen haben wollen, während sie eingestanden, alles Uebrige erfunden, erlogen und erdacht zu haben; ebenso ist die Thatsache bekannt, daß, seit man in Krankheitsfällen nicht mehr die Hülfe des Arztes in Anspruch zu nehmen pflegt, sich die Sterblichkeit in Marpingen und Umgegend bedeutend erhöht hat. Trotz alledem – und das darf mit Recht als wunderbar bezeichnet werden – glaubt der große Haufe nach wie vor an die jedem auch nur einigermaßen vernünftigen Menschen in die Augen fallende Täuschung, die mindestens so groß ist, wie die der Lourder Erscheinung zu Grunde liegende Geschichte, in der eine hübsche Schloßfrau und ein Zollinspector, die sich manchmal in der jetzt wunderthätigen Grotte trafen, bis sich der Lockenkopf der kleinen Bernadette in das süße Geheimniß drängte, eine hervorragende Rolle spielen.
Wie lange wird es noch dauern, bis unter dem Einflusse einer gesunden Volksbildung die Vernunft den Sieg über den in den finstersten Zeiten des Mittelalters nicht crasser aufgetretenen Aber- und Wunderglauben davon getragen haben wird?
„Licht, mehr Licht!“ rief ich mit Goethe, als ich mit anbrechender Nacht das „deutsche Lourdes“ verließ, aus dem noch lange das Lärmen und Rufen der Nachtquartiere suchenden Wallfahrer in die friedliche Mondnacht hinausschallte.
Metz.
„Wenn Einer eine Reise thut, so kann er was erzählen“, sagt tiefsinnig der Poet, – „und wenn man bei seinen Reisen Glück hat, kann man auch von solchen Dingen berichten, die Andere nicht erzählen können“, füge ich nicht minder tiefsinnig hinzu. Ein Paar gute Augen und ein treues Gedächtniß thun viel dazu, das Beste aber muß immer das Glück oder, wenn man will, der Zufall leisten. Ich spreche aus Erfahrung; denn ich bin viel von Hause weg gewesen, und das Glück hat mir dabei ziemlich wohl gewollt. Abenteuer erheblicher Art zwar hat es mir, obschon der Ort zuweilen dergleichen erwarten ließ, nicht in den Weg gestellt, dagegen hat es mich sowohl im Bereiche des Menschenlebens, wie auf dem Gebiete der Natur eine Anzahl Dinge sehen lassen, die mancher Andere nicht leicht zu Gesicht bekommt.
Ich war schon in vier Welttheilen gewesen, als ich das erste Mal nach Berlin kam, und in zweien davon ganz entschieden nach dem Willen des Glückes. Ich durchstreifte das Land zwischen Hudson und Mississippi, und dreimal trugen mich die Dampfer des österreichischen Lloyd nach den Gestaden des Orients. Ich habe im Eriesee und im Nil gebadet, im lebendigen Alpheios, im Todten Meere und selbstverständlich auch in der heiligen Fluth des Jordan, habe in Ohio dem Gottesdienste der tanzenden Shaker, in Kassim Pascha am Goldenen Horne dem der tanzenden Derwische und nicht minder dem der heulenden Derwische von Masr Atikah mit gebührender Andacht beigewohnt, habe wiederholt mit langbärtigen Tunkern disputirt, mehrmals mit Staunen und gelindem Grauen beobachtet, was verzückte Methodisten-Campmeetings in religiöser Schwelgerei zu leisten und zu vertragen im Stande sind, und mehr als einmal mit Mormonen gebetet und gesungen, wobei mir fast immer mehr oder minder ein wohlwollender Zufall den Weg wies und die betreffende Thür öffnete. Ich war in St. Louis, und derselbe hülfreiche Zufall führte Kinkel dahin und ermöglichte mir dadurch, Blicke in das Leben und Treiben der damaligen deutschen Flüchtlingswelt zu thun, wie sie sich so ergötzlich und so lehrreich nicht alle Tage boten. Wieder derselbe mich freundlich begleitende Zufall zeigte mir Amerikas größtes Naturwunder unter Umständen, wie sie europäische Freunde des Landschaftlich-Erhabenen selten erlebt haben werden: er ließ mich den Niagarafall im Wintergewande, verbrämt mit bereiftem Ufer- und Inselgebüsch und behangen mit dem Schmuck riesiger Eiszapfen, bewundern und für alle Zeit in der Erinnerung mit heimnehmen.
In New-York mußte man vor etwa fünfundzwanzig Jahren, wenn man die schwärzeste Stelle an der Nachtseite der Stadt gesehen haben wollte, die Five Points und namentlich die „Old Brewery“ besucht haben, ein altes gichtbrüchiges, windschiefes Gebäude, in dem Alles, was die Diebsnester der Manhattaninsel von Seitenstücken zu den Scheusalen der „Geheimnisse von Paris“ und den Verbrechergestalten der Ainsworth'schen Muse aufzuweisen hatten, in den ruchlosesten Exemplaren hauste. Als Liebhaber der Vollständigkeit wollte ich das Nest sehen, und zwar bei Nacht, wo sich Dergleichen besonders gut ausnehmen sollte. Aber es war schon am hellen Tage für Leute, die auf eine heile Haut halten und ihr Geld lieber in der eigenen Tasche, als in fremder sehen, dort nicht geheuer. Da sandte mir das Glück den Bootsmann des Schiffes, mit dem ich herüber gekommen, in den Gasthof; der kannte den „French Lewis“, einen der Loafercapitaine der Stadt, den alles böse Volk derselben mehr als die Polizei respectirte und der uns bereitwillig durch das unheimliche Viertel begleitete, und siehe da, die Expedition wurde ohne Schaden und zu großer Bereicherung meiner Kenntniß von menschlicher Teufelei ausgeführt.
Fünf Jahre später befand ich mich in Triest auf dem Wege nach Aegypten. Die Abfahrt verzögerte sich, und ich ärgerte mich nicht wenig darüber. Aber das Glück hatte es gut damit gemeint. Man rieth mir, inzwischen einen Abstecher nach Venedig zu machen. Ich folgte dem Rathe, und wahrhaftig, wieder hatte Dame Fortuna mir eine Ueberraschung bereitet, wie ein Fremder sie schwerlich oft zu begrüßen haben wird: sie hatte es, als ich früh in der „Luna“ erwachte, schneien lassen, und sie hatte – es war in der Weihnachtszeit des Jahres 1856 – dem Kaiser Franz Josef den Gedanken eingegeben, gerade jetzt der Königin der Adria einen Besuch abzustatten, die ihn dafür durch eine glänzende Illumination ehrte. Man denke sich: die Marcuskirche, der Dogenpalast, der Campanile, die Procurazien in Schnee und von hunderttausend Flämmchen, Pechpfannen und bengalischem Feuer strahlend! Noch heute sehe ich deutlich die Spiegelbilder all dieser Herrlichkeit auf den dunkeln Wassern des Canale Grande gaukeln.
In Aegypten pilgerte ich in der Nacht nach dem Fuße der großen Pyramide, aus deren Spitze die romantische Laune eines Reisegefährten am nächsten Morgen die Sonne aufgehen zu sehen wünschte, und war dort dringend einer Schlafstelle bedürftig. Beim Lichte des Mondes fand ich sie in einer Höhle am Felsrande, dicht unter Chufu's Riesenbau, und als ich mir diese bei Tagwerden genauer betrachtete, hatte ich in einem mit Hieroglyphen verzierten Mumiengrabe geschlafen – wenn der rothe Murray Recht hatte, war es das letzte Bett eines altägyptischen Hofraths, oder gar eines Geheimen Hofraths gewesen, in das mich der Zufall gewiesen. Es lag[1] sich allerliebst darin.
In Jerusalem gab es 1859 allerlei hochverwundersame Raritäten zu sehen, z. B. die Steine, so da geschrieen haben würden, wenn die Menschen geschwiegen hätten, das Haus des reichen Mannes – im Gleichniß, und an einer Mauer auf der Via Dolorosa, nicht weit von der Thür, wo der Ewige Jude dem Heilande das Ausruhen verwehrte, den tiefen Abdruck der Schulter des Erlösers, den er zurückgelassen, als er unter der Last des Kreuzes gestrauchelt war. Ich habe diese Wunder allesammt gewissenhaft besucht und noch ein Dutzend beinahe ebenso erstaunliche. Auf eine andere große Sehenswürdigkeit dagegen, die Manchem bedeutender erscheinen wird, meinte ich verzichten zu müssen. Vor dem Eingange zum Haram Esch
- ↑ Vorlage: „ag“
Verschiedene: Die Gartenlaube (1877). Leipzig: Ernst Keil, 1877, Seite 669. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1877)_669.jpg&oldid=- (Version vom 31.7.2018)