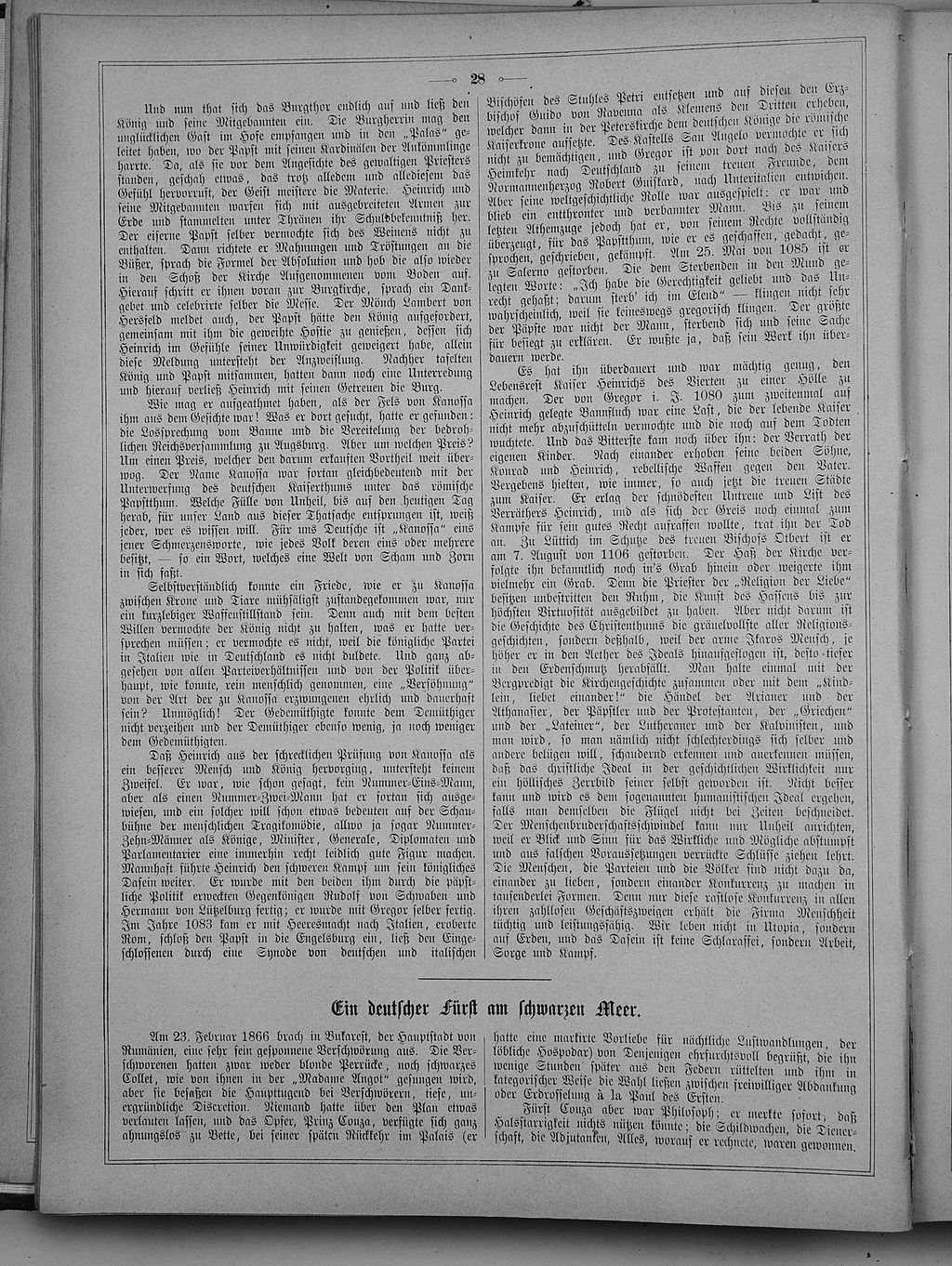| Verschiedene: Die Gartenlaube (1877) | |
|
|
Und nun that sich das Burgthor endlich auf und ließ den König und seine Mitgebannten ein. Die Burgherrin mag den unglücklichen Gast im Hofe empfangen und in den „Palas“ geleitet haben, wo der Papst mit seinen Kardinälen der Ankömmlinge harrte. Da, als sie vor dem Angesichte des gewaltigen Priesters standen, geschah etwas, das trotz alledem und allediesem das Gefühl hervorruft, der Geist meistere die Materie. Heinrich und seine Mitgebannten warfen sich mit ausgebreiteten Armen zur Erde und stammelten unter Thränen ihr Schuldbekenntniß her. Der eiserne Papst selber vermochte sich des Weinens nicht zu enthalten. Dann richtete er Mahnungen und Tröstungen an die Büßer, sprach die Formel der Absolution und hob die also wieder in den Schoß der Kirche Aufgenommenen vom Boden auf. Hierauf schritt er ihnen voran zur Burgkirche, sprach ein Dankgebet und celebrirte selber die Messe. Der Mönch Lambert von Hersfeld meldet auch, der Papst hätte den König aufgefordert, gemeinsam mit ihm die geweihte Hostie zu genießen, dessen sich Heinrich im Gefühle seiner Unwürdigkeit geweigert habe, allein diese Meldung untersteht der Anzweiflung. Nachher tafelten König und Papst mitsammen, hatten dann noch eine Unterredung und hierauf verließ Heinrich mit seinen Getreuen die Burg.
Wie mag er aufgeathmet haben, als der Fels von Kanossa ihm aus dem Gesichte war! Was er dort gesucht, hatte er gefunden: die Lossprechung vom Banne und die Vereitelung der bedrohlichen Reichsversammlung zu Augsburg. Aber um welchen Preis? Um einen Preis, welcher den darum erkauften Vortheil weit überwog. Der Name Kanossa war fortan gleichbedeutend mit der Unterwerfung des deutschen Kaiserthums unter das römische Papstthum. Welche Fülle von Unheil, bis auf den heutigen Tag herab, für unser Land aus dieser Thatsache entsprungen ist, weiß jeder, wer es wissen will. Für uns Deutsche ist „Kanossa“ eins jener Schmerzensworte, wie jedes Volk deren eins oder mehrere besitzt, – so ein Wort, welches eine Welt von Scham und Zorn in sich faßt.
Selbstverständlich konnte ein Friede, wie er zu Kanossa zwischen Krone und Tiare mühsäligst zustandegekommen war, nur ein kurzlebiger Waffenstillstand sein. Denn auch mit dem besten Willen vermochte der König nicht zu halten, was er hatte versprechen müssen; er vermochte es nicht, weil die königliche Partei in Italien wie in Deutschland es nicht duldete. Und ganz abgesehen von allen Parteiverhältnissen und von der Politik überhaupt, wie konnte, rein menschlich genommen, eine „Versöhnung“ von der Art der zu Kanossa erzwungenen ehrlich und dauerhaft sein? Unmöglich! Der Gedemüthigte konnte dem Demüthiger nicht verzeihen und der Demüthiger ebenso wenig, ja noch weniger dem Gedemüthigten.
Daß Heinrich aus der schrecklichen Prüfung von Kanossa als ein besserer Mensch und König hervorging, untersteht keinem Zweifel. Er war, wie schon gesagt, kein Nummer-Eins-Mann, aber als einen Nummer-Zwei-Mann hat er fortan sich ausgewiesen, und ein solcher will schon etwas bedeuten auf der Schaubühne der menschlichen Tragikomödie, allwo ja sogar Nummer-Zehn-Männer als Könige, Minister, Generale, Diplomaten und Parlamentarier eine immerhin recht leidlich gute Figur machen. Mannhaft führte Heinrich den schweren Kampf um sein königliches Dasein weiter. Er wurde mit den beiden ihm durch die päpstliche Politik erweckten Gegenkönigen Rudolf von Schwaben und Hermann von Lützelburg fertig; er wurde mit Gregor selber fertig. Im Jahre 1083 kam er mit Heeresmacht nach Italien, eroberte Rom, schloß den Papst in die Engelsburg ein, ließ den Eingeschlossenen durch eine Synode von deutschen und italischen Bischöfen des Stuhles Petri entsetzen und auf diesen den Erzbischof Guido von Ravenna als Klemens den Dritten erheben, welcher dann in der Peterskirche dem deutschen Könige die römische Kaiserkrone aufsetzte. Des Kastells San Angelo vermochte er sich nicht zu bemächtigen, und Gregor ist von dort nach des Kaisers Heimkehr nach Deutschland zu seinem treuen Freunde, dem Normannenherzog Robert Guiskard, nach Unteritalien entwichen. Aber seine weltgeschichtliche Rolle war ausgespielt: er war und blieb ein entthronter und verbannter Mann. Bis zu seinem letzten Athemzuge jedoch hat er, von seinem Rechte vollständig überzeugt, für das Papstthum, wie er es geschaffen, gedacht, gesprochen, geschrieben, gekämpft. Am 25. Mai von 1085 ist er zu Salerno gestorben. Die dem Sterbenden in den Mund gelegten Worte: „Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehaßt; darum sterb' ich im Elend“ – klingen nicht sehr wahrscheinlich, weil sie keineswegs gregorisch klingen. Der größte der Päpste war nicht der Mann, sterbend sich und seine Sache für besiegt zu erklären. Er wußte ja, daß sein Werk ihn überdauern werde.
Es hat ihn überdauert und war mächtig genug, den Lebensrest Kaiser Heinrichs des Vierten zu einer Hölle zu machen. Der von Gregor i. J. 1080 zum zweitenmal auf Heinrich gelegte Bannfluch war eine Last, die der lebende Kaiser nicht mehr abzuschütteln vermochte und die noch auf dem Todten wuchtete. Und das Bitterste kam noch über ihn: der Verrath der eigenen Kinder. Nach einander erhoben seine beiden Söhne, Konrad und Heinrich, rebellische Waffen gegen den Vater. Vergebens hielten, wie immer, so auch jetzt die treuen Städte zum Kaiser. Er erlag der schnödesten Untreue und List des Verräthers Heinrich, und als sich der Greis noch einmal zum Kampfe für sein gutes Recht aufraffen wollte, trat ihn der Tod an. Zu Lüttich im Schutze des treuen Bischofs Otbert ist er am 7. August von 1106 gestorben. Der Haß der Kirche verfolgte ihn bekanntlich noch in's Grab hinein oder weigerte ihm vielmehr ein Grab. Denn die Priester der „Religion der Liebe“ besitzen unbestritten den Ruhm, die Kunst des Hassens bis zur höchsten Virtuosität ausgebildet zu haben. Aber nicht darum ist die Geschichte des Christenthums die gräuelvollste aller Religionsgeschichten, sondern deßhalb, weil der arme Ikaros Mensch, je höher er in den Aether des Ideals hinaufgeflogen ist, desto tiefer in den Erdenschmutz herabfällt. Man halte einmal mit der Bergpredigt die Kirchengeschichte zusammen oder mit dem „Kindlein, liebet einander!“ die Händel der Arianer und der Athanasier, der Päpstler und der Protestanten, der „Griechen“ und der „Lateiner“, der Lutheraner und der Kalvinisten, und man wird, so man nämlich nicht schlechterdings sich selber und andere belügen will, schaudernd erkennen und anerkennen müssen, daß das christliche Ideal in der geschichtlichen Wirklichkeit nur ein höllisches Zerrbild seiner selbst geworden ist. Nicht besser kann und wird es dem sogenannten humanistischen Ideal ergehen, falls man demselben die Flügel nicht bei Zeiten beschneidet. Der Menschenbruderschaftsschwindel kann nur Unheil anrichten, weil er Blick und Sinn für das Wirkliche und Mögliche abstumpft und aus falschen Voraussetzungen verrückte Schlüsse ziehen lehrt. Die Menschen, die Parteien und die Völker sind nicht dazu da, einander zu lieben, sondern einander Konkurrenz zu machen in tausenderlei Formen. Denn nur diese rastlose Konkurrenz in allen ihren zahllosen Geschäftszweigen erhält die Firma Menschheit tüchtig und leistungsfähig. Wir leben nicht in Utopia, sondern auf Erden, und das Dasein ist keine Schlaraffei, sondern Arbeit, Sorge und Kampf.
Am 23. Februar 1866 brach in Bukarest, der Hauptstadt von Rumänien, eine sehr fein gesponnene Verschwörung aus. Die Verschworenen hatten zwar weder blonde Perrücke, noch schwarzes Collet, wie von ihnen in der „Madame Angot“ gesungen wird, aber sie besaßen die Haupttugend bei Verschwörern, tiefe, unergründliche Discretion. Niemand hatte über den Plan etwas verlauten lassen, und das Opfer, Prinz Conza, verfügte sich ganz ahnungslos zu Bette, bei seiner späten Rückkehr im Palais (er hatte eine markirte Vorliebe für nächtliche Lustwandlungen, der löbliche Hospodar) von Denjenigen ehrfurchtsvoll begrüßt, die ihn wenige Stunden später aus den Federn rüttelten und ihm in kategorischer Weise die Wahl ließen zwischen freiwilliger Abdankung oder Erdrosselung à la Paul des Ersten.
Fürst Conza aber war Philosoph; er merkte sofort, daß Halsstarrigkeit nichts nützen könnte; die Schildwachen, die Dienerschaft, die Adjutanten, Alles, worauf er rechnete, waren gewonnen.
Verschiedene: Die Gartenlaube (1877). Leipzig: Ernst Keil, 1877, Seite 28. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1877)_028.jpg&oldid=- (Version vom 31.7.2018)