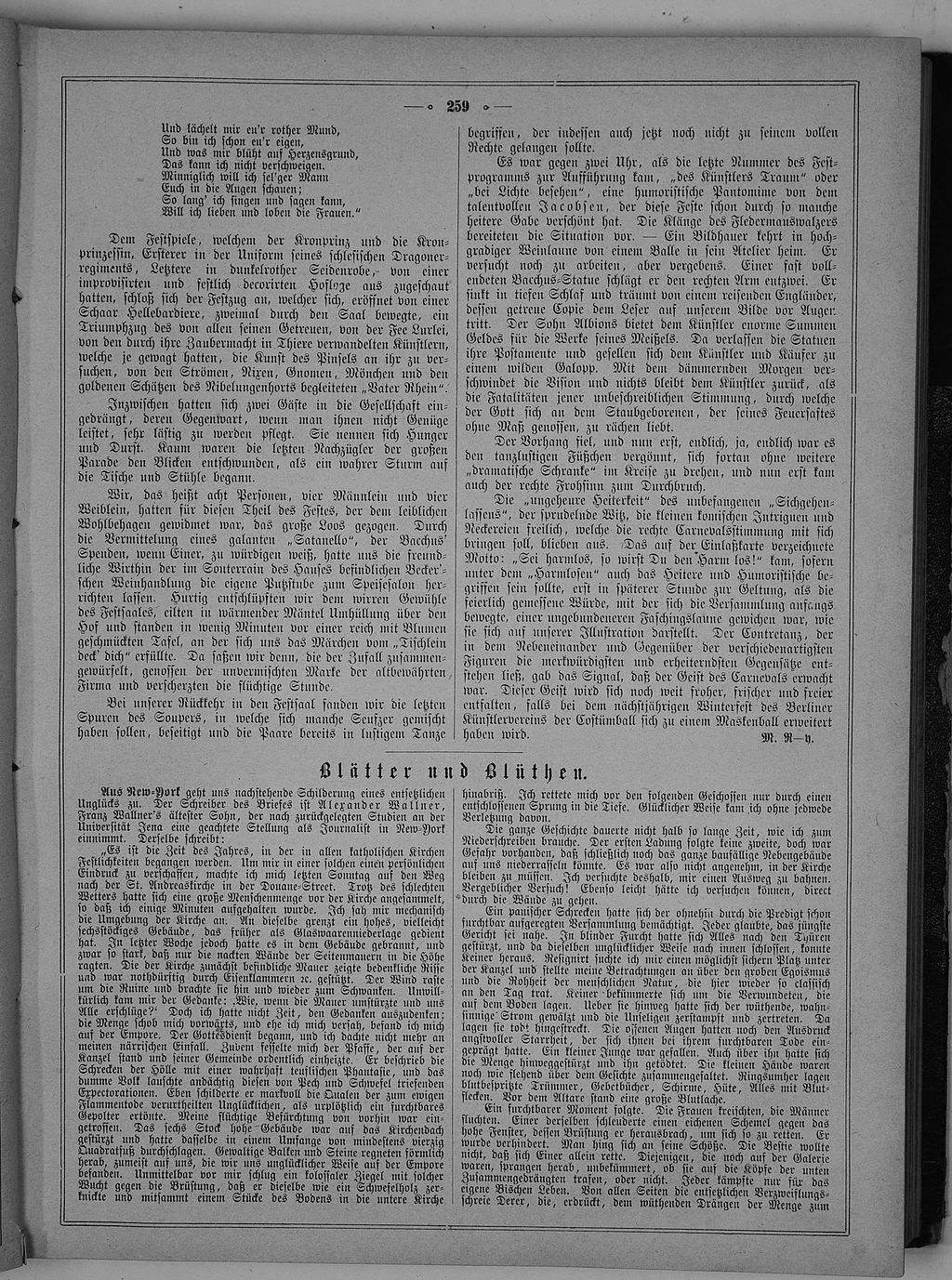| verschiedene: Die Gartenlaube (1875) | |
|
|
Und lächelt mir eu’r rother Mund,
So bin ich schon eu’r eigen,
Und was mir blüht auf Herzensgrund,
Das kann ich nicht verschweigen.
Minniglich will ich sel’ger Mann
Euch in die Augen schauen;
So lang’ ich singen und sagen kann,
Will ich lieben und loben die Frauen.“
Dem Festspiele, welchem der Kronprinz und die Kronprinzessin, Ersterer in der Uniform seines schlesischen Dragonerregiments, Letztere in dunkelrother Seidenrobe, von einer improvisirten und festlich decorirten Hofloge aus zugeschaut hatten, schloß sich der Festzug an, welcher sich, eröffnet von einer Schaar Hellebardiere, zweimal durch den Saal bewegte, ein Triumphzug des von allen seinen Getreuen, von der Fee Lurlei, von den durch ihre Zaubermacht in Thiere verwandelten Künstlern, welche je gewagt hatten, die Kunst des Pinsels an ihr zu versuchen, von den Strömen, Nixen, Gnomen, Mönchen und den goldenen Schätzen des Nibelungenhorts begleiteten „Vater Rhein“.
Inzwischen hatten sich zwei Gäste in die Gesellschaft eingedrängt, deren Gegenwart, wenn man ihnen nicht Genüge leistet, sehr lästig zu werden pflegt. Sie nennen sich Hunger und Durst. Kaum waren die letzten Nachzügler der großen Parade den Blicken entschwunden, als ein wahrer Sturm auf die Tische und Stühle begann.
Wir, das heißt acht Personen, vier Männlein und vier Weiblein, hatten für diesen Theil des Festes, der dem leiblichen Wohlbehagen gewidmet war, das große Loos gezogen. Durch die Vermittelung eines galanten „Satanello“, der Bacchus’ Spenden, wenn Einer, zu würdigen weiß, hatte uns die freundliche Wirthin der im Souterrain des Hauses befindlichen Becker’schen Weinhandlung die eigene Putzstube zum Speisesalon herrichten lassen. Hurtig entschlüpften wir dem wirren Gewühle des Festsaales, eilten in wärmender Mäntel Umhüllung über den Hof und standen in wenig Minuten vor einer reich mit Blumen geschmückten Tafel, an der sich uns das Märchen vom „Tischlein deck’ dich“ erfüllte. Da saßen wir denn, die der Zufall zusammengewürfelt, genossen der unvermischten Marke der altbewährten Firma und verscherzten die flüchtige Stunde.
Bei unserer Rückkehr in den Festsaal fanden wir die letzten Spuren des Soupers, in welche sich manche Seufzer gemischt haben sollen, beseitigt und die Paare bereits in lustigem Tanze begriffen, der indessen auch jetzt noch nicht zu seinem vollen Rechte gelangen sollte.
Es war gegen zwei Uhr, als die letzte Nummer des Festprogramms zur Aufführung kam, „des Künstlers Traum“ oder „bei Lichte besehen“, eine humoristische Pantomime von dem talentvollen Jacobsen, der diese Feste schon durch so manche heitere Gabe verschönt hat. Die Klänge des Fledermauswalzers bereiteten die Situation vor. – Ein Bildhauer kehrt in hochgradiger Weinlaune von einem Balle in sein Atelier heim. Er versucht noch zu arbeiten, aber vergebens. Einer fast vollendeten Bacchus-Statue schlägt er den rechten Arm entzwei. Er sinkt in tiefen Schlaf und träumt von einem reisenden Engländer, dessen getreue Copie dem Leser auf unserem Bilde vor Augen tritt. Der Sohn Albions bietet dem Künstler enorme Summen Geldes für die Werke seines Meißels. Da verlassen die Statuen ihre Postamente und gesellen sich dem Künstler und Käufer zu einem wilden Galopp. Mit dem dämmernden Morgen verschwindet die Vision und nichts bleibt dem Künstler zurück, als die Fatalitäten jener unbeschreiblichen Stimmung, durch welche der Gott sich an dem Staubgeborenen, der seines Feuersaftes ohne Maß genossen, zu rächen liebt.
Der Vorhang fiel, und nun erst, endlich, ja, endlich war es den tanzlustigen Füßchen vergönnt, sich fortan ohne weitere „dramatische Schranke“ im Kreise zu drehen, und nun erst kam auch der rechte Frohsinn zum Durchbruch.
Die „ungeheure Heiterkeit“ des unbefangenen „Sichgehenlassens“, der sprudelnde Witz, die kleinen komischen Intriguen und Neckereien freilich, welche die rechte Carnevalsstimmung mit sich bringen soll, blieben aus. Das auf der Einlaßkarte verzeichnete Motto: „Sei harmlos, so wirst Du den Harm los!“ kam, sofern unter dem „Harmlosen“ auch das Heitere und Humoristische begriffen sein sollte, erst in späterer Stunde zur Geltung, als die feierlich gemessene Würde, mit der sich die Versammlung anfangs bewegte, einer ungebundeneren Faschingslaune gewichen war, wie sie sich auf unserer Illustration darstellt. Der Contretanz, der in dem Nebeneinander und Gegenüber der verschiedenartigsten Figuren die merkwürdigsten und erheiterndsten Gegensätze entstehen ließ, gab das Signal, daß der Geist des Carnevals erwacht war. Dieser Geist wird sich noch weit froher, frischer und freier entfalten, falls bei dem nächstjährigen Winterfest des Berliner Künstlervereins der Costümball sich zu einem Maskenball erweitert haben wird.
Aus New-York geht uns nachstehende Schilderung eines entsetzlichen Unglücks zu. Der Schreiber des Briefes ist Alexander Wallner, Franz Wallner’s ältester Sohn, der nach zurückgelegten Studien an der Universität Jena eine geachtete Stellung als Journalist in New-York einnimmt. Derselbe schreibt:
„Es ist die Zeit des Jahres, in der in allen katholischen Kirchen Festlichkeiten begangen werden. Um mir in einer solchen einen persönlichen Eindruck zu verschaffen, machte ich mich letzten Sonntag auf den Weg nach der St. Andreaskirche in der Douane-Street. Trotz des schlechten Wetters hatte sich eine große Menschenmenge vor der Kirche angesammelt, so daß ich einige Minuten aufgehalten wurde. Ich sah mir mechanisch die Umgebung der Kirche an. An dieselbe grenzt ein hohes, vielleicht sechsstöckiges Gebäude, das früher als Glaswaarenniederlage gedient hat. In letzter Woche jedoch hatte es in dem Gebäude gebrannt, und zwar so stark, daß nur die nackten Wände der Seitenmauern in die Höhe ragten. Die der Kirche zunächst befindliche Mauer zeigte bedenkliche Risse und war nothdürftig durch Eisenklammern etc. gestützt. Der Wind raste um die Ruine und brachte sie hin und wieder zum Schwanken. Unwillkürlich kam mir der Gedanke: ‚Wie, wenn die Mauer umstürzte und uns Alle erschlüge?‘ Doch ich hatte nicht Zeit, den Gedanken auszudenken; die Menge schob mich vorwärts, und ehe ich mich versah, befand ich mich auf der Empore. Der Gottesdienst begann, und ich dachte nicht mehr an meinen närrischen Einfall. Zudem fesselte mich der Pfaffe, der auf der Kanzel stand und seiner Gemeinde ordentlich einheizte. Er beschrieb die Schrecken der Hölle mit einer wahrhaft teuflischen Phantasie, und das dumme Volk lauschte andächtig diesen von Pech und Schwefel triefenden Expectorationen. Eben schilderte er markvoll die Qualen der zum ewigen Flammentode verurtheilten Unglücklichen, als urplötzlich ein furchtbares Gepolter ertönte. Meine flüchtige Befürchtung von vorhin war eingetroffen. Das sechs Stock hohe Gebäude war auf das Kirchendach gestürzt und hatte dasselbe in einem Umfange von mindestens vierzig Quadratfuß durchschlagen. Gewaltige Balken und Steine regneten förmlich herab, zumeist auf uns, die wir uns unglücklicher Weise auf der Empore befanden. Unmittelbar vor mir schlug ein kolossaler Ziegel mit solcher Wucht gegen die Brüstung, daß er dieselbe wie ein Schwefelholz zerknickte und mitsammt einem Stücke des Bodens in die untere Kirche hinabriß. Ich rettete mich vor den folgenden Geschossen nur durch einen entschlossenen Sprung in die Tiefe. Glücklicher Weise kam ich ohne jedwede Verletzung davon.
Die ganze Geschichte dauerte nicht halb so lange Zeit, wie ich zum Niederschreiben brauche. Der ersten Ladung folgte keine zweite, doch war Gefahr vorhanden, daß schließlich noch das ganze baufällige Nebengebäude auf uns niederrasseln könnte. Es war also nicht angenehm, in der Kirche bleiben zu müssen. Ich versuchte deshalb, mir einen Ausweg zu bahnen. Vergeblicher Versuch! Ebenso leicht hätte ich versuchen können, direct durch die Wände zu gehen.
Ein panischer Schrecken hatte sich der ohnehin durch die Predigt schon furchtbar aufgeregten Versammlung bemächtigt. Jeder glaubte, das jüngste Gericht sei nahe. In blinder Furcht hatte sich Alles nach den Thüren gestürzt, und da dieselben unglücklicher Weise nach innen schlossen, konnte Keiner heraus. Resignirt suchte ich mir einen möglichst sichern Platz unter der Kanzel und stellte meine Betrachtungen an über den groben Egoismus und die Rohheit der menschlichen Natur, die hier wieder so classisch an den Tag trat. Keiner bekümmerte sich um die Verwundeten, die auf dem Boden lagen. Ueber sie hinweg hatte sich der wüthende, wahnsinnige Strom gewälzt und die Unseligen zerstampft und zertreten. Da lagen sie todt hingestreckt. Die offenen Augen hatten noch den Ausdruck angstvoller Starrheit, der sich ihnen bei ihrem furchtbaren Tode eingeprägt hatte. Ein kleiner Junge war gefallen. Auch über ihn hatte sich die Menge hinweggestürzt und ihn getödtet. Die kleinen Hände waren noch wie flehend über dem Gesichte zusammengefaltet. Ringsumher lagen blutbespritzte Trümmer, Gebetbücher, Schirme, Hüte, Alles mit Blutflecken. Vor dem Altare stand eine große Blutlache.
Ein furchtbarer Moment folgte. Die Frauen kreischten, die Männer fluchten. Einer derselben schleuderte einen eichenen Schemel gegen das hohe Fenster, dessen Brüstung er herausbrach, um sich so zu retten. Er wurde verhindert. Man hing sich an seine Schöße. Die Bestie wollte nicht, daß sich Einer allein rette. Diejenigen, die noch auf der Galerie waren, sprangen herab, unbekümmert, ob sie auf die Köpfe der unten Zusammengedrängten trafen, oder nicht. Jeder kämpfte nur für das eigene Bischen Leben. Von allen Seiten die entsetzlichen Verzweiflungsschreie Derer, die, erdrückt, dem wüthenden Drängen der Menge zum
verschiedene: Die Gartenlaube (1875). Ernst Keil's Nachfolger, Leipzig 1875, Seite 259. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1875)_259.jpg&oldid=- (Version vom 11.5.2019)